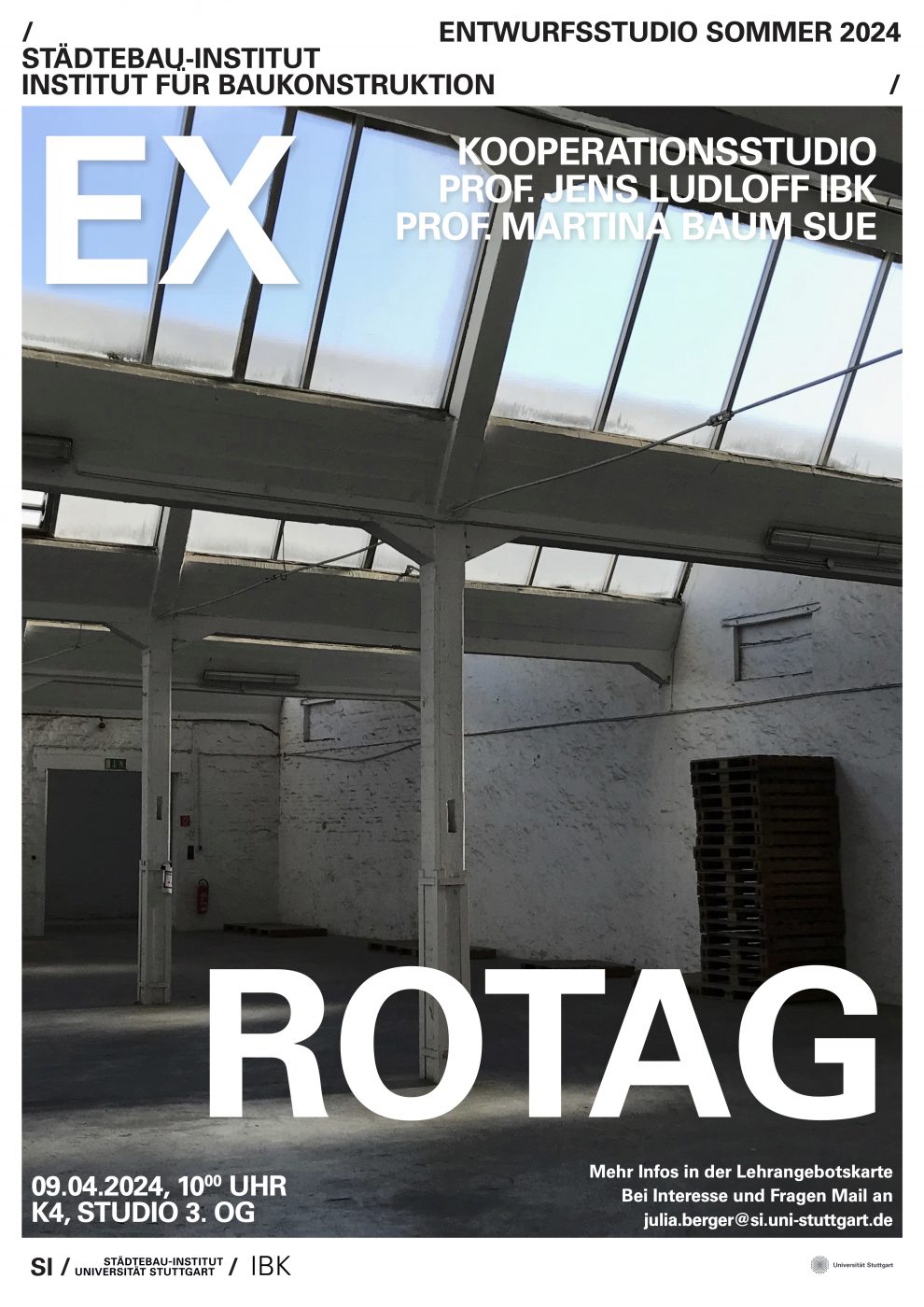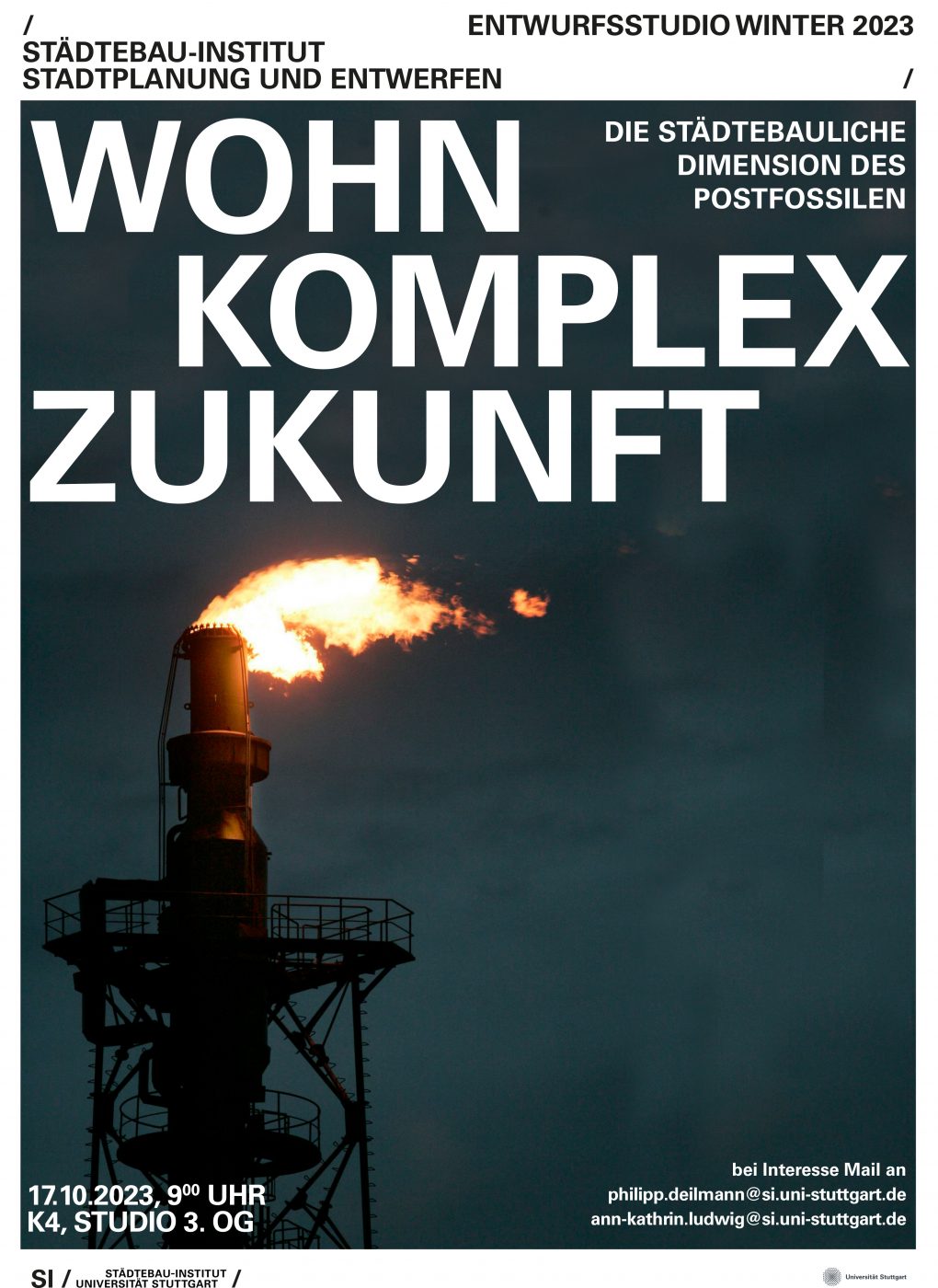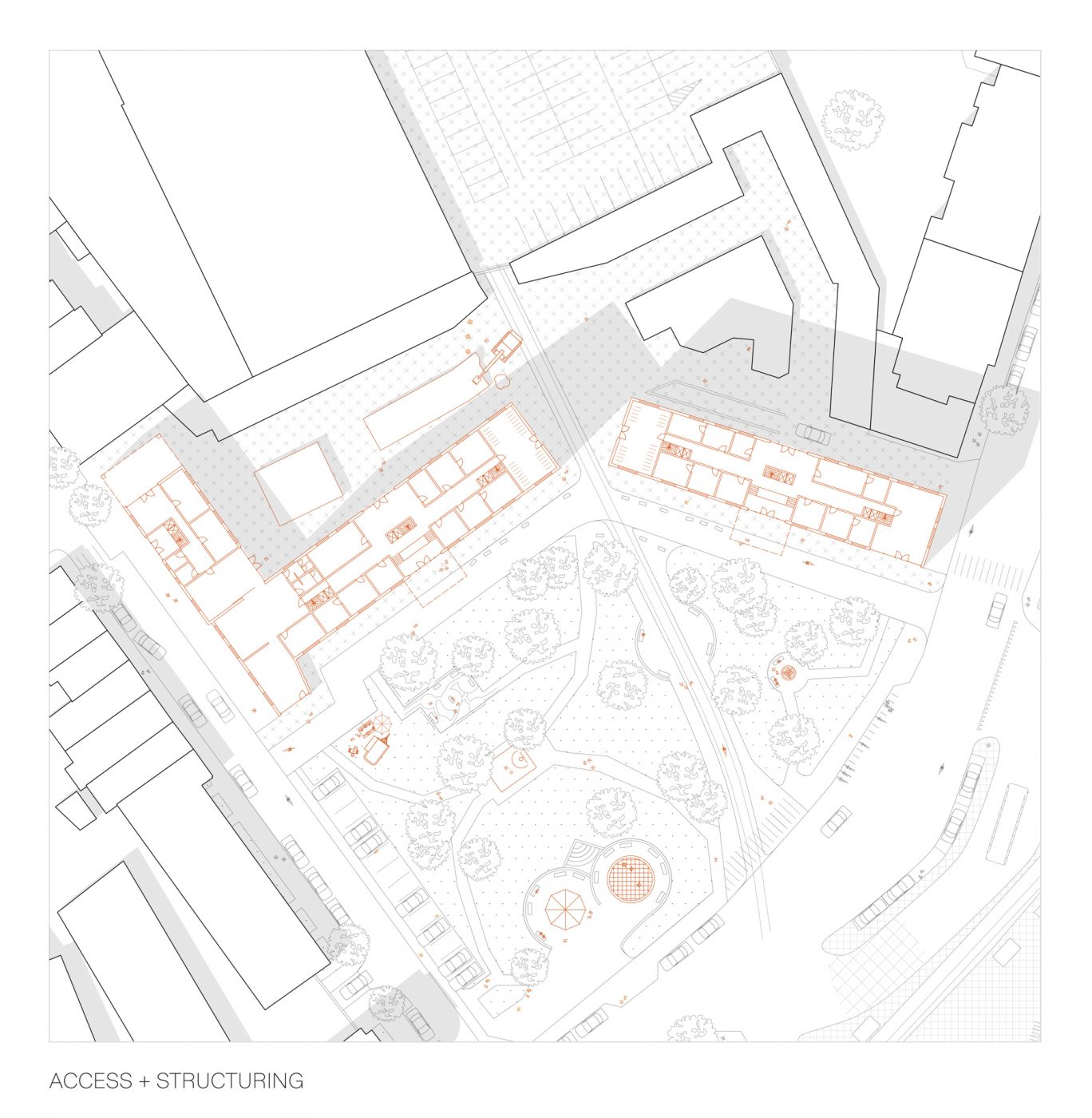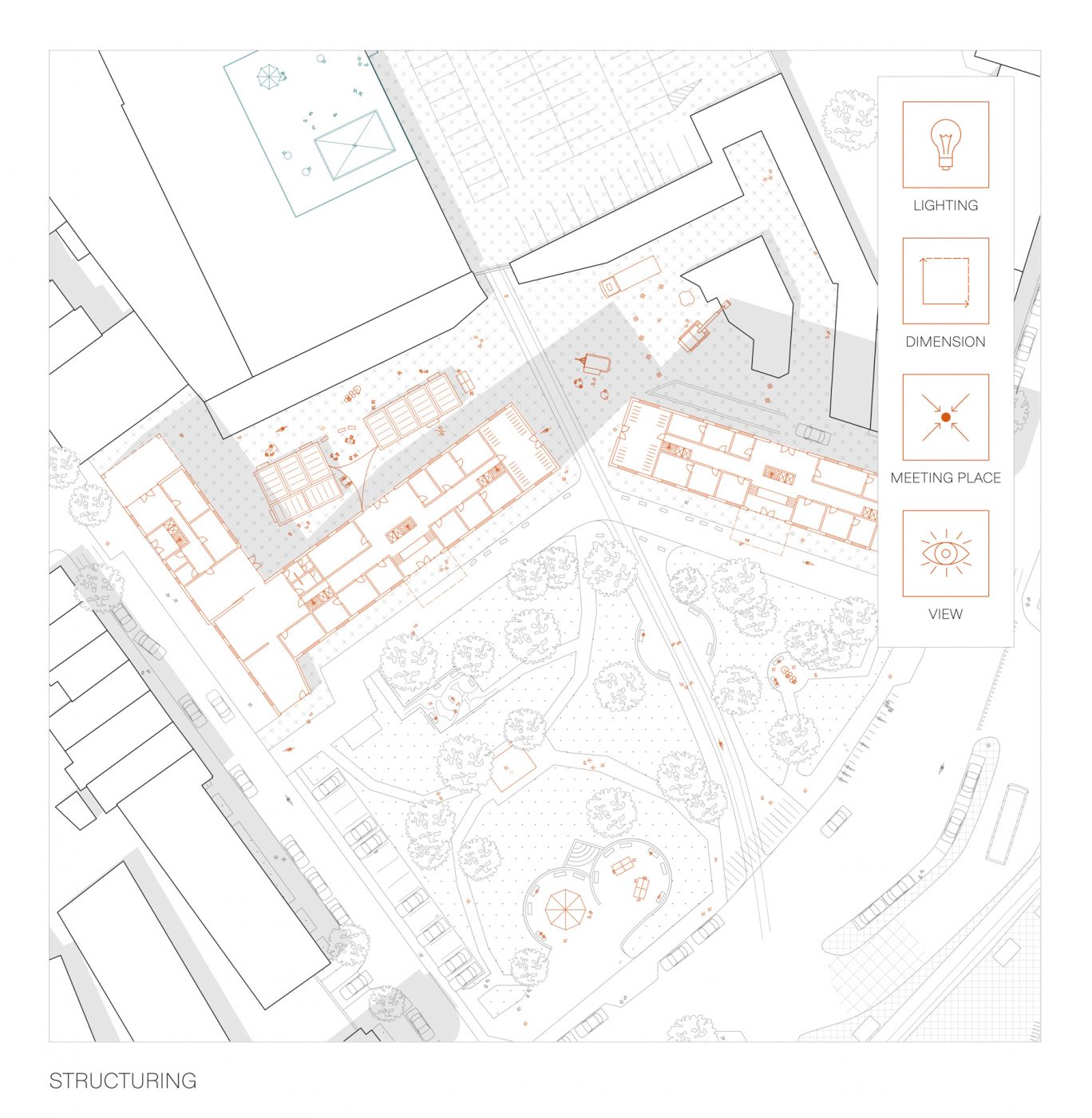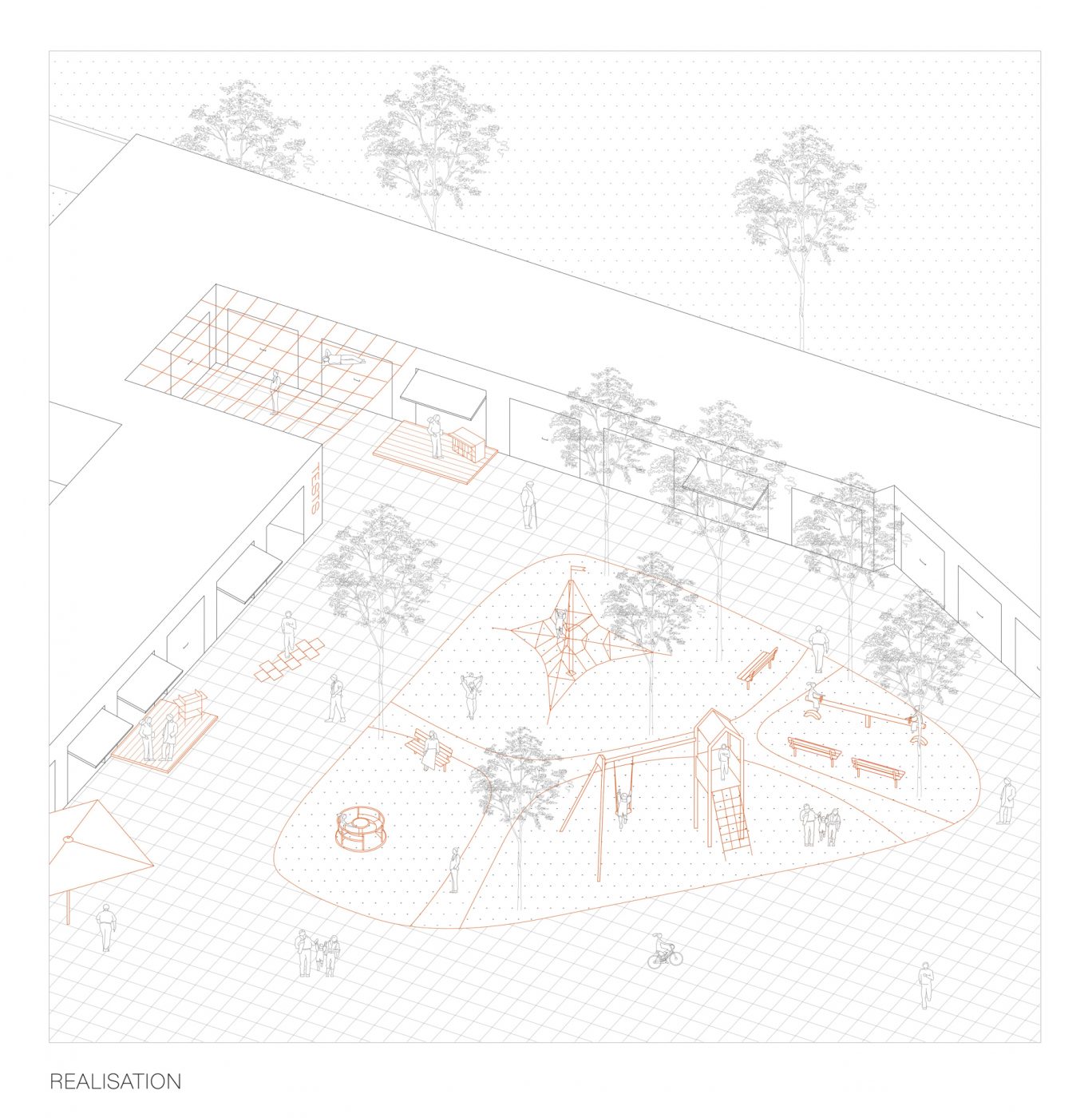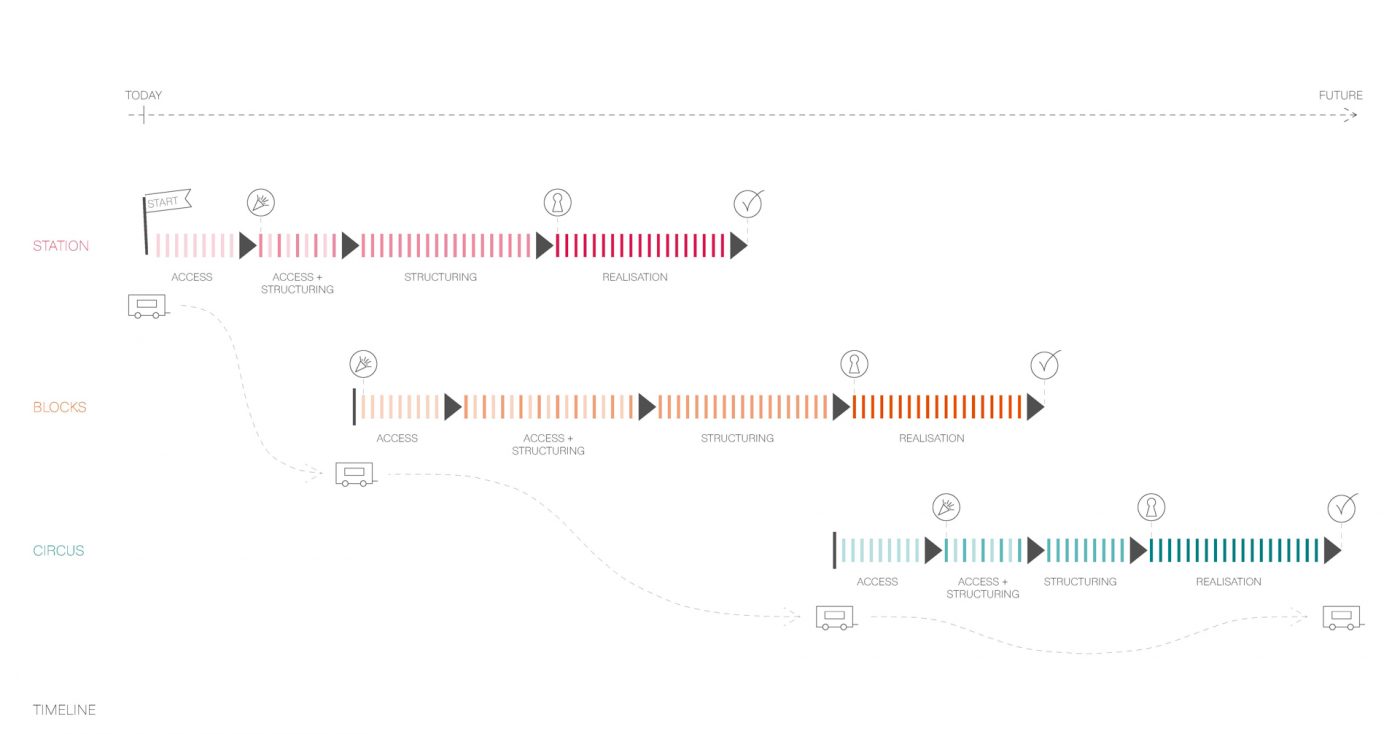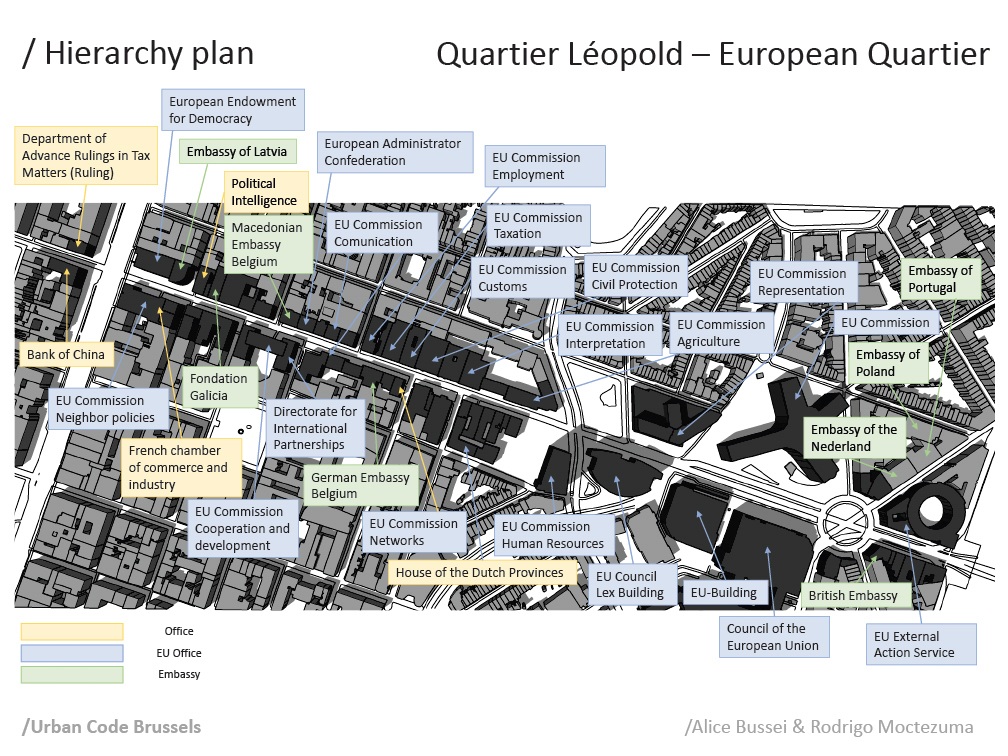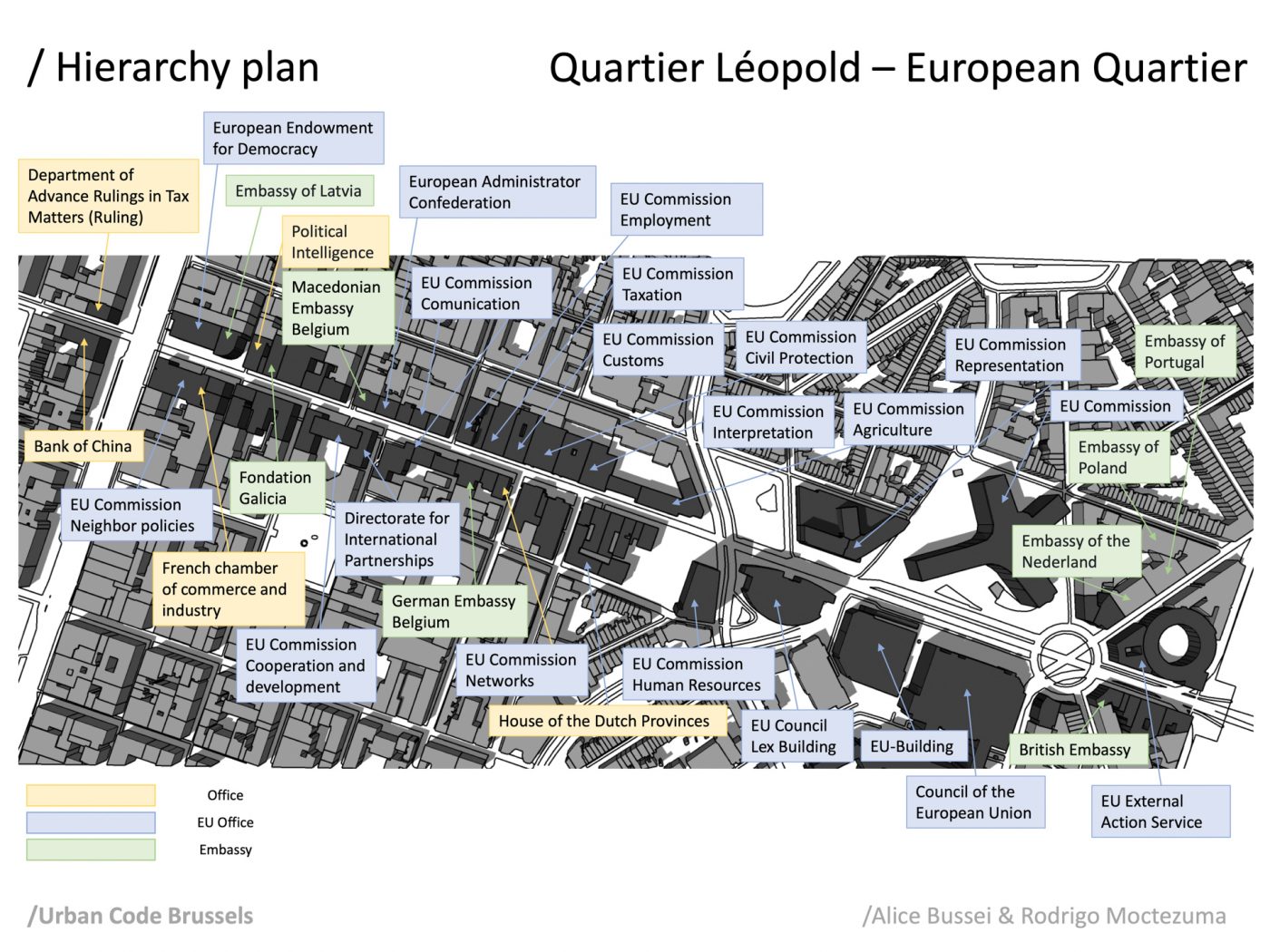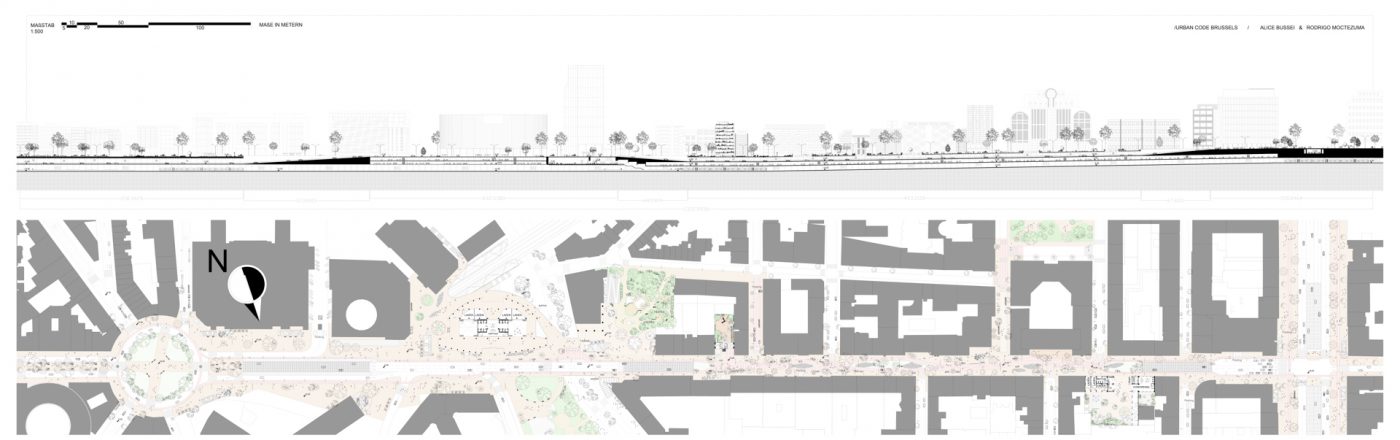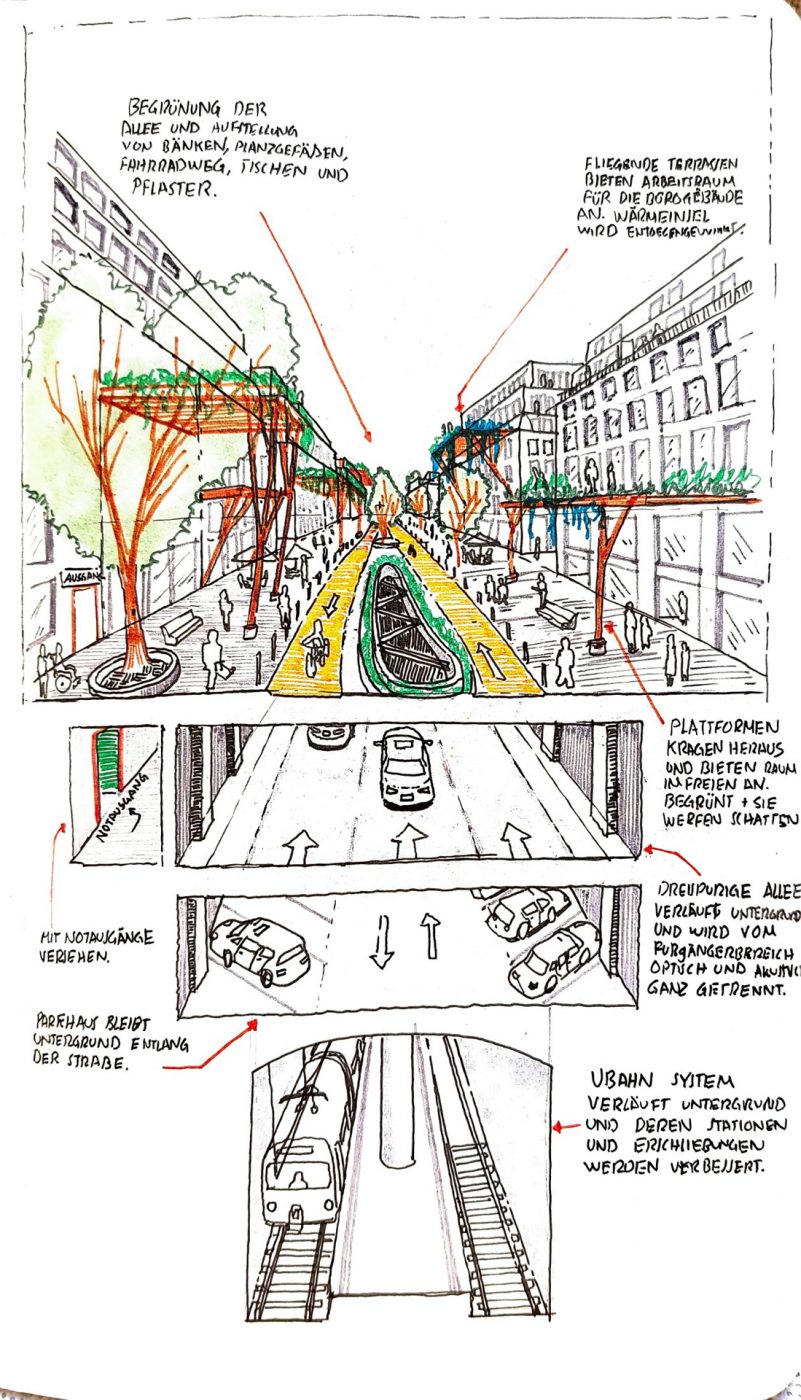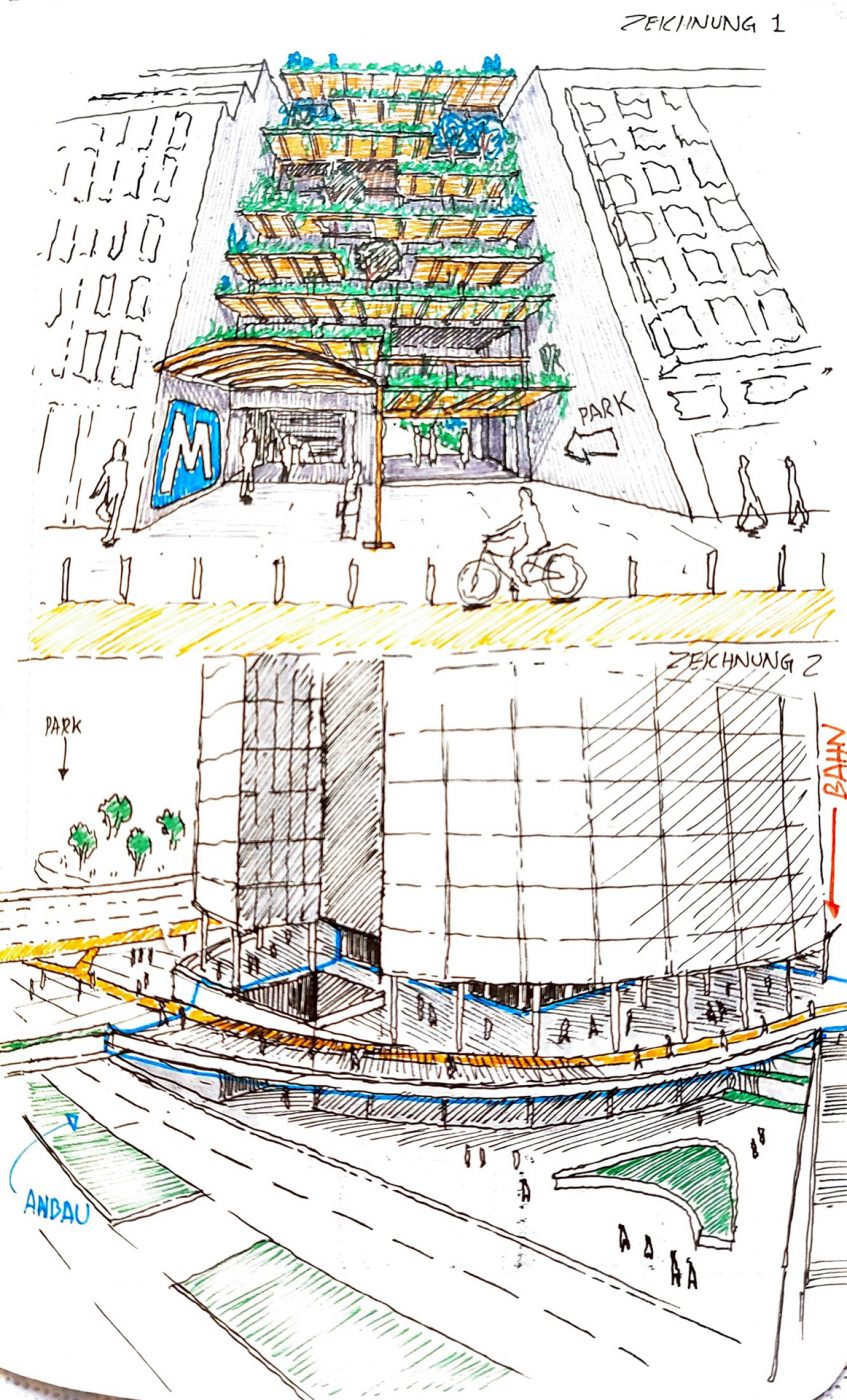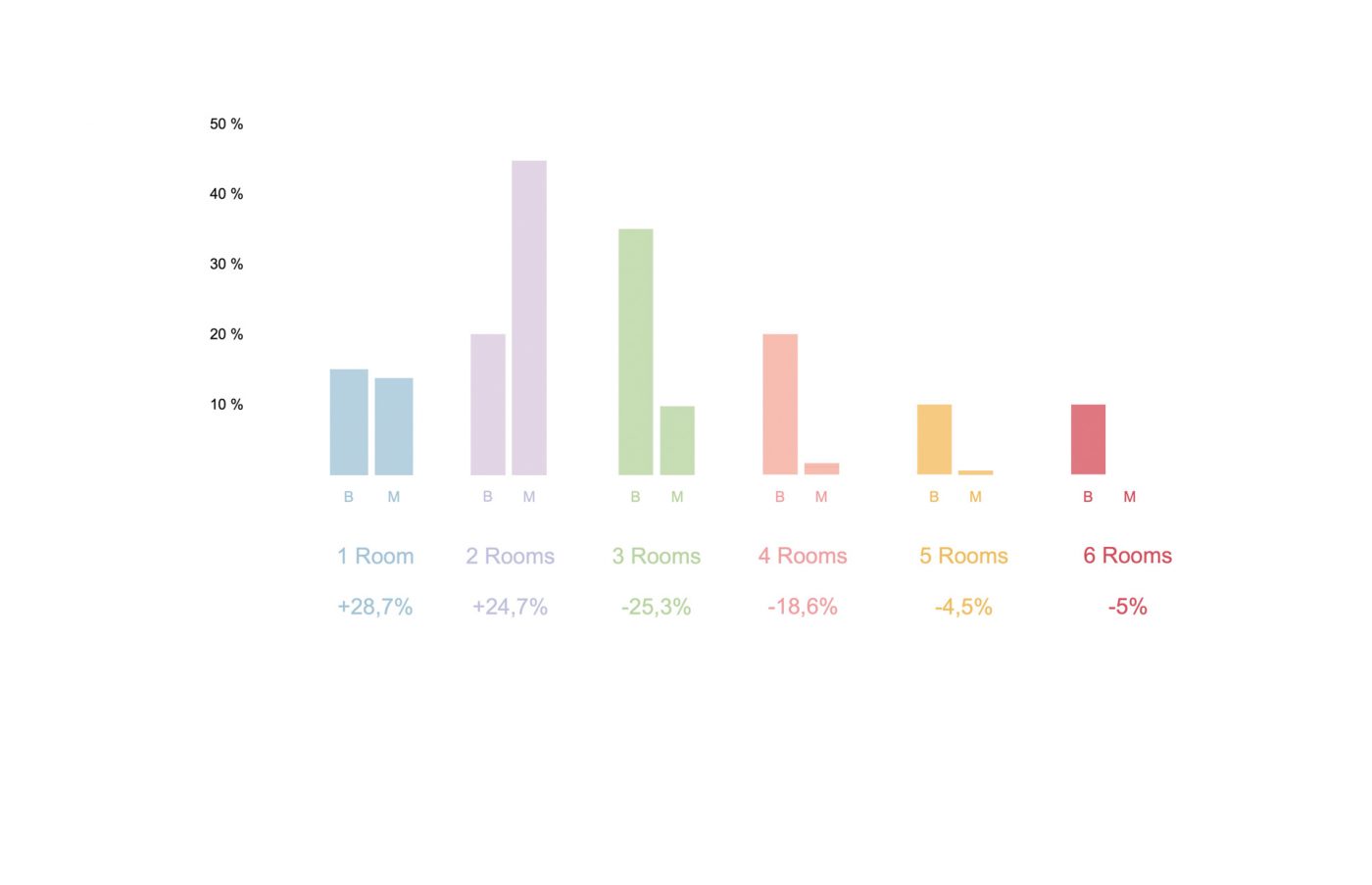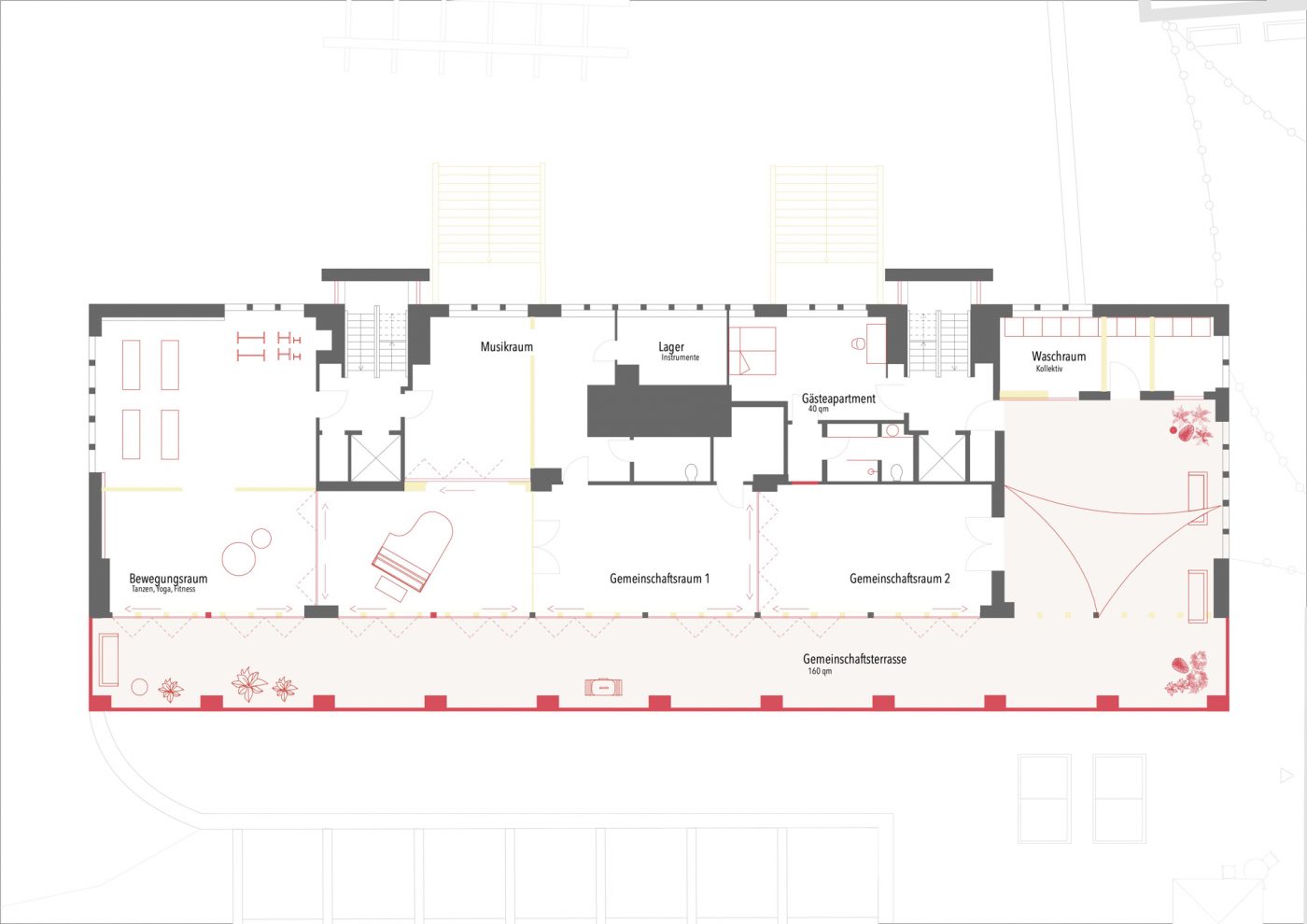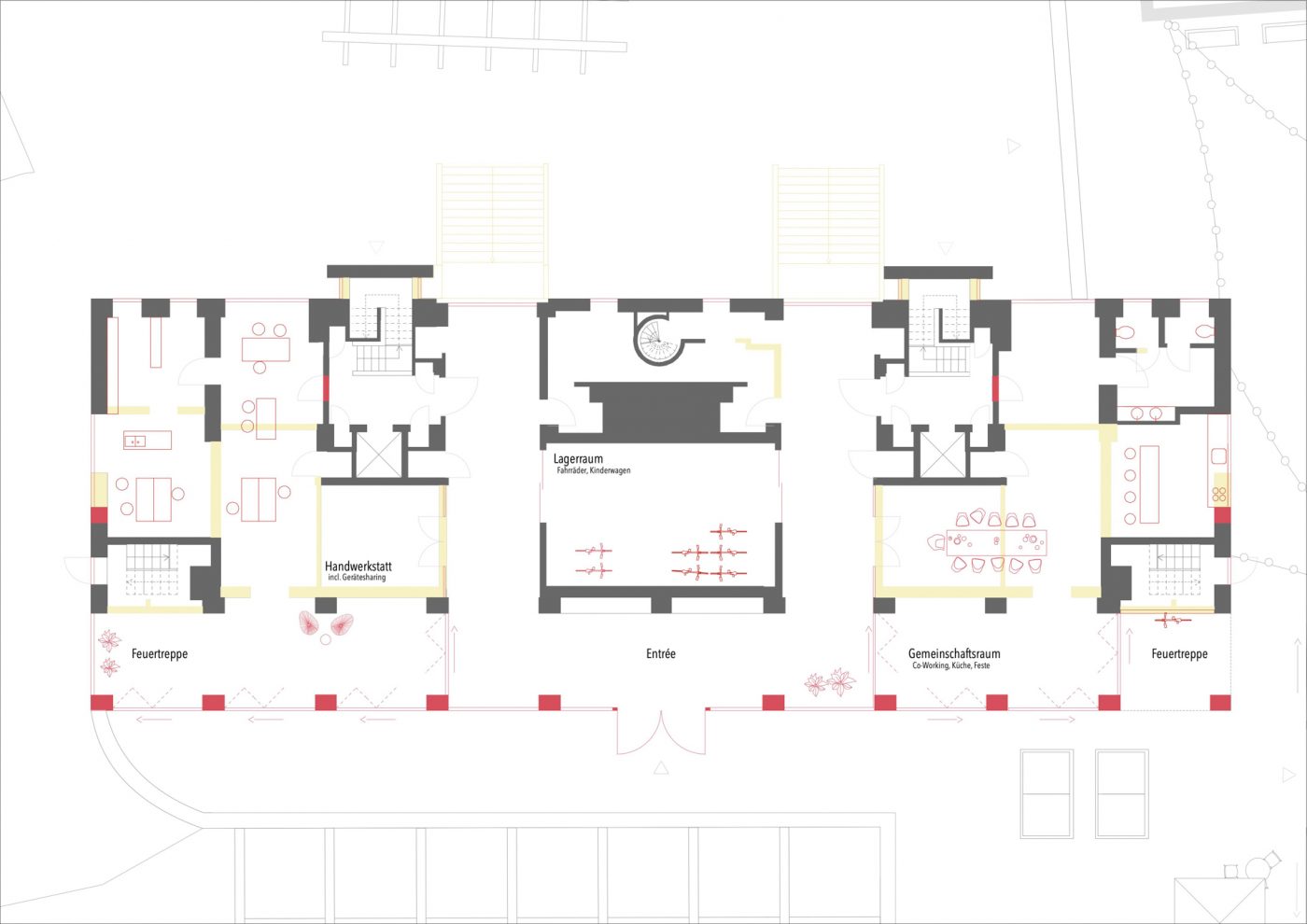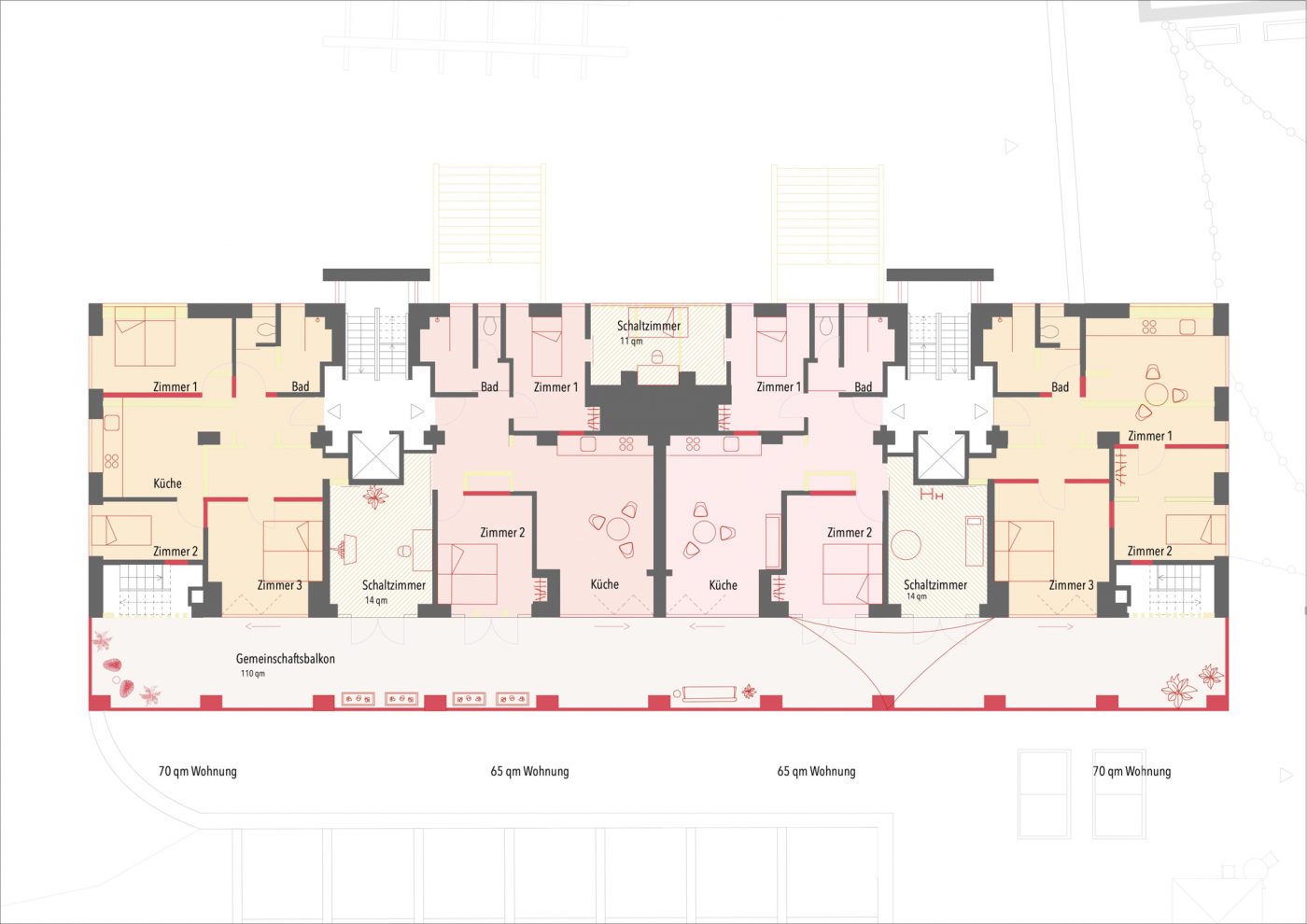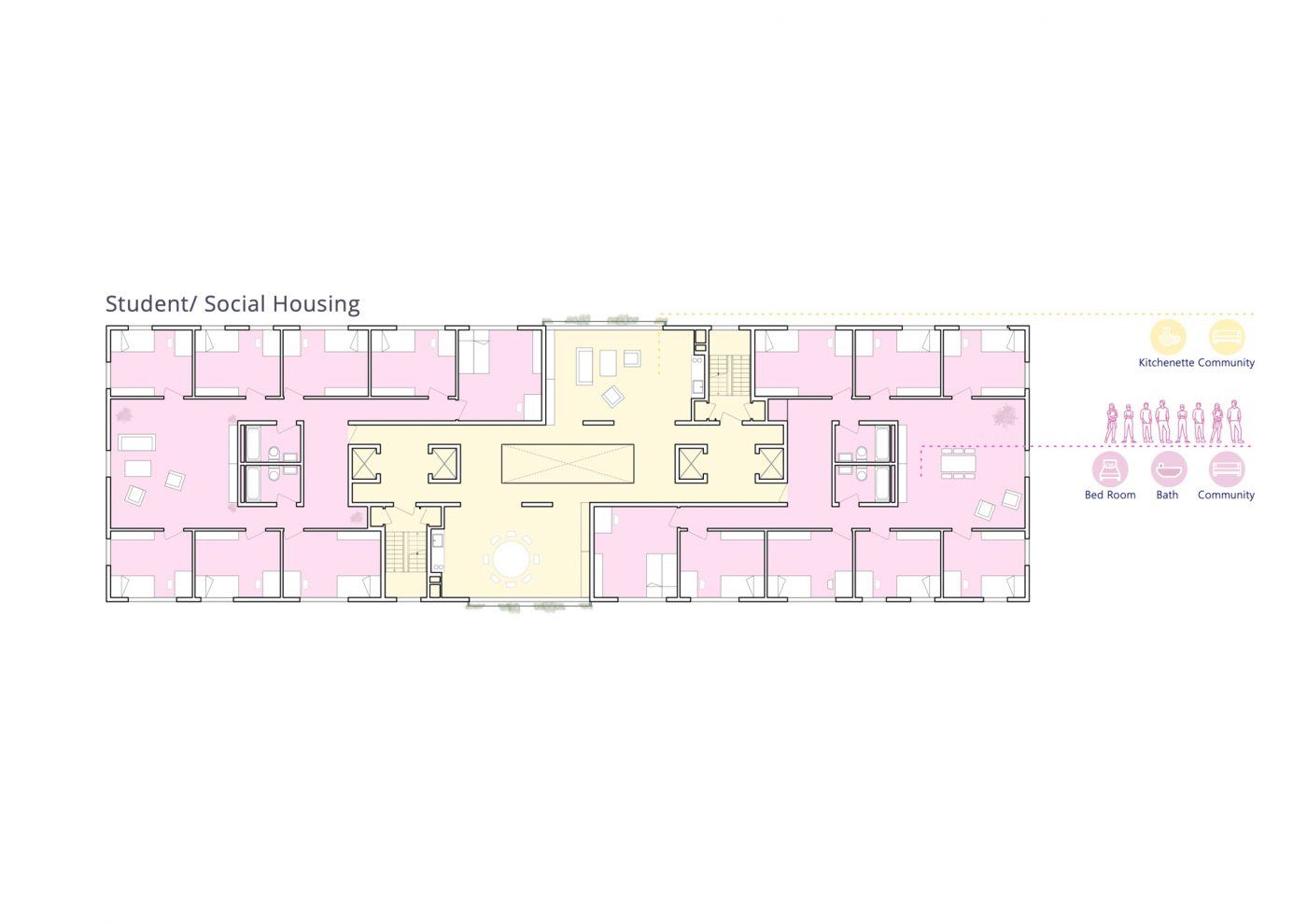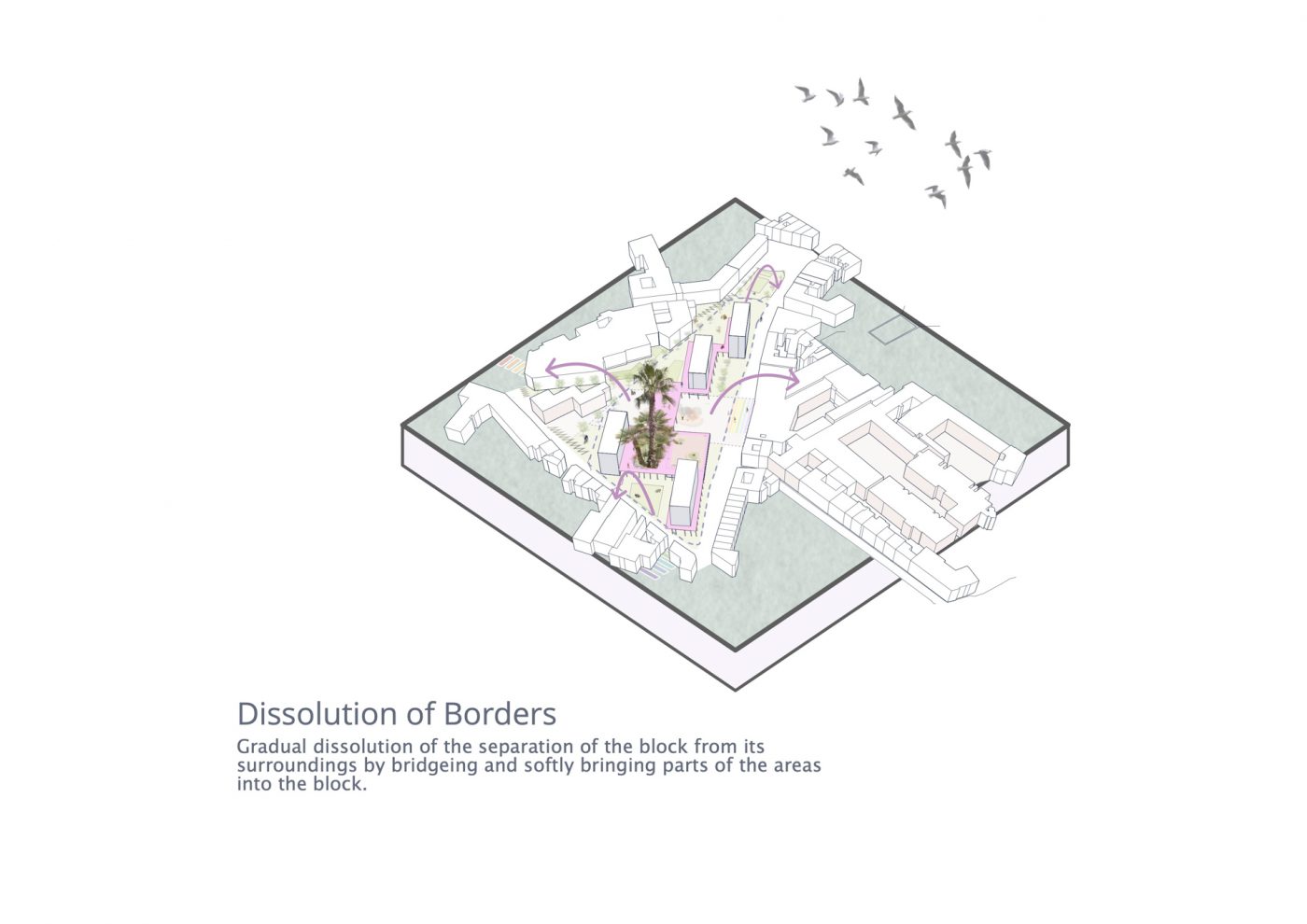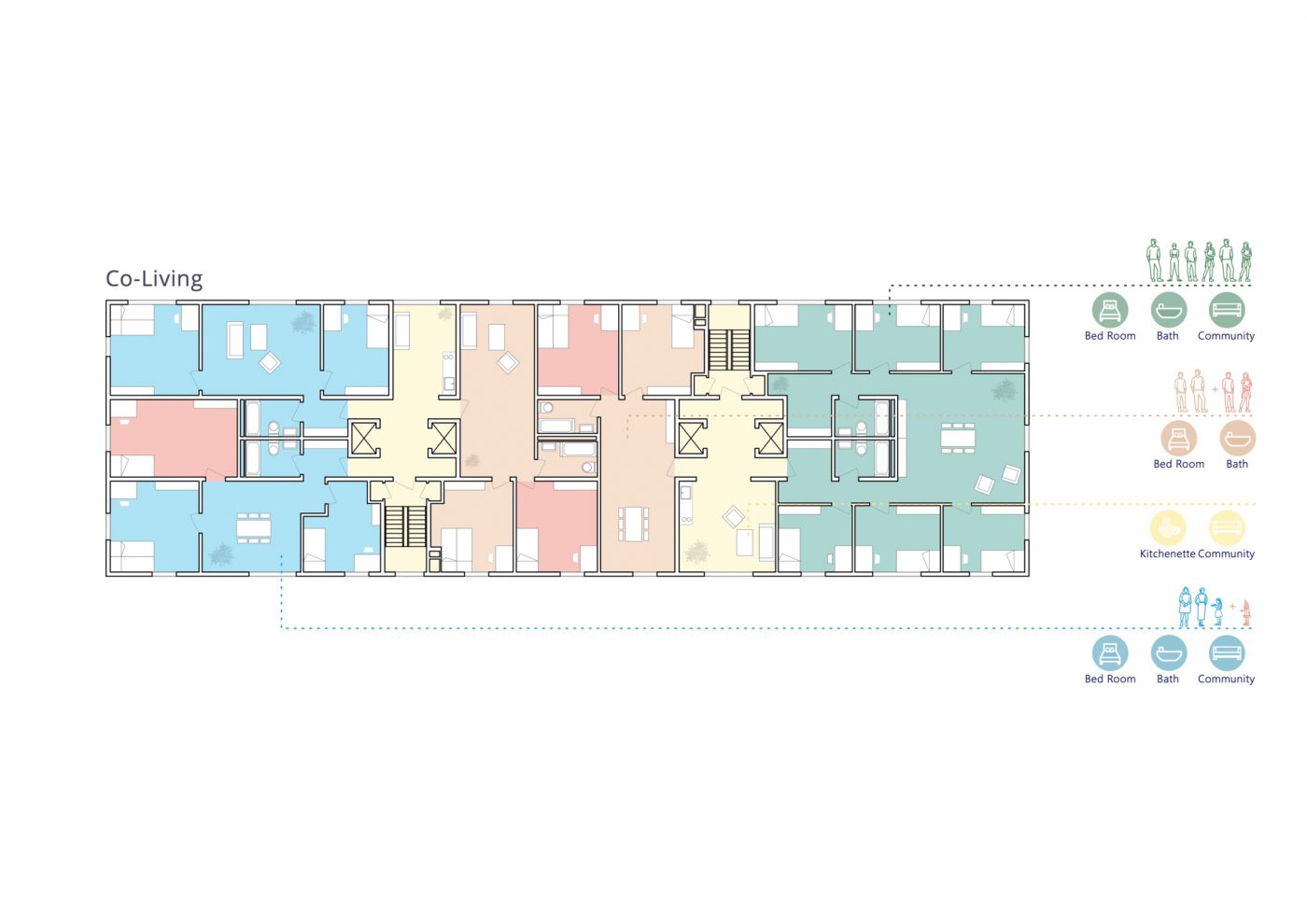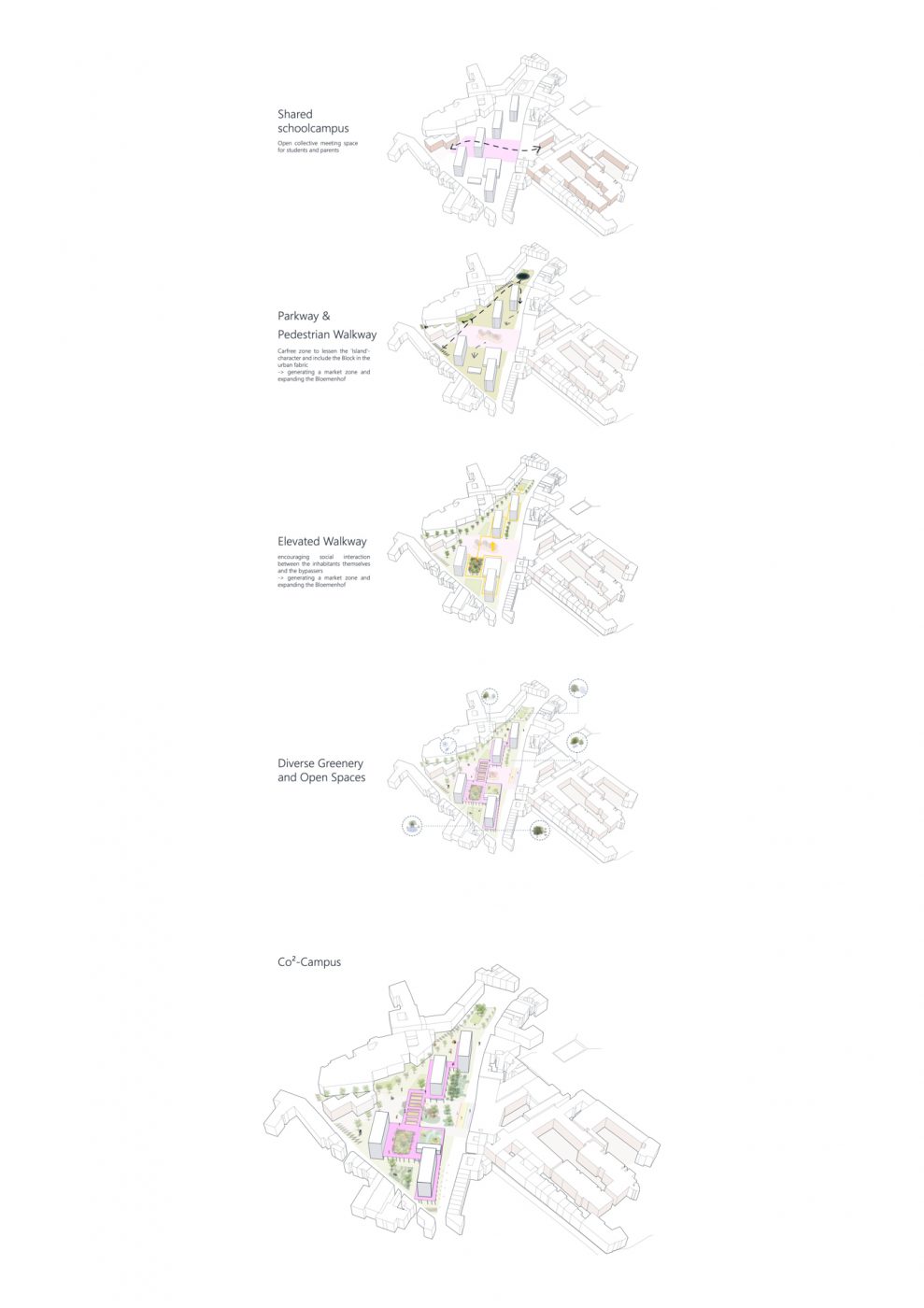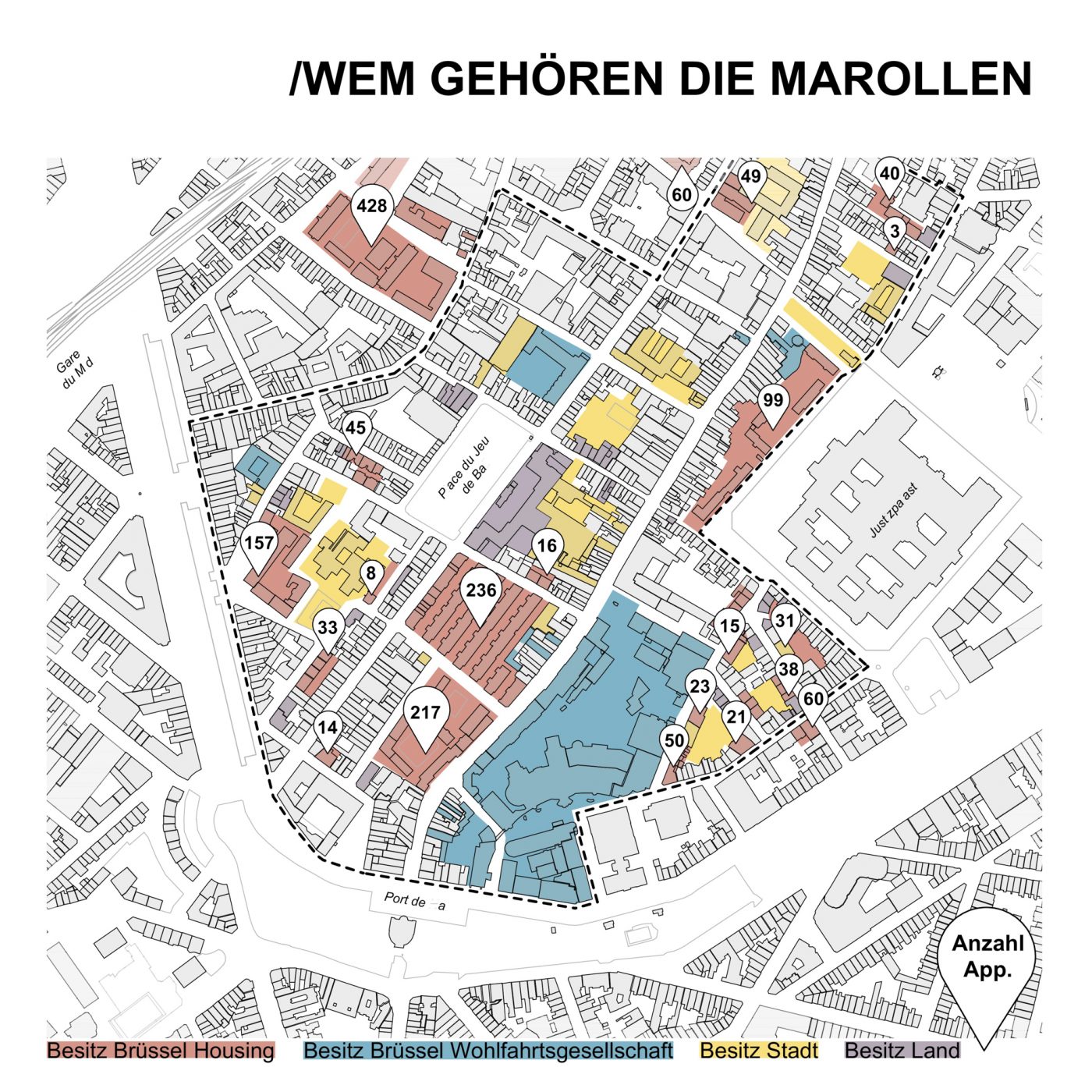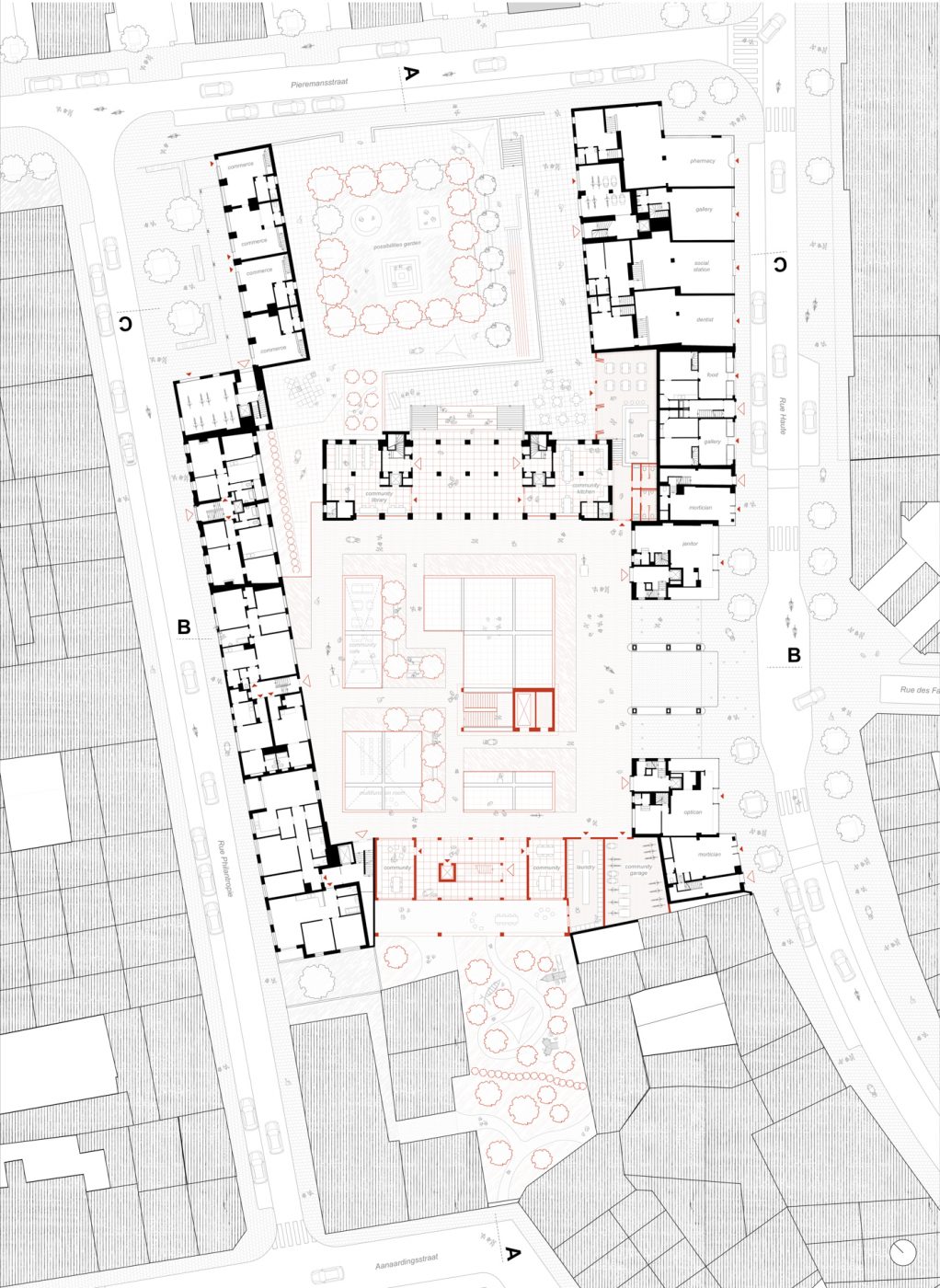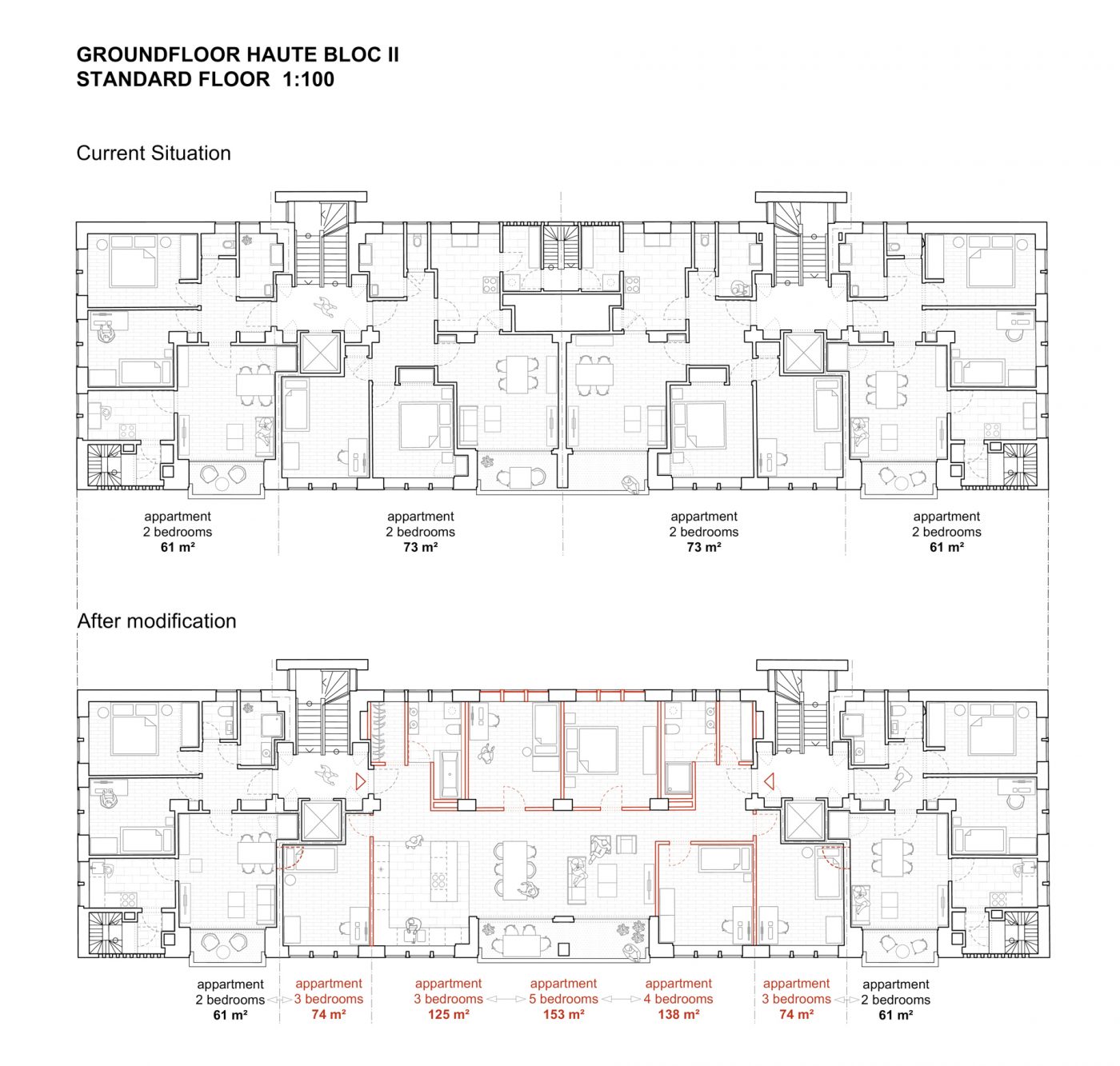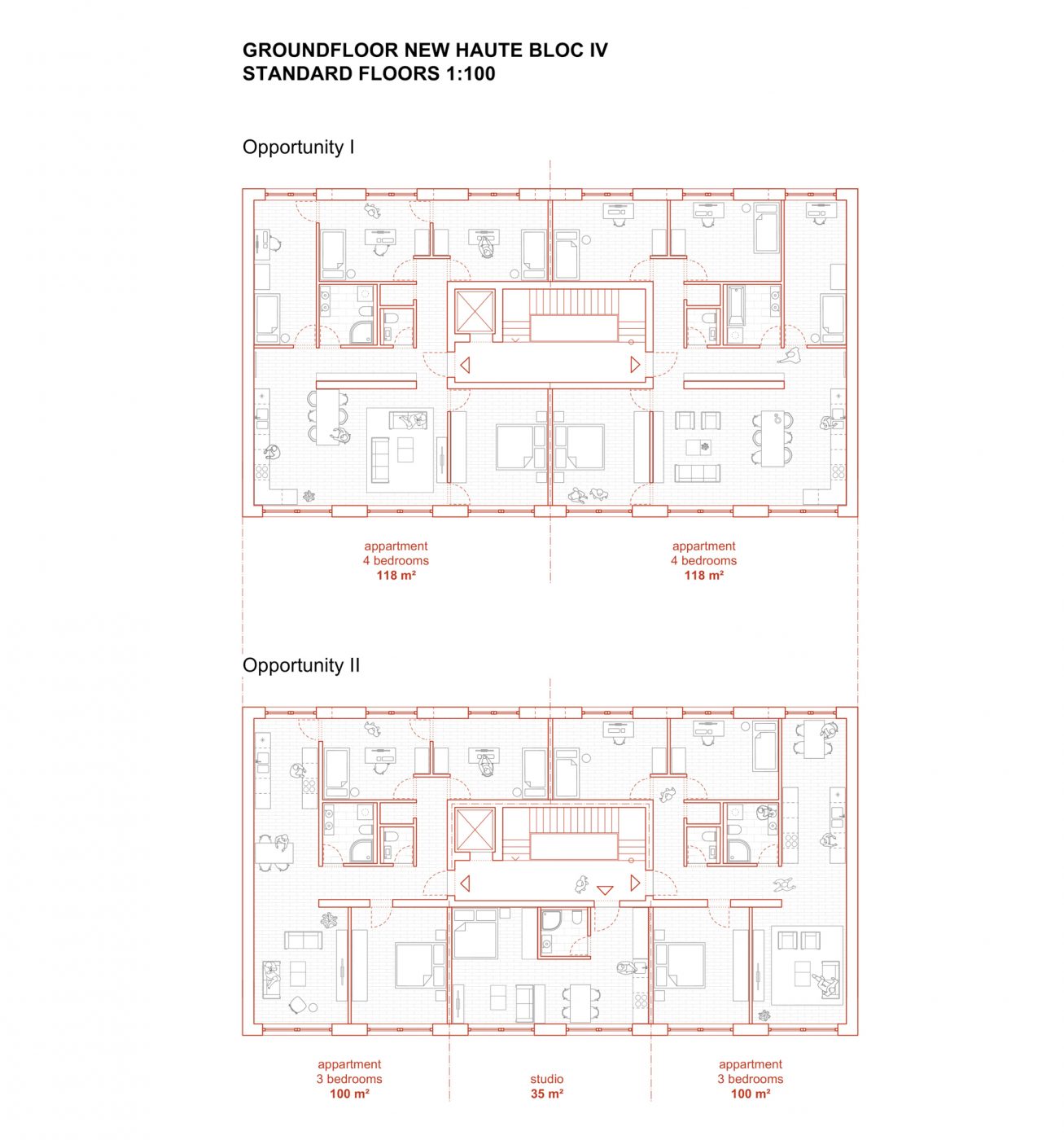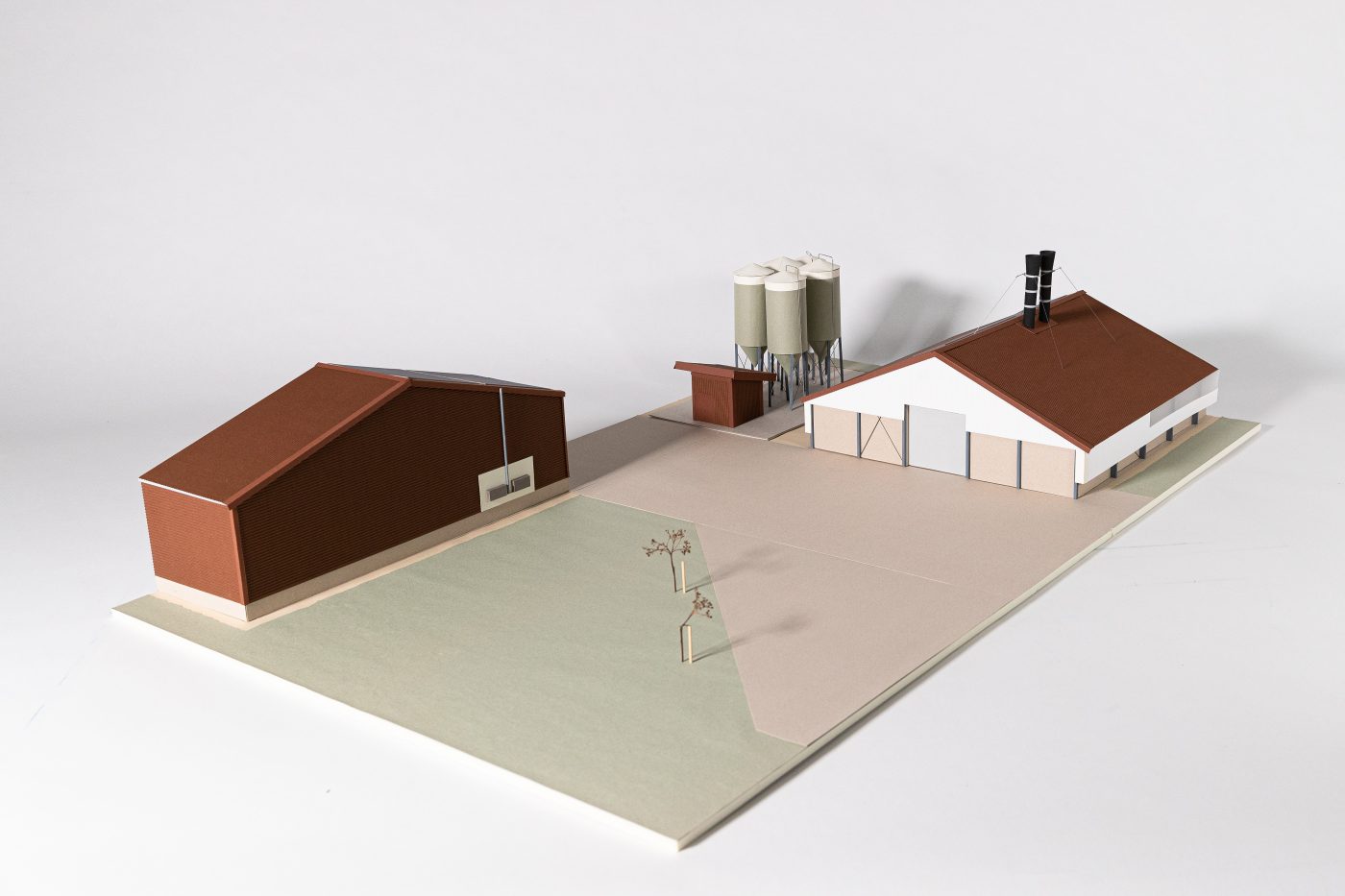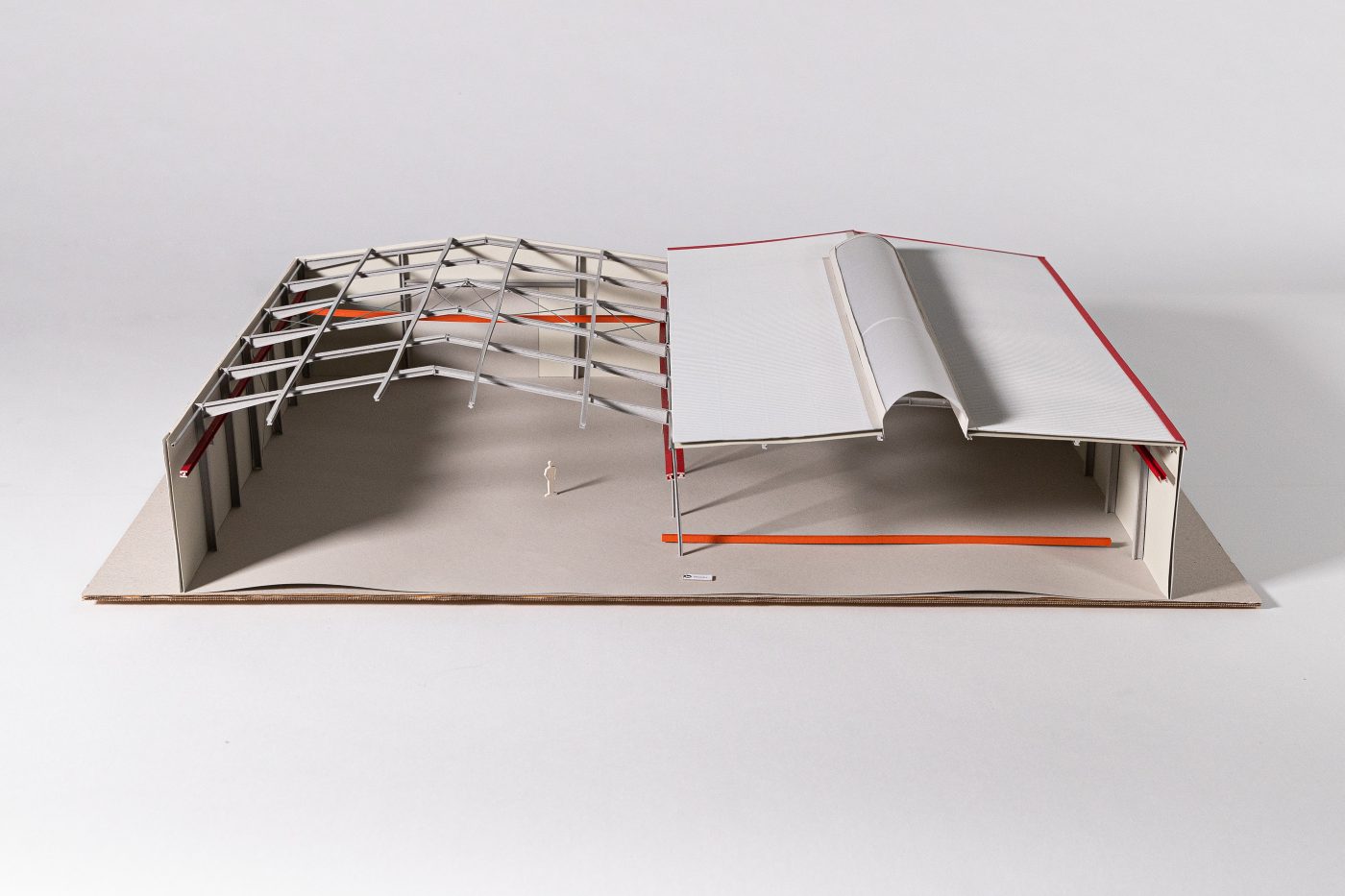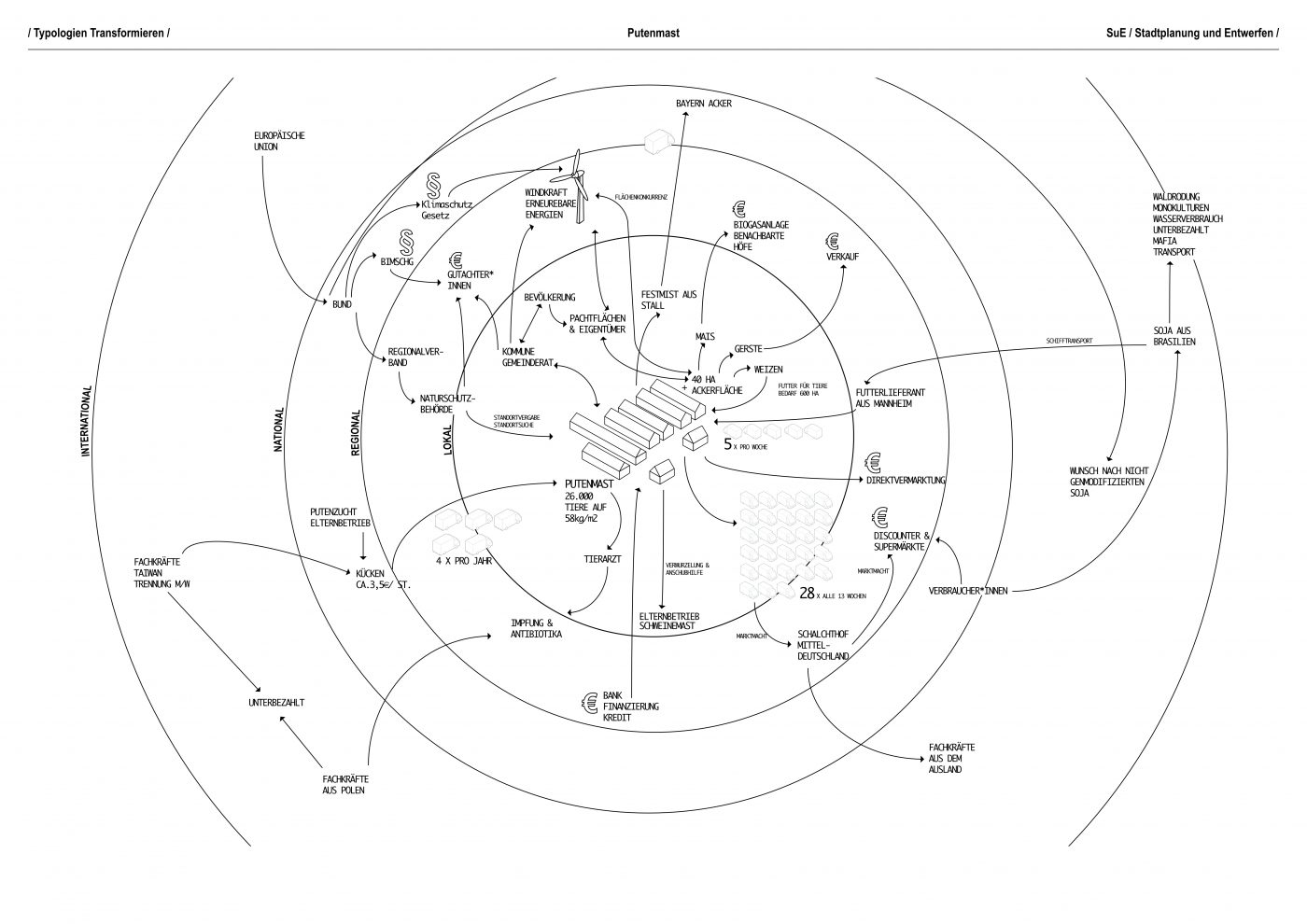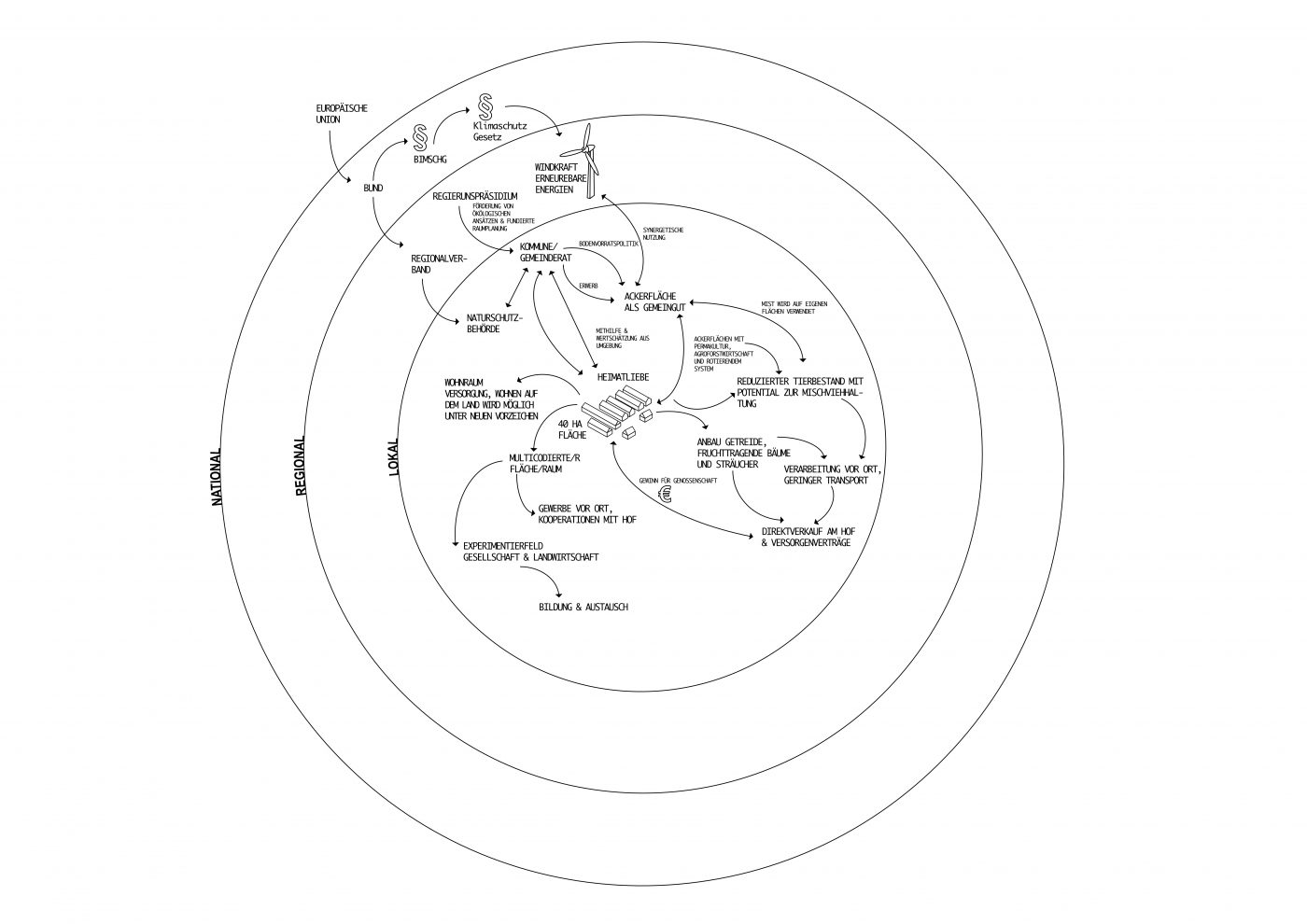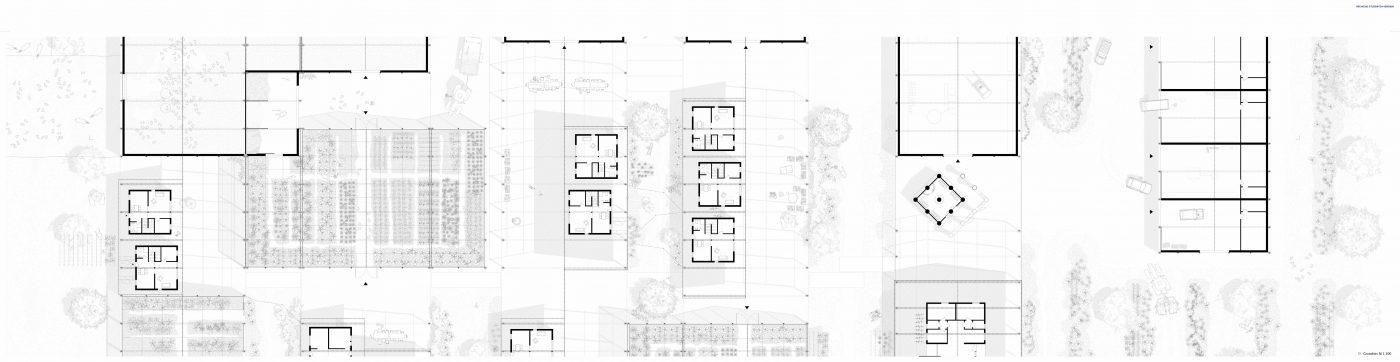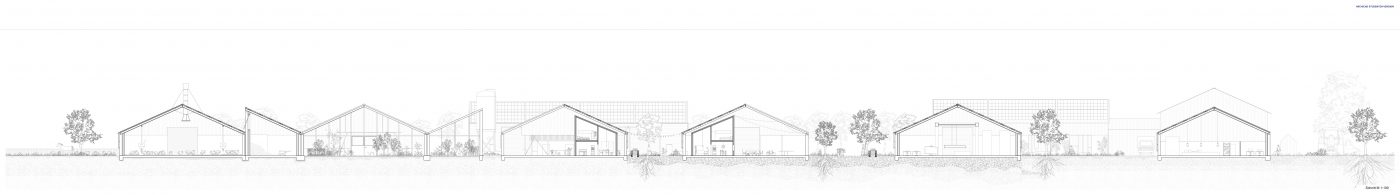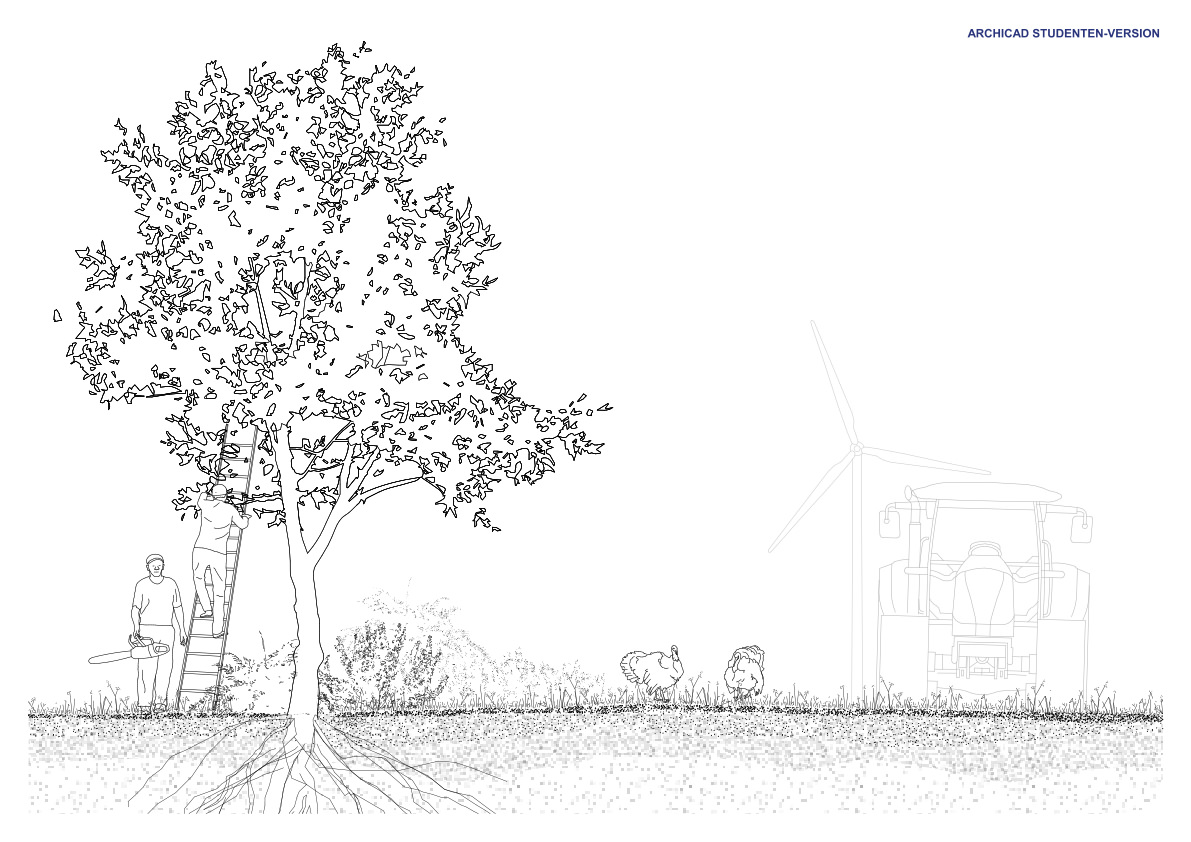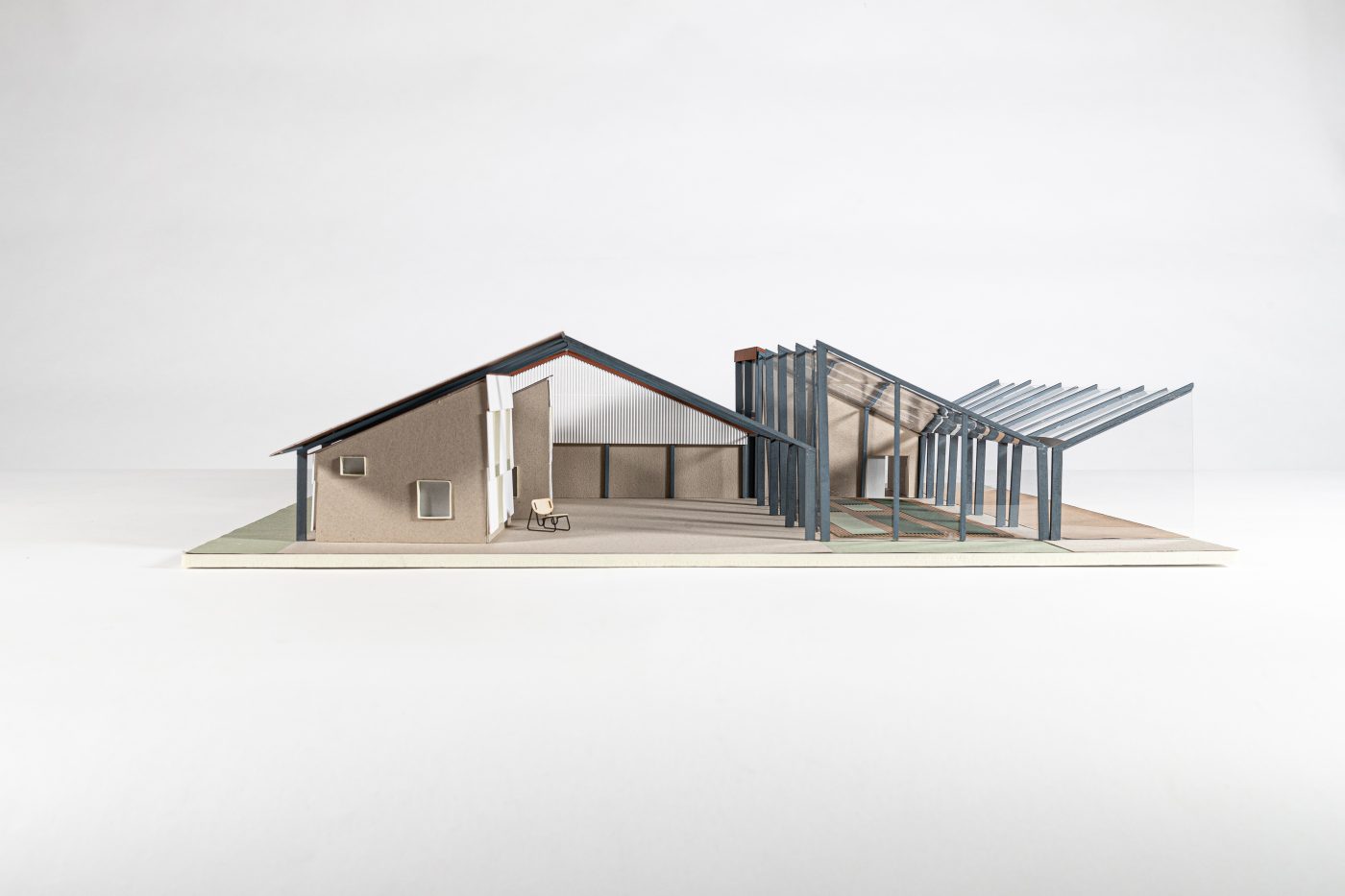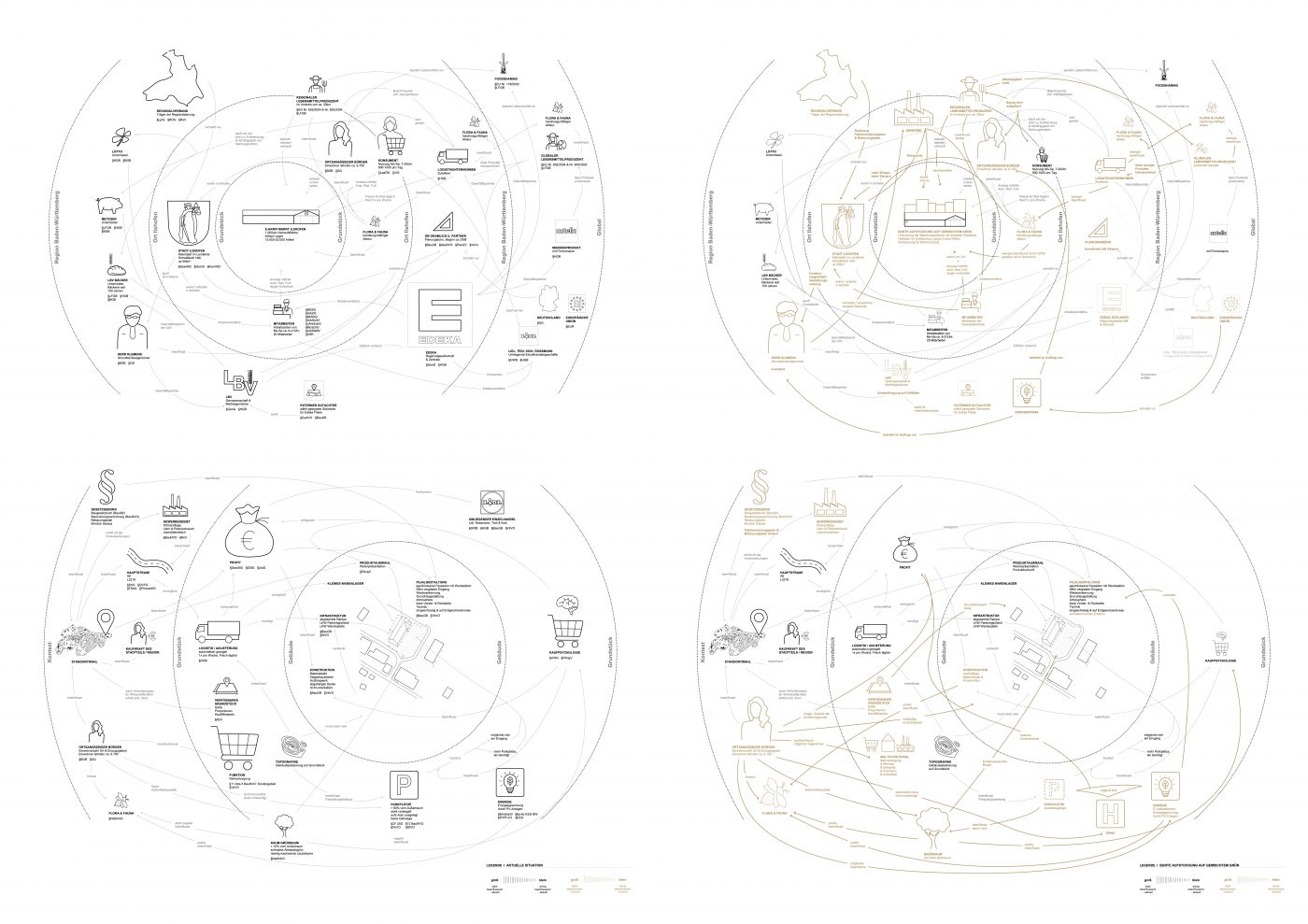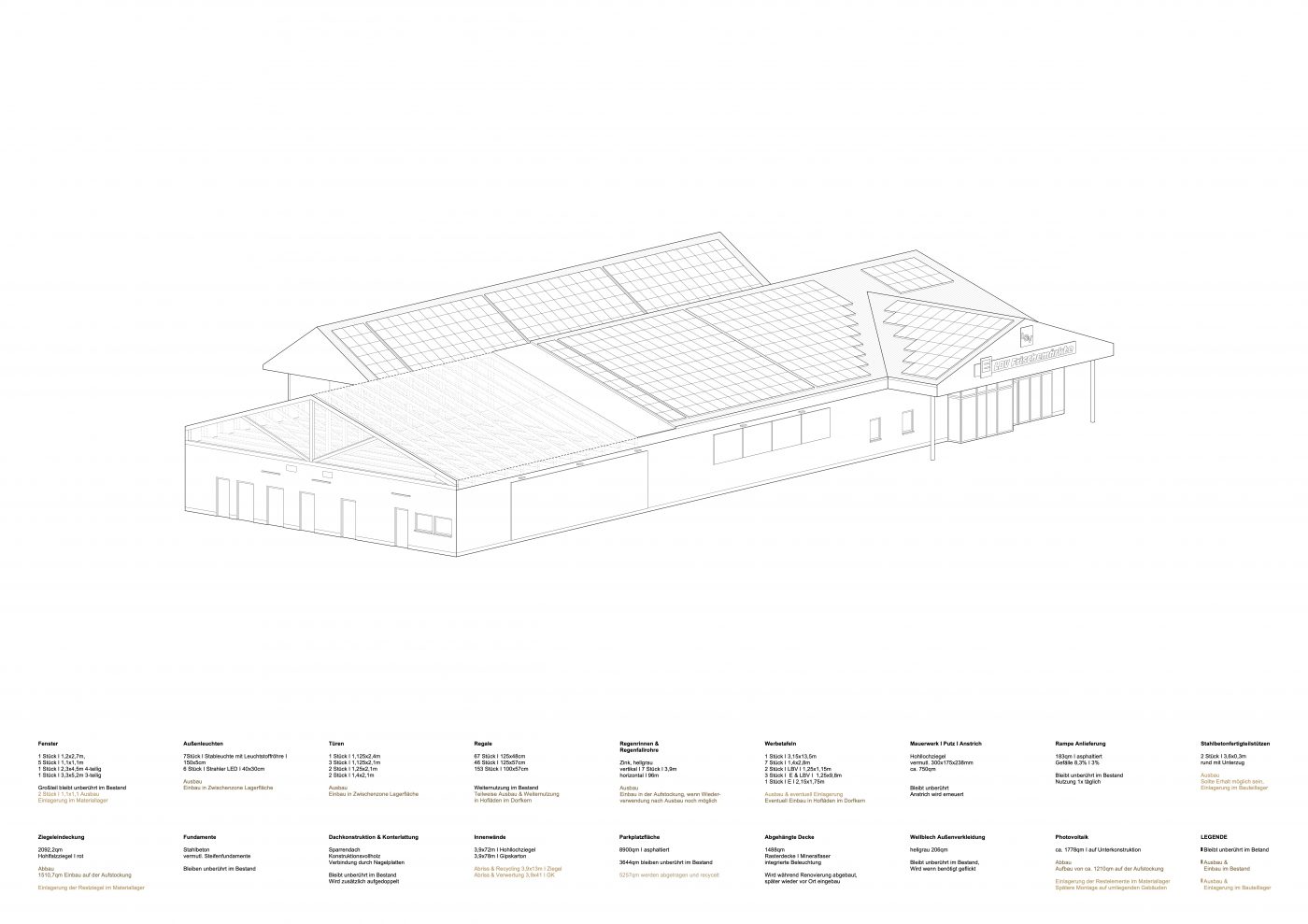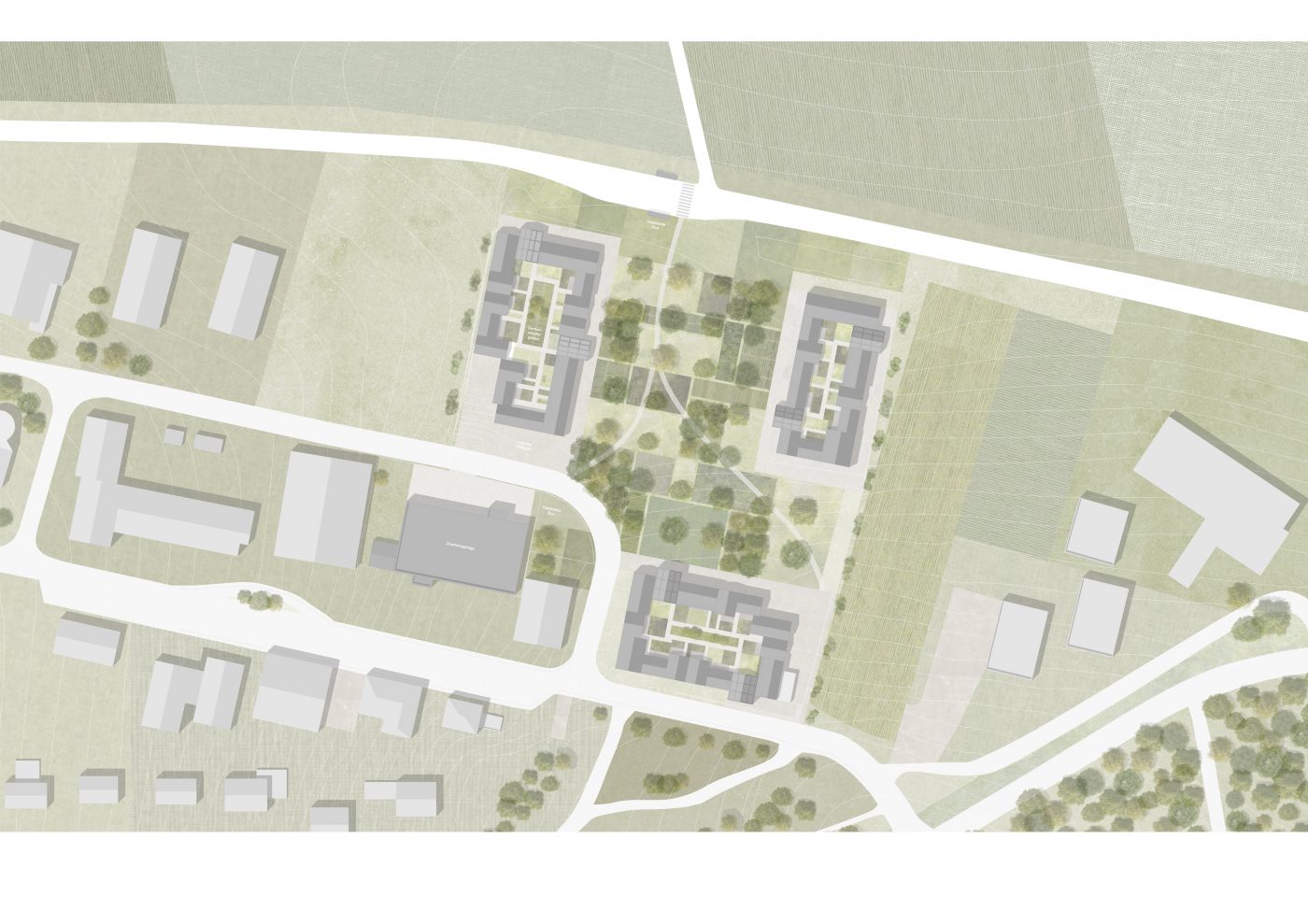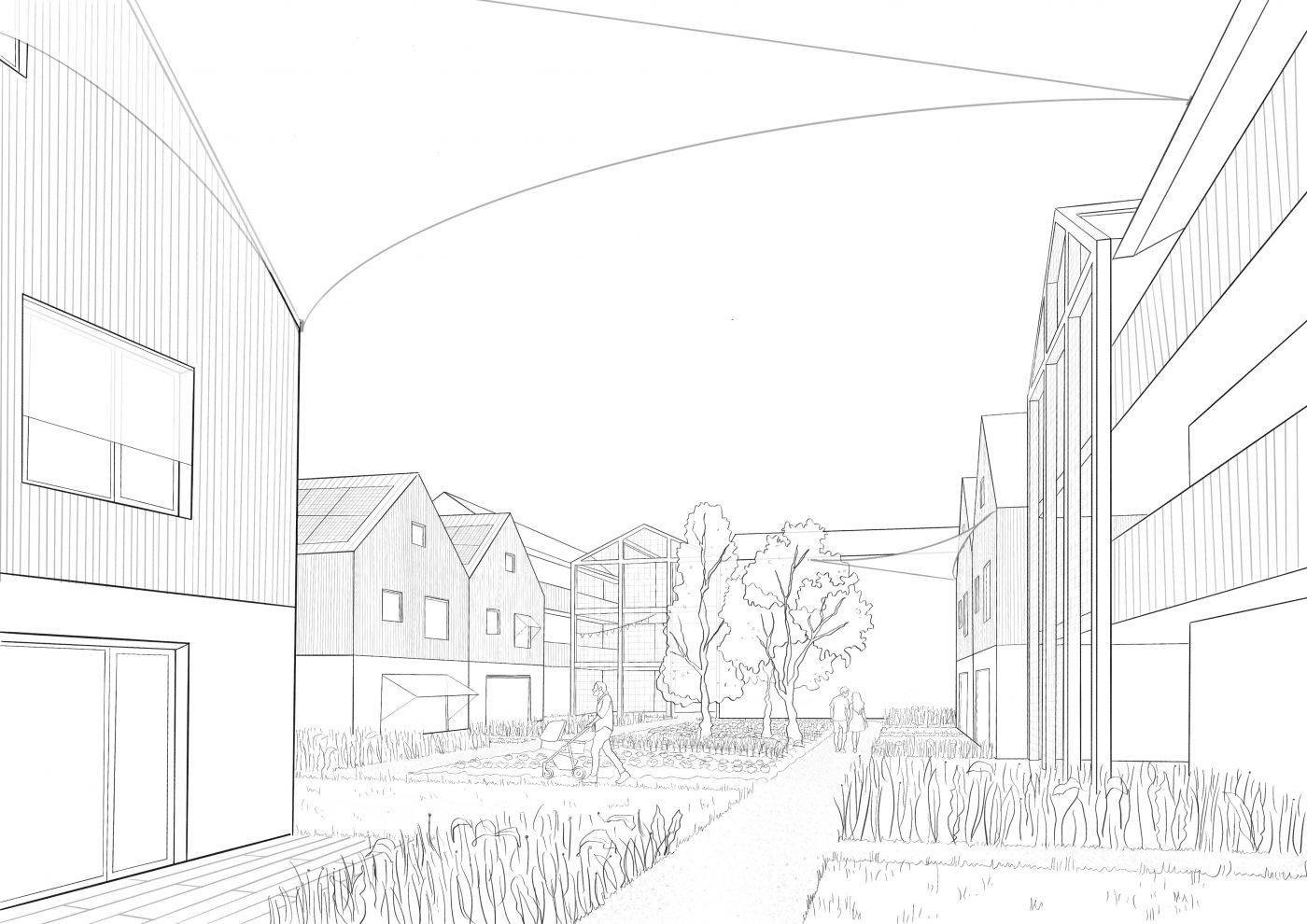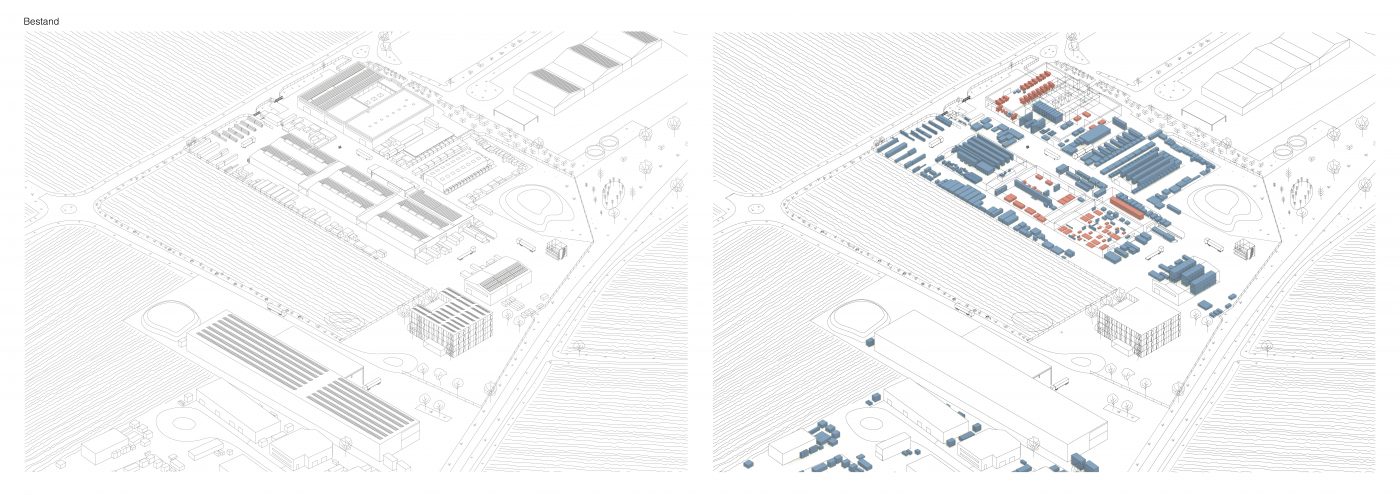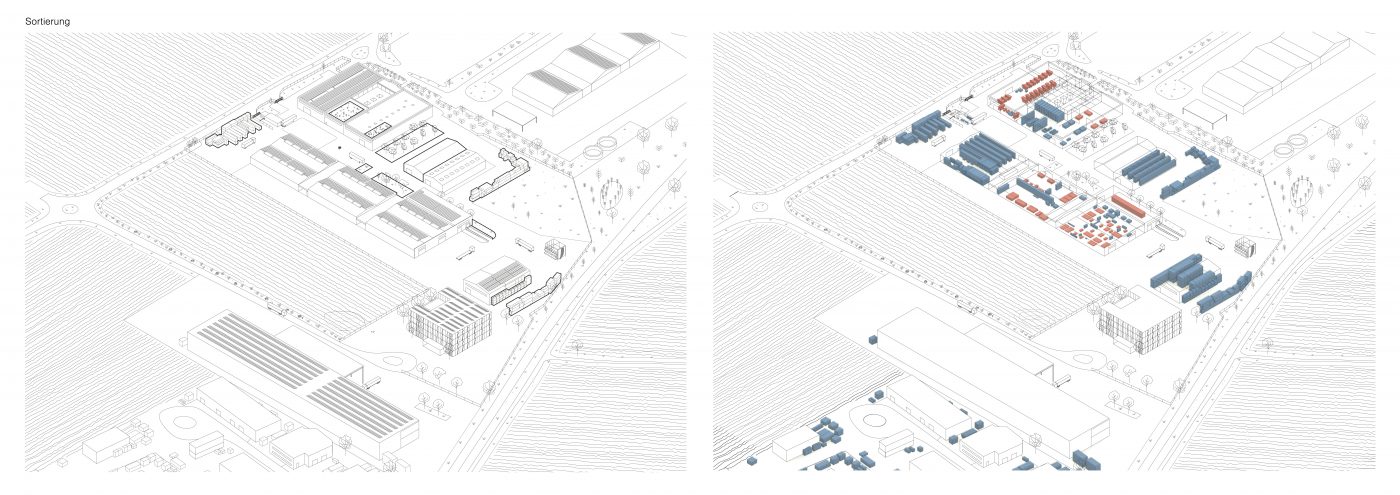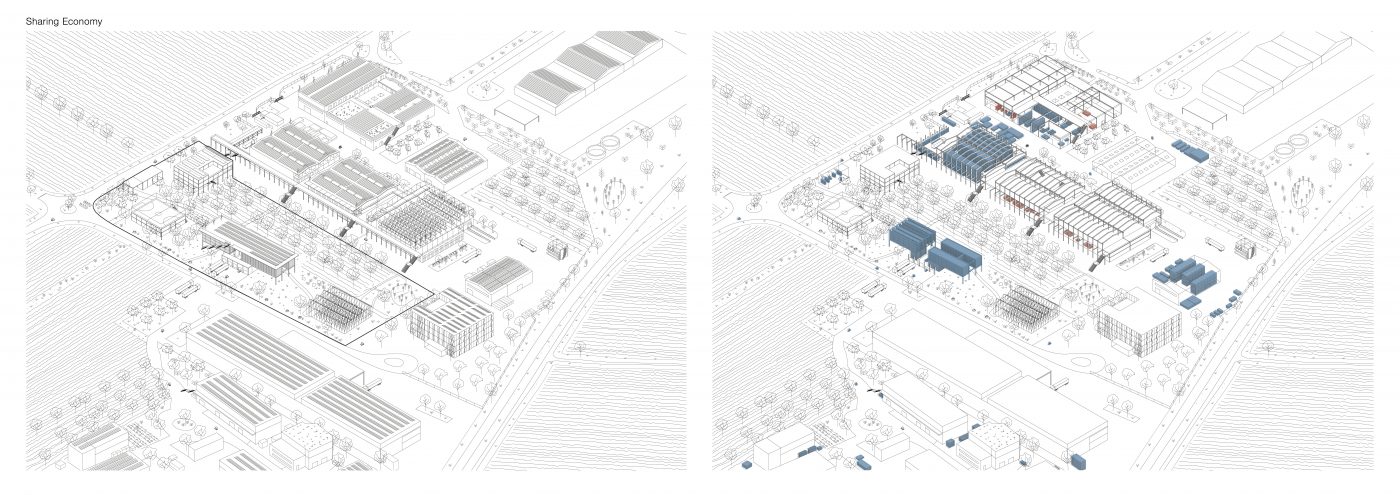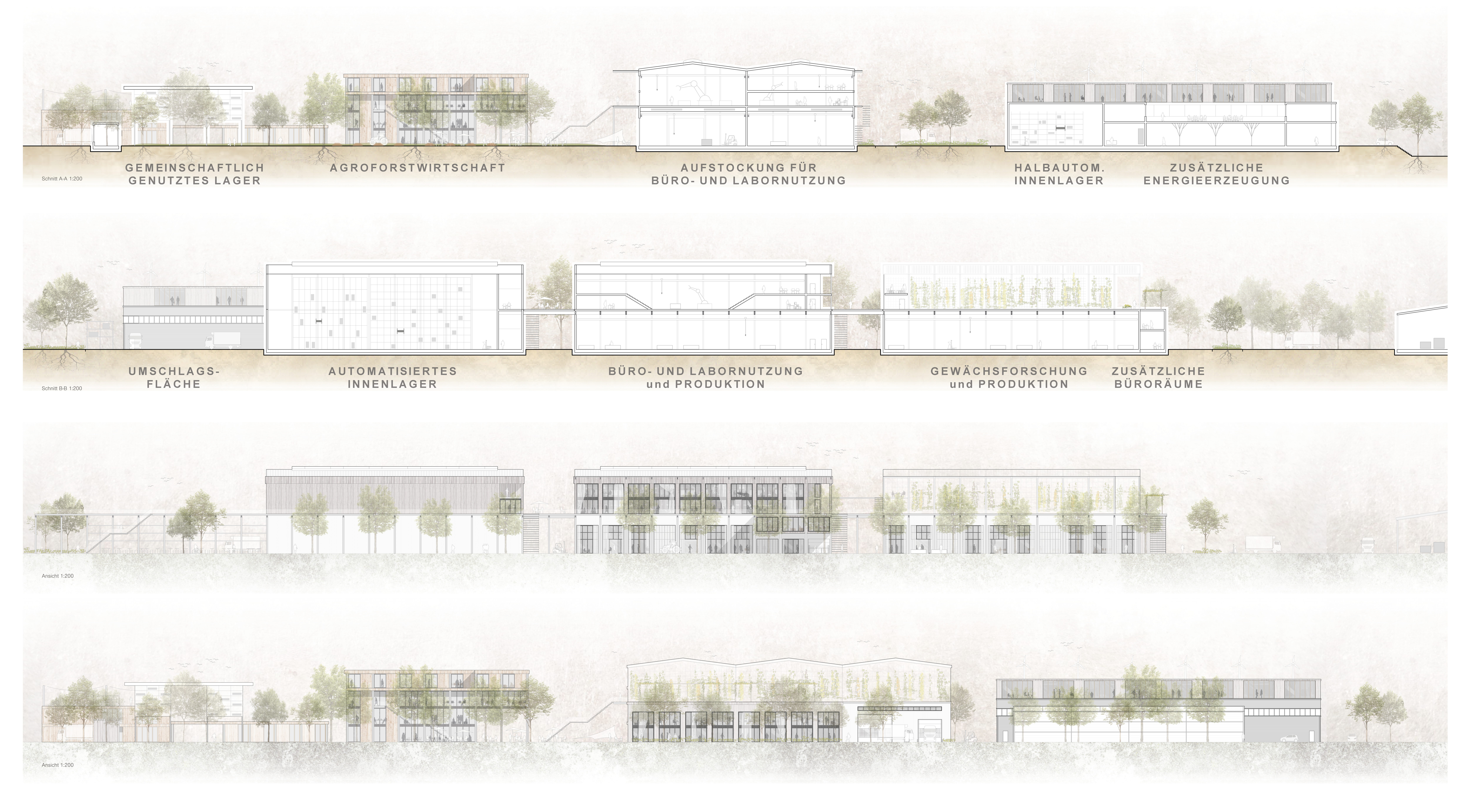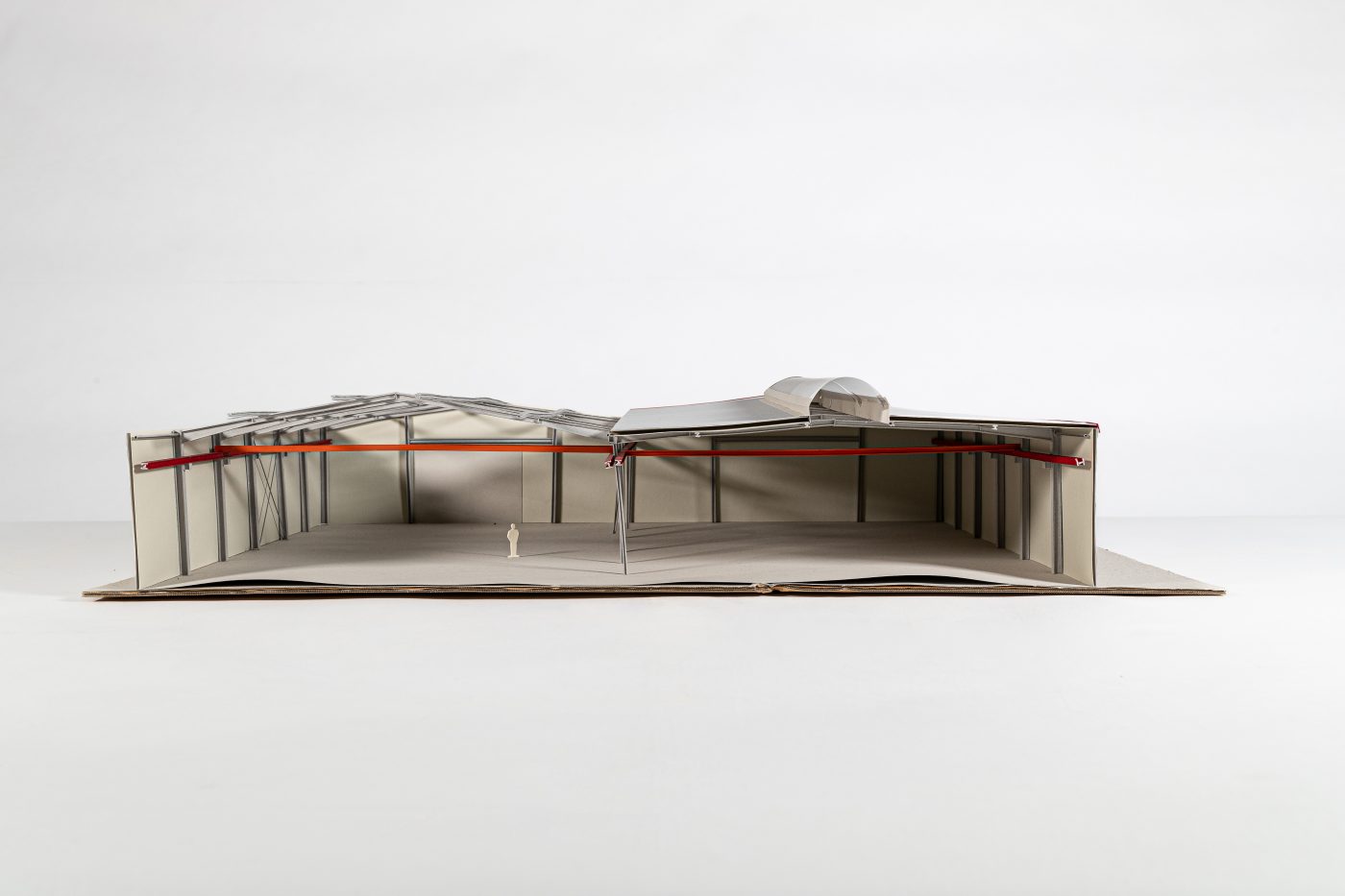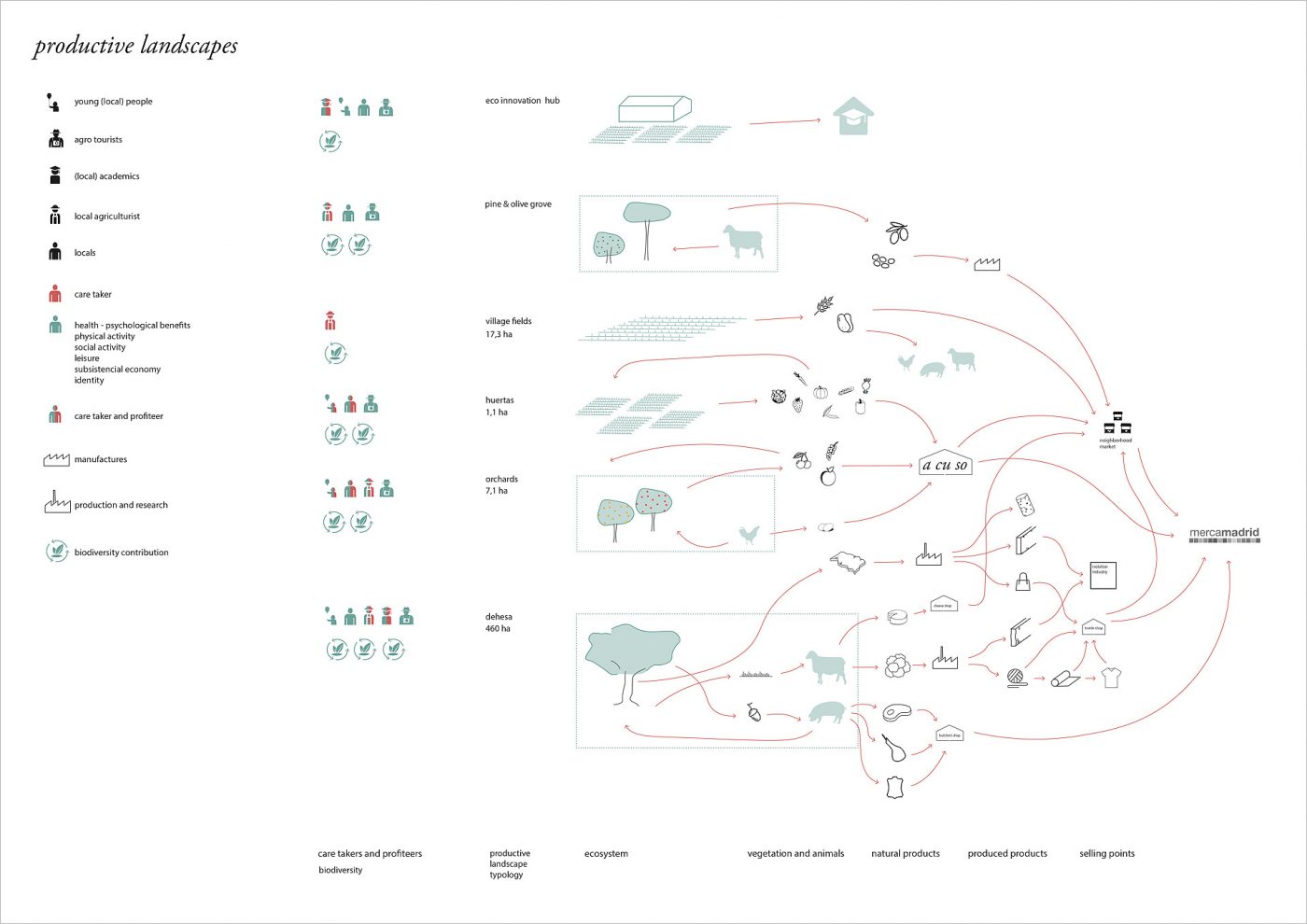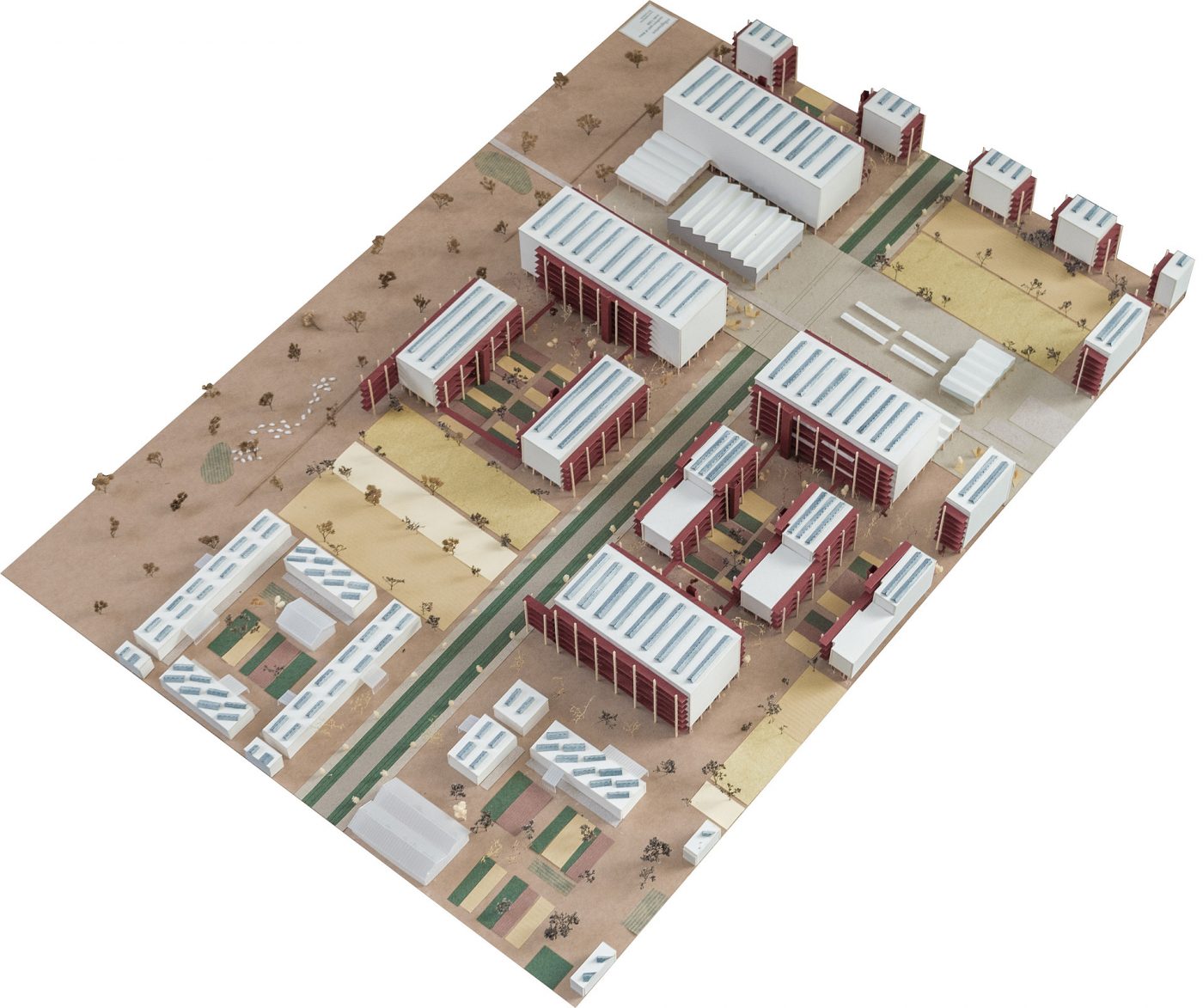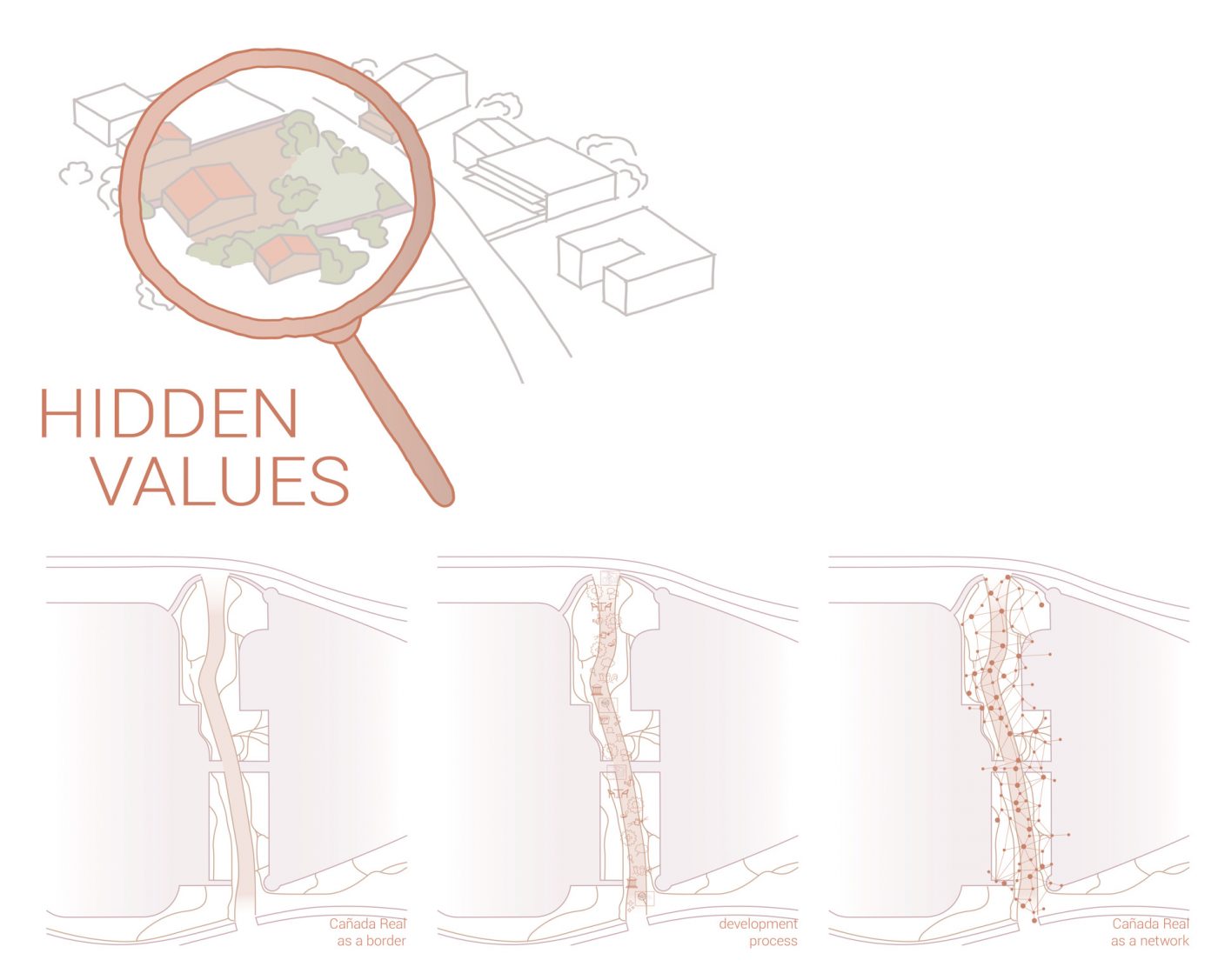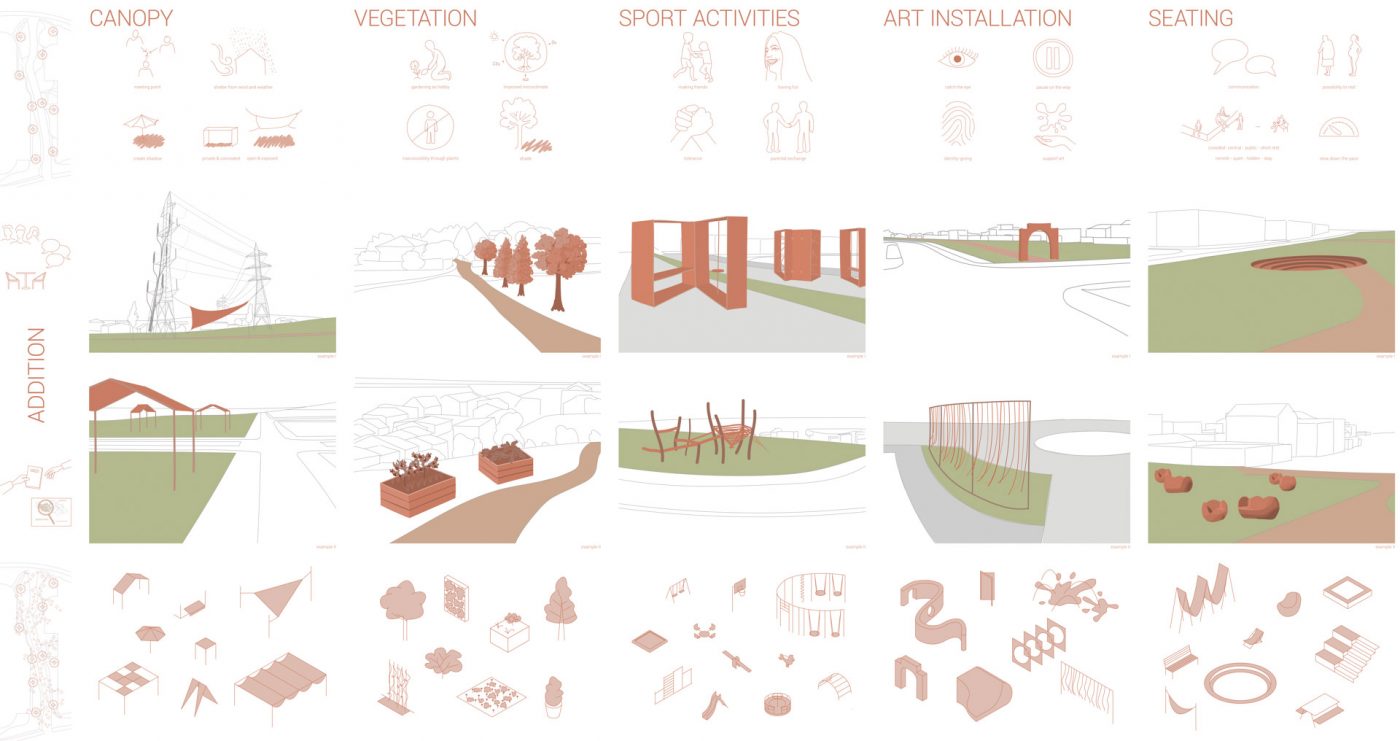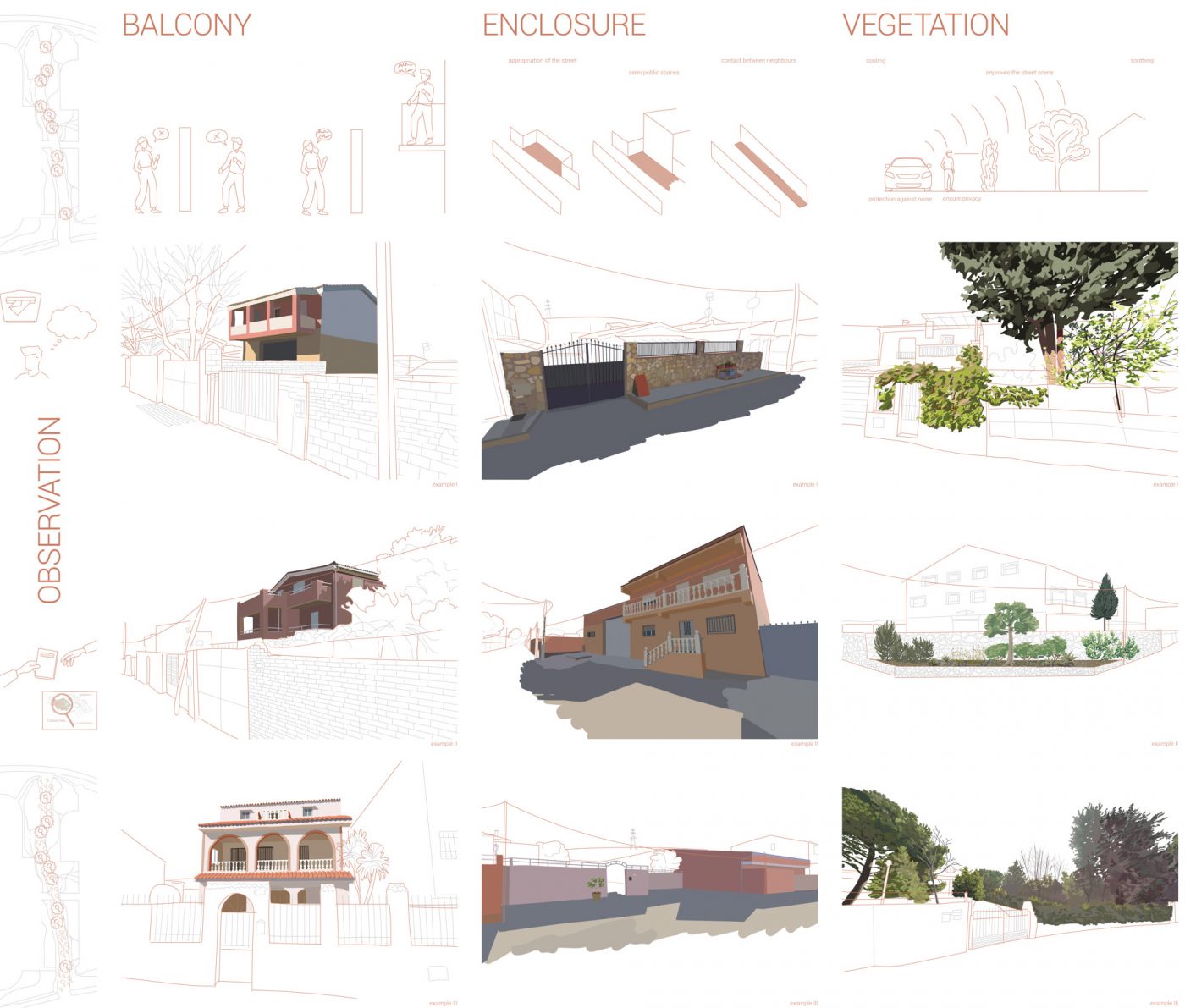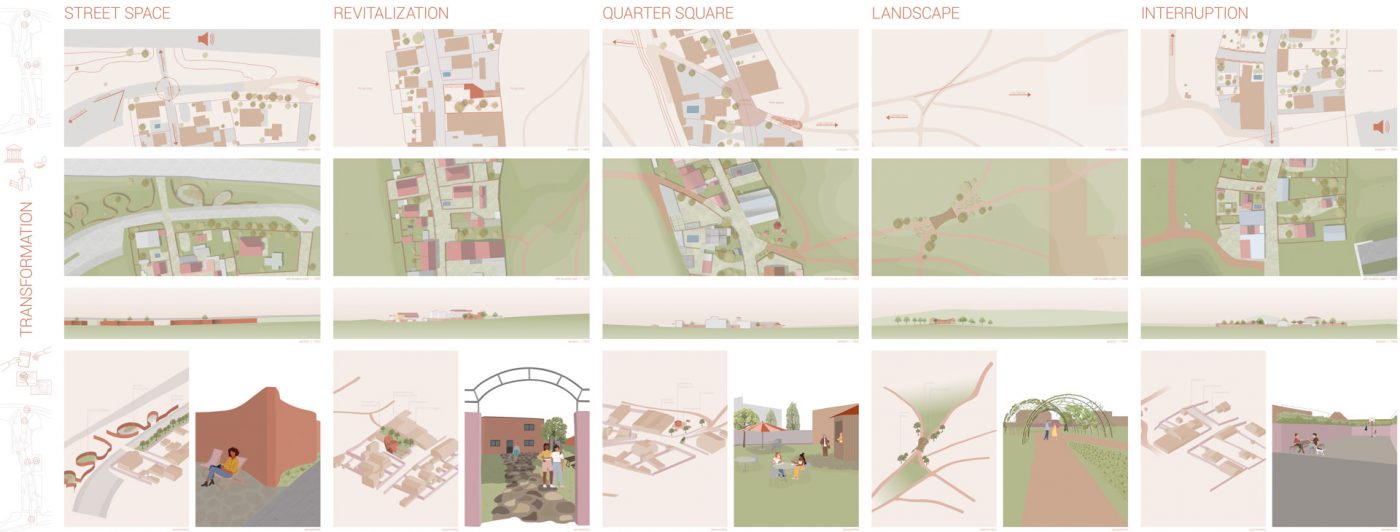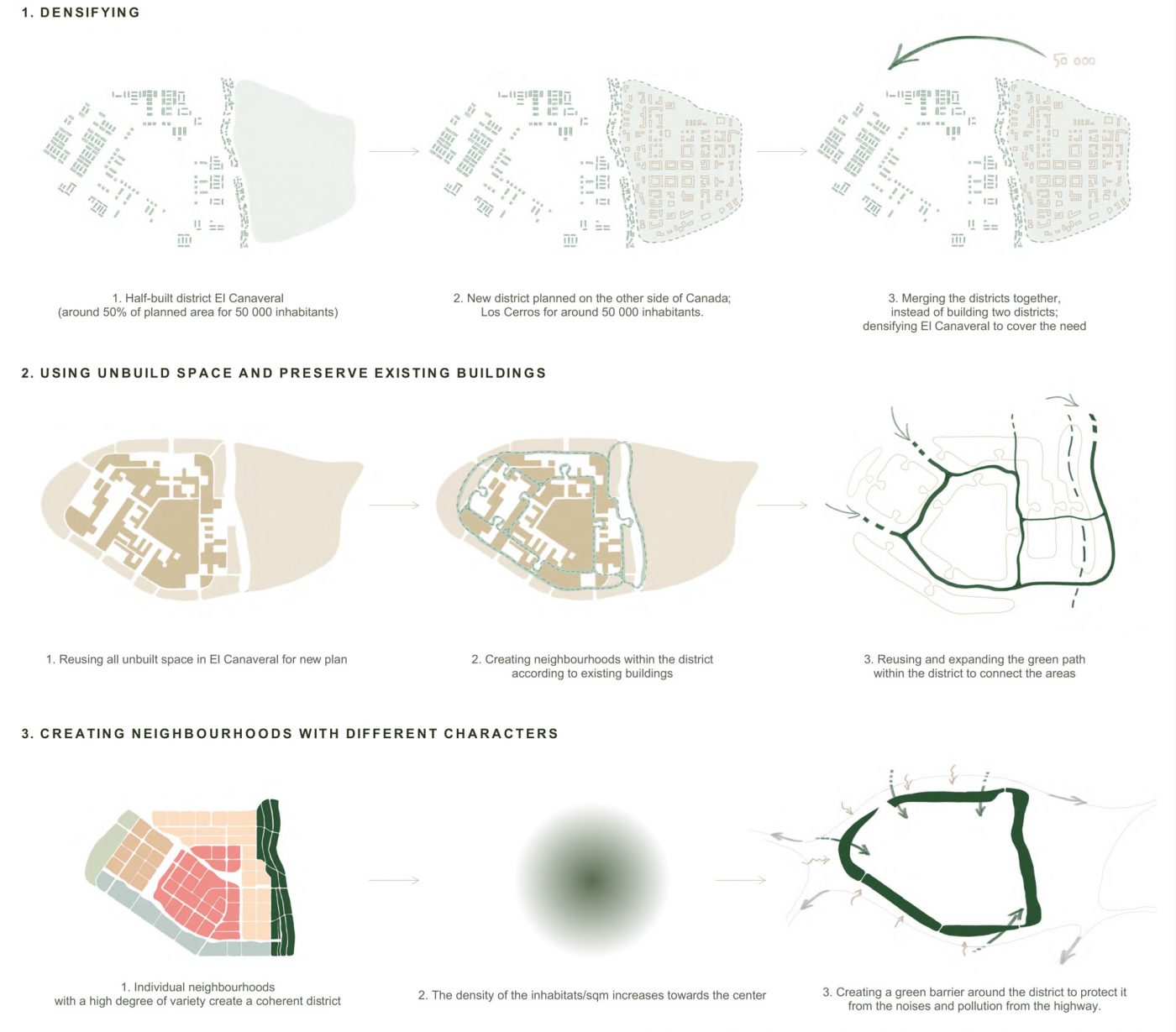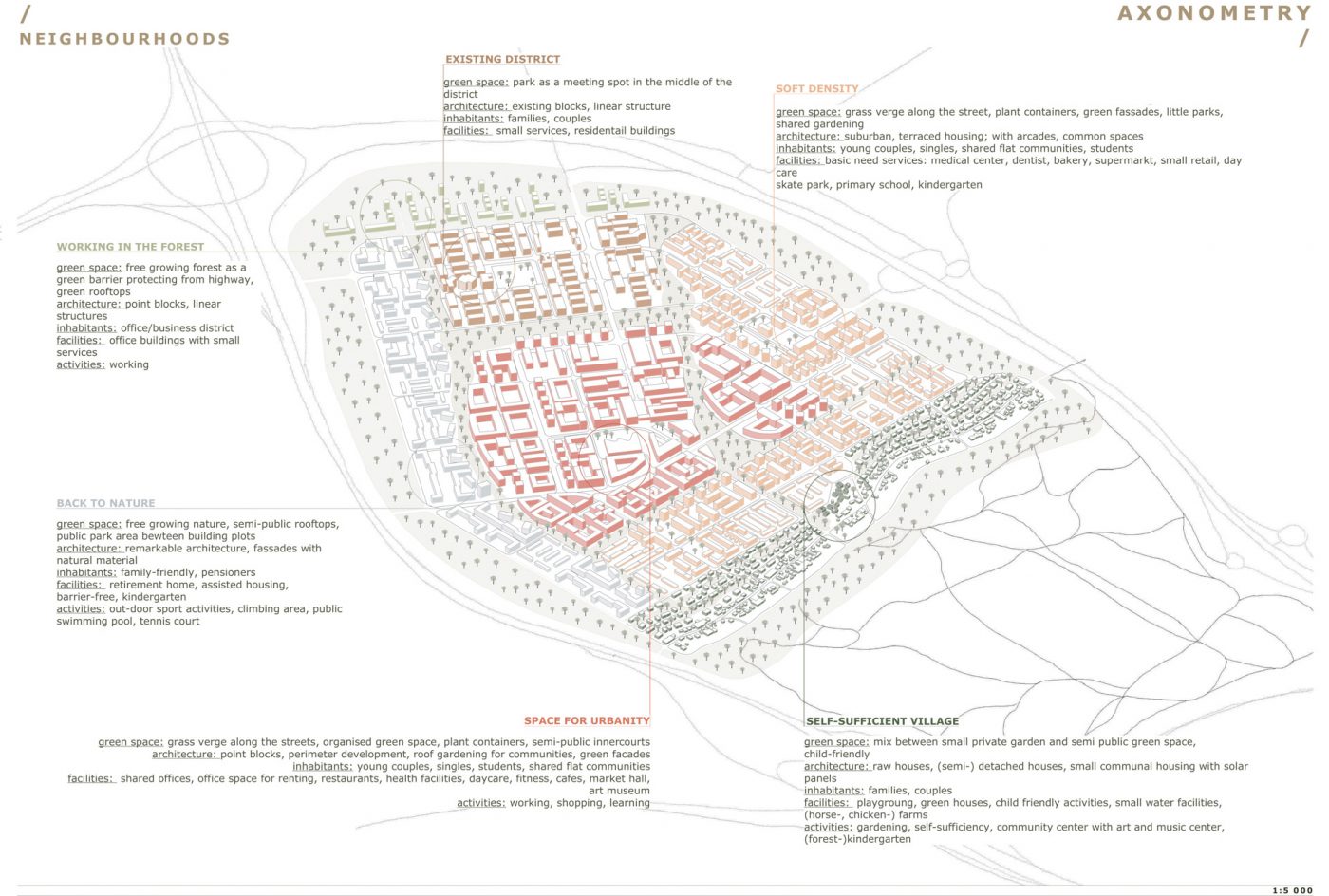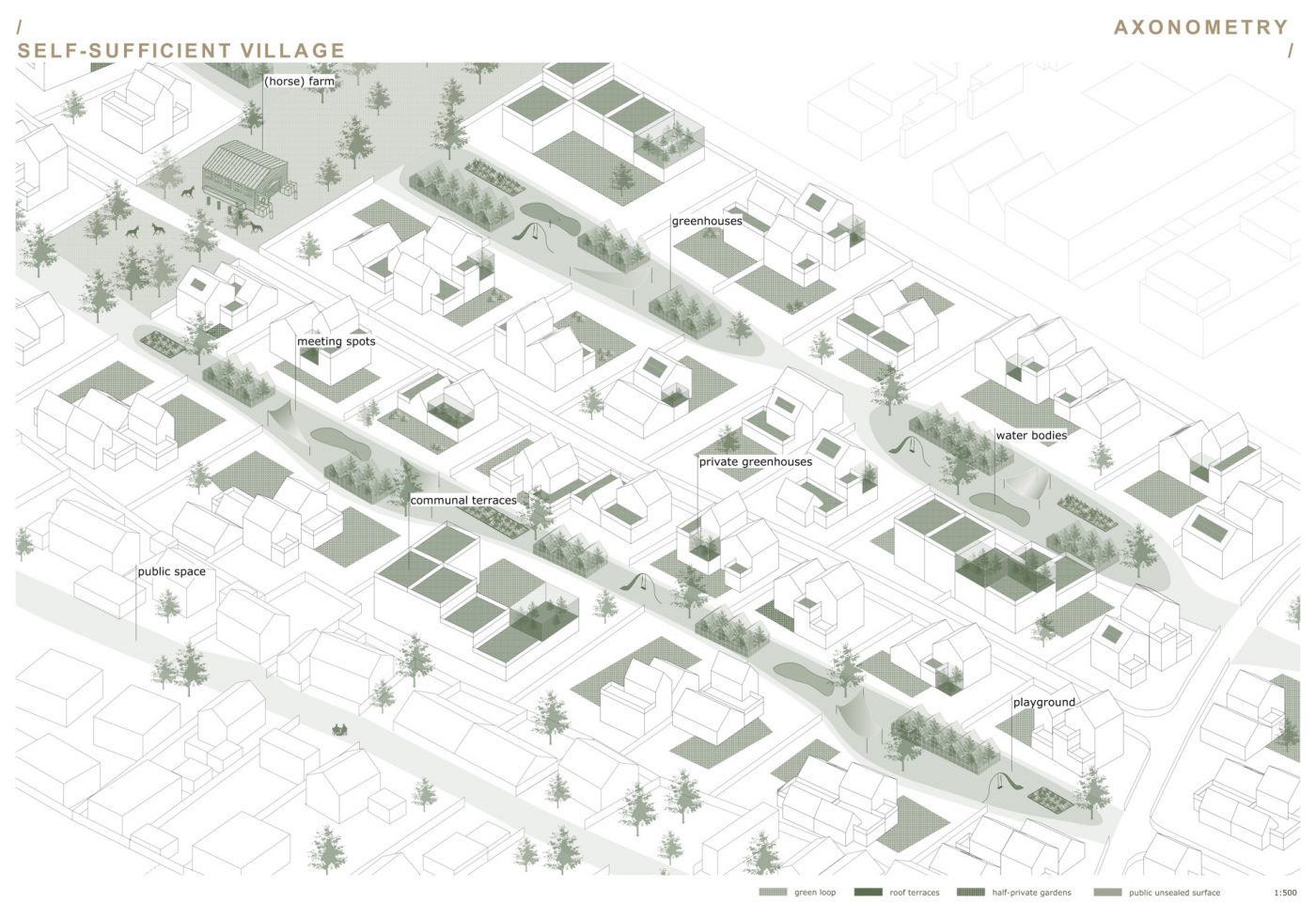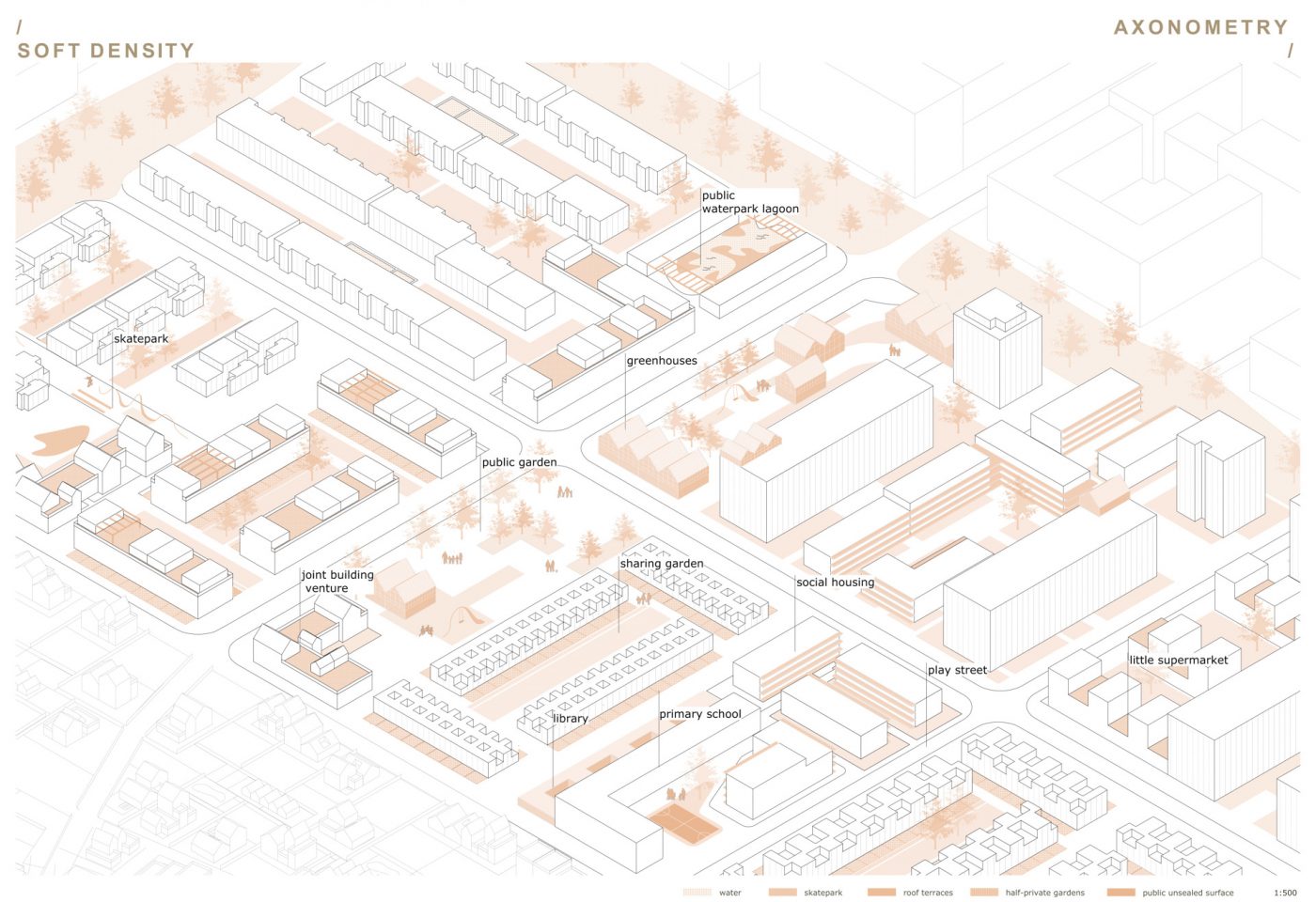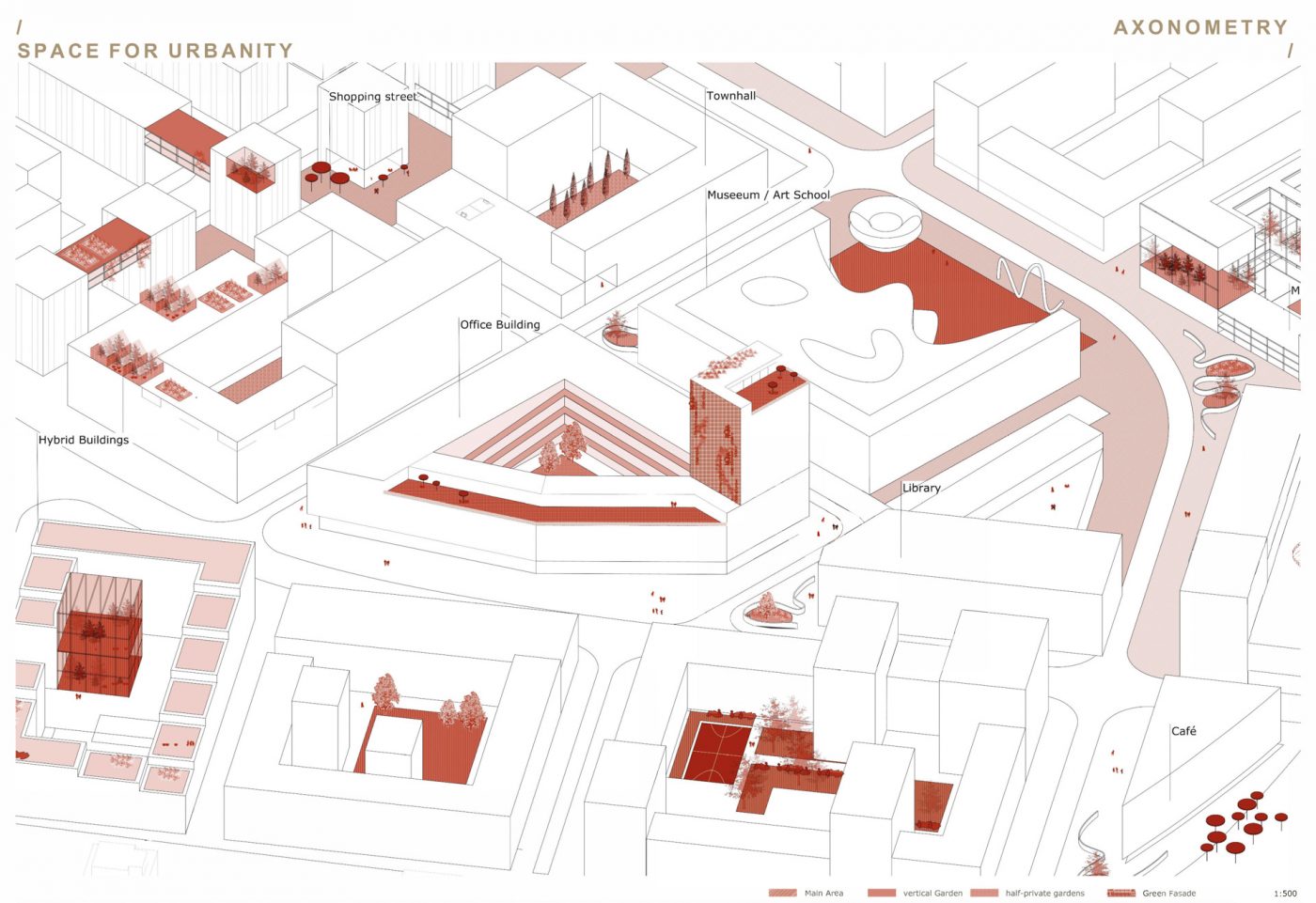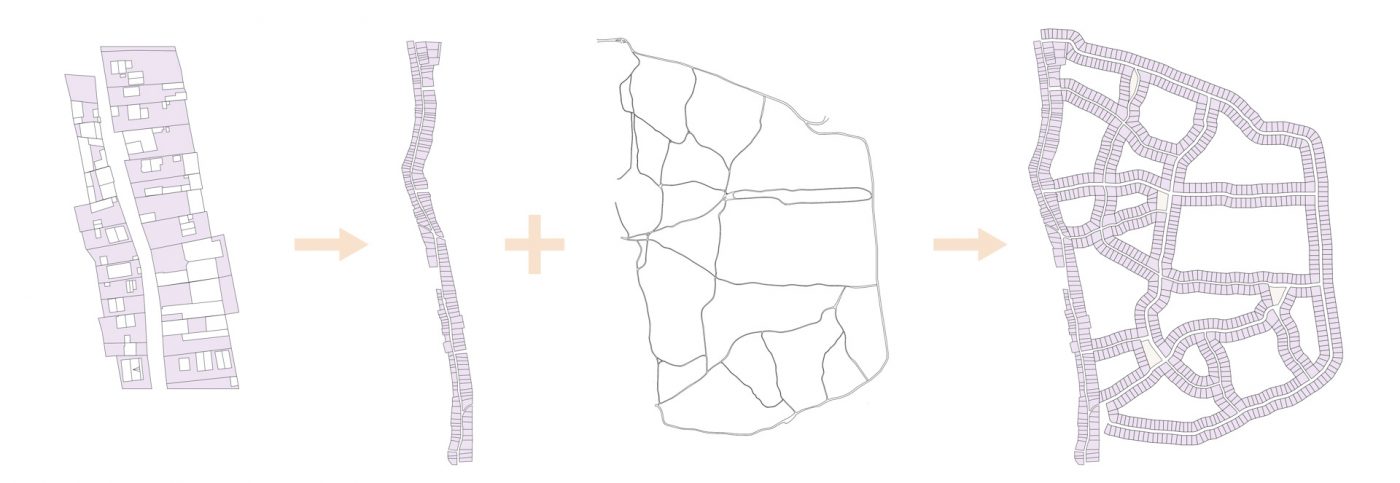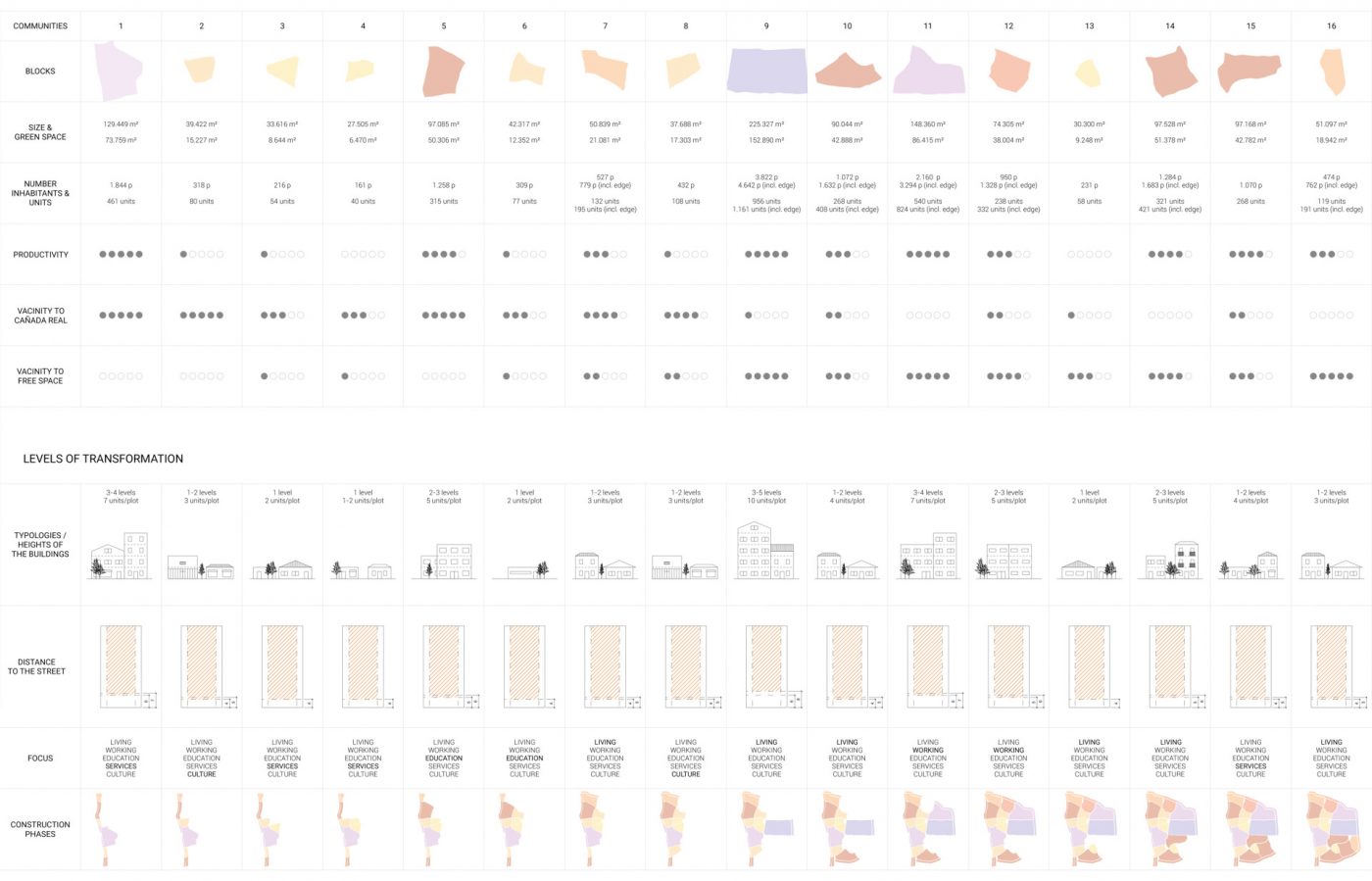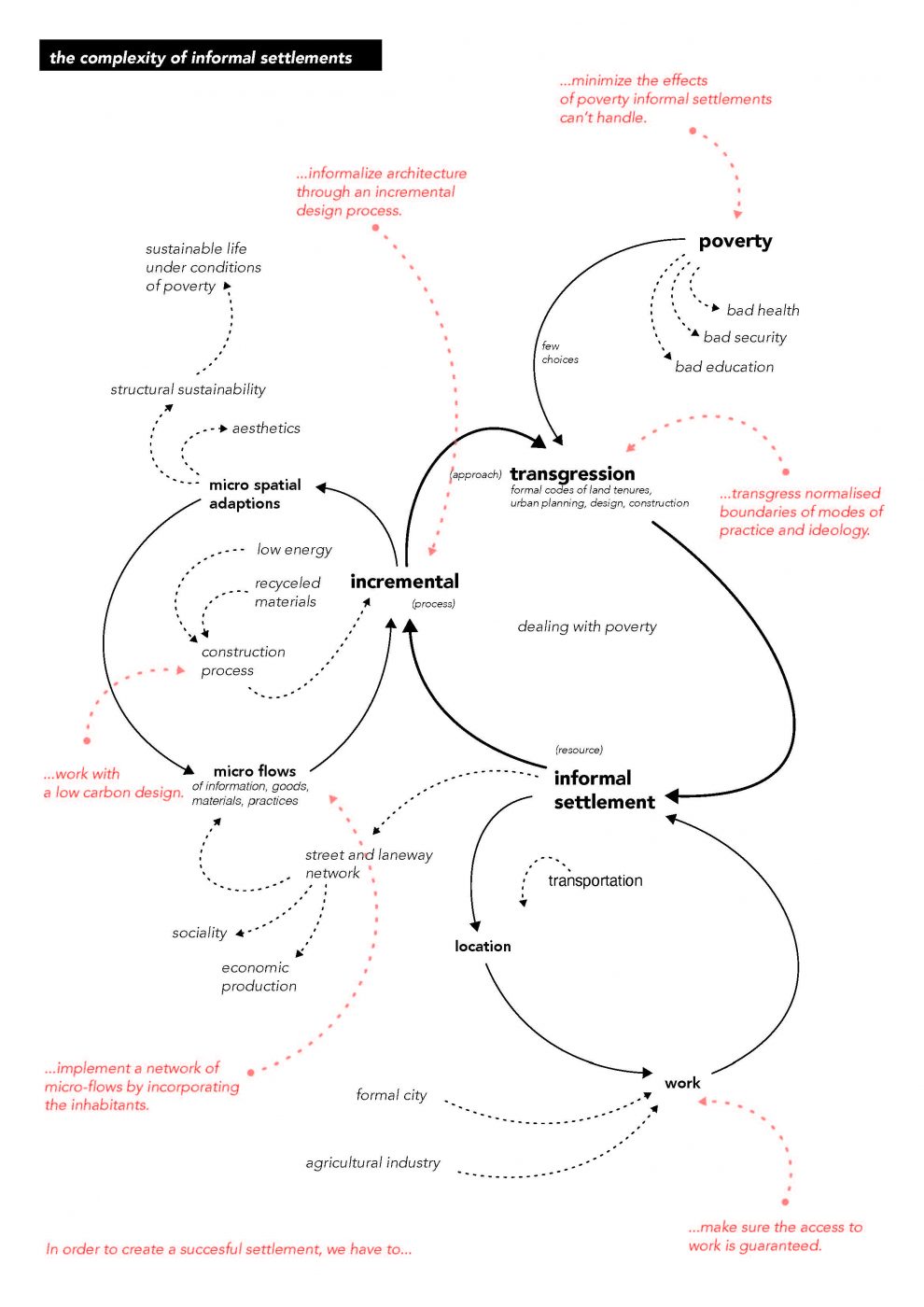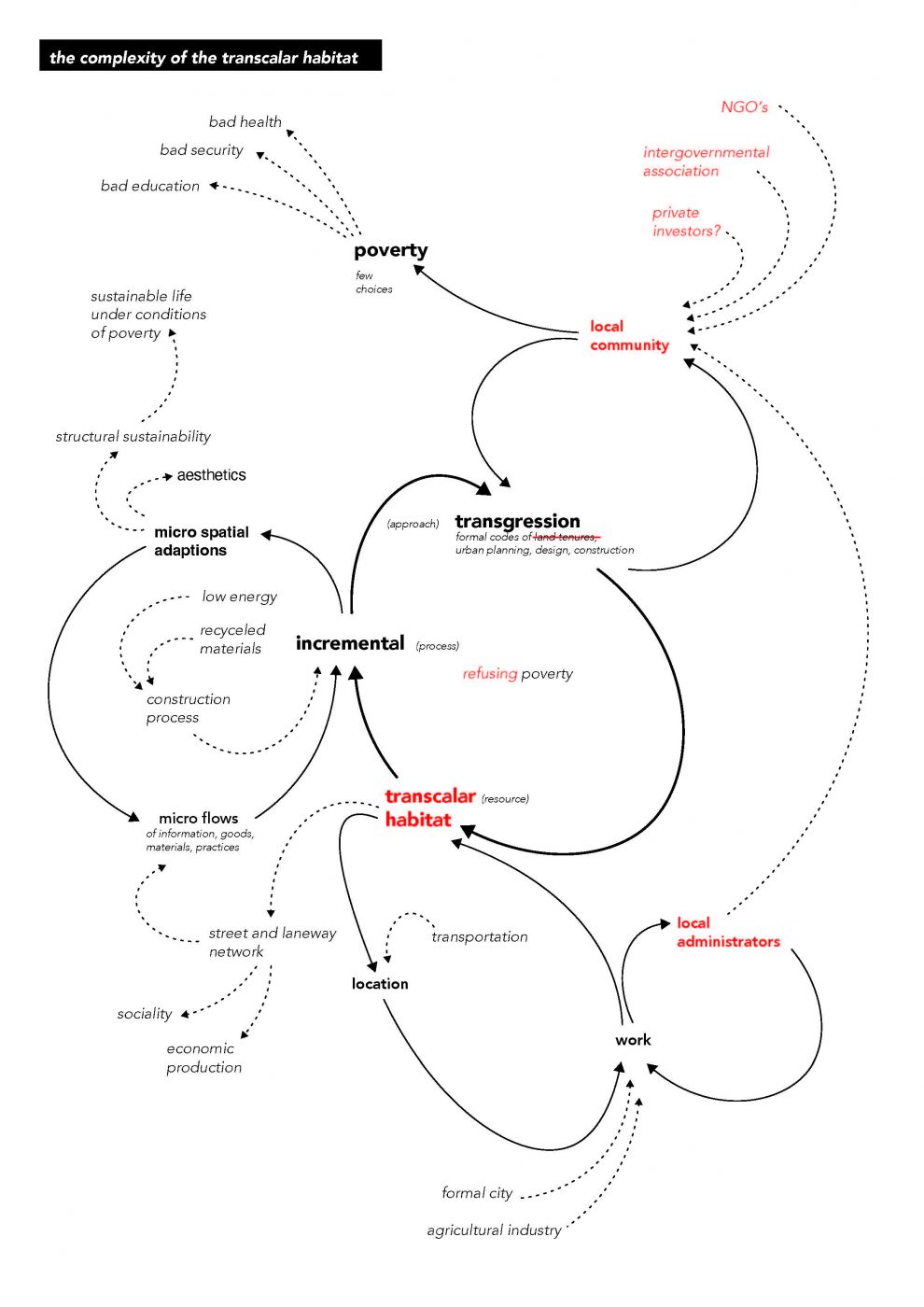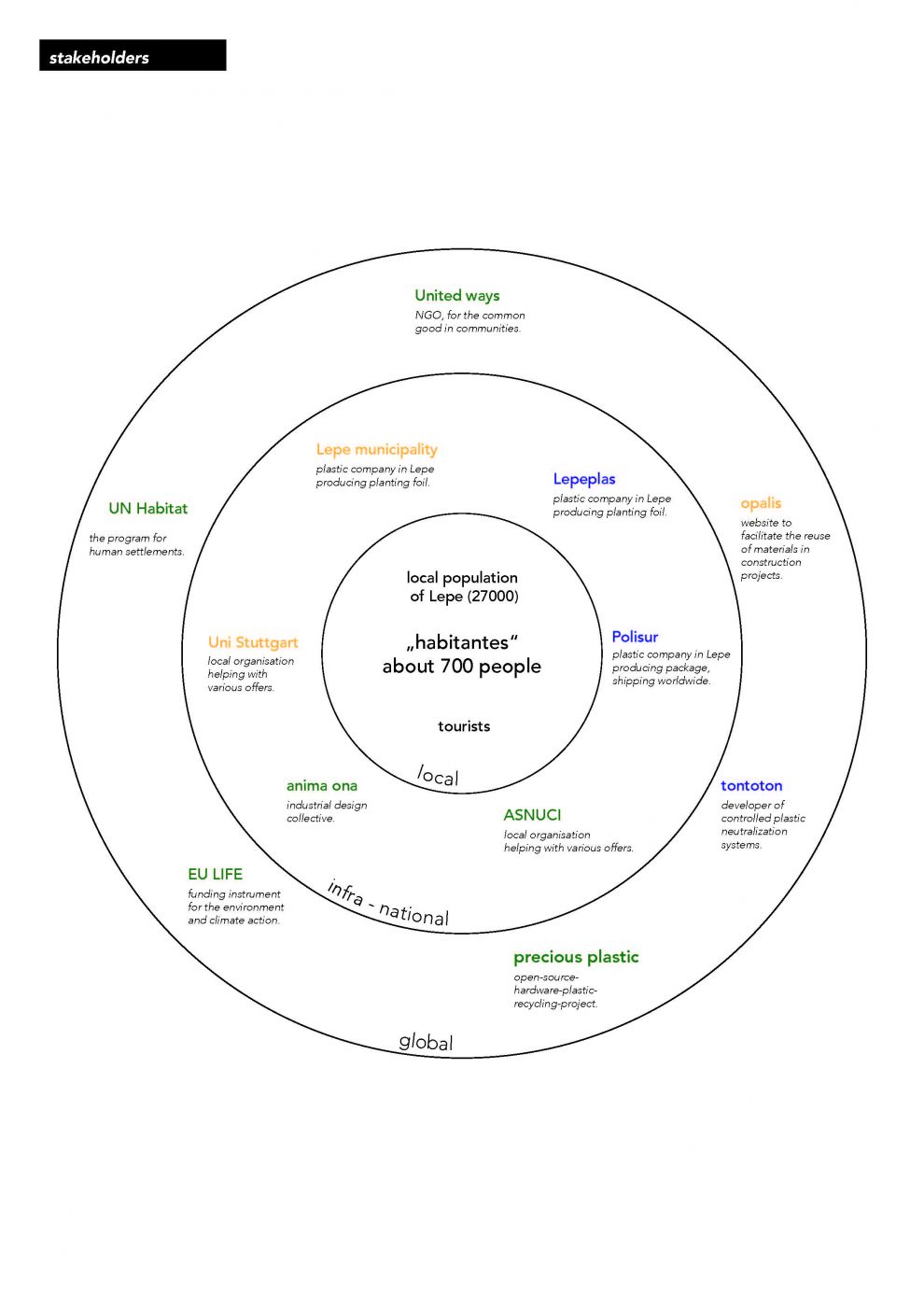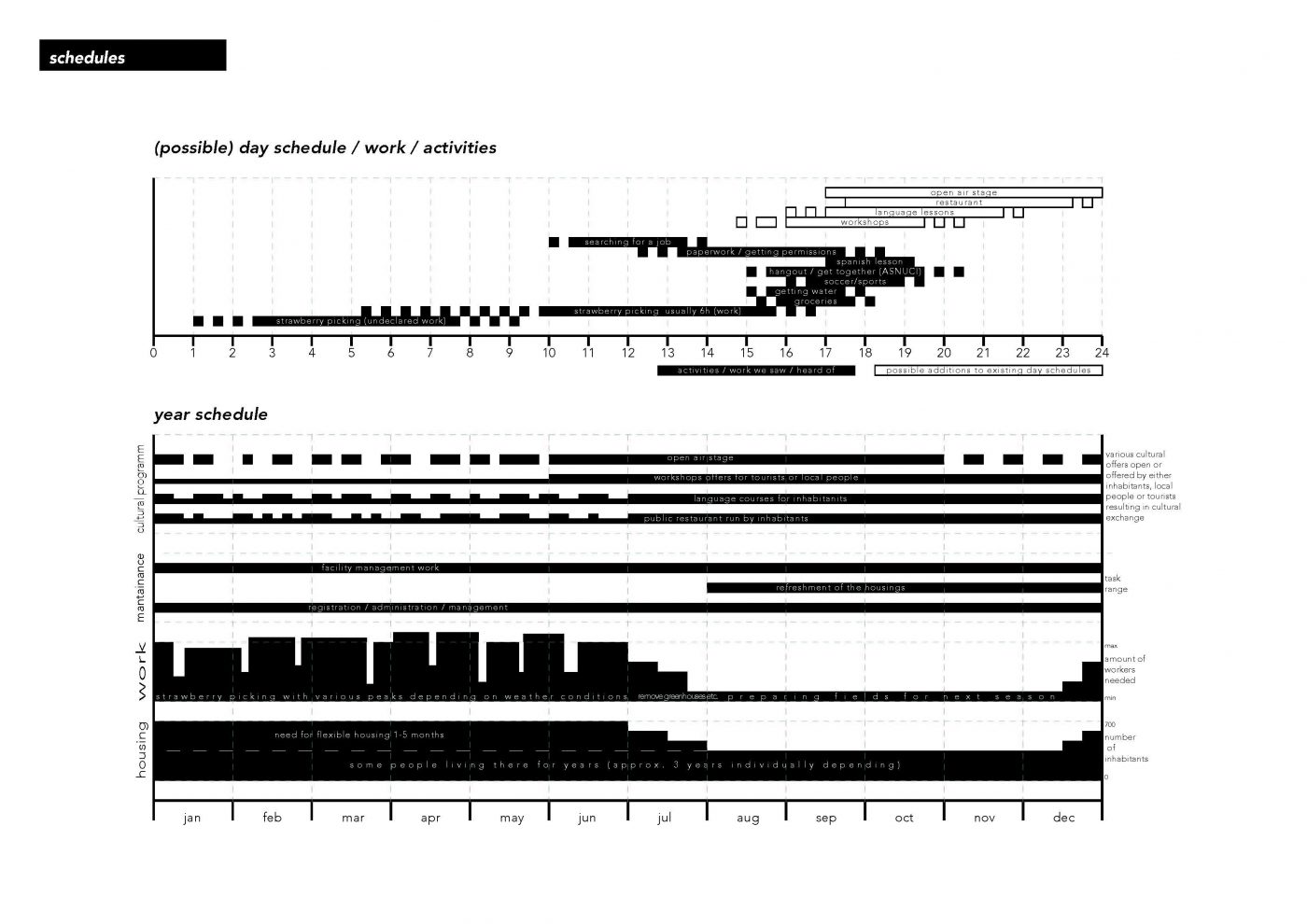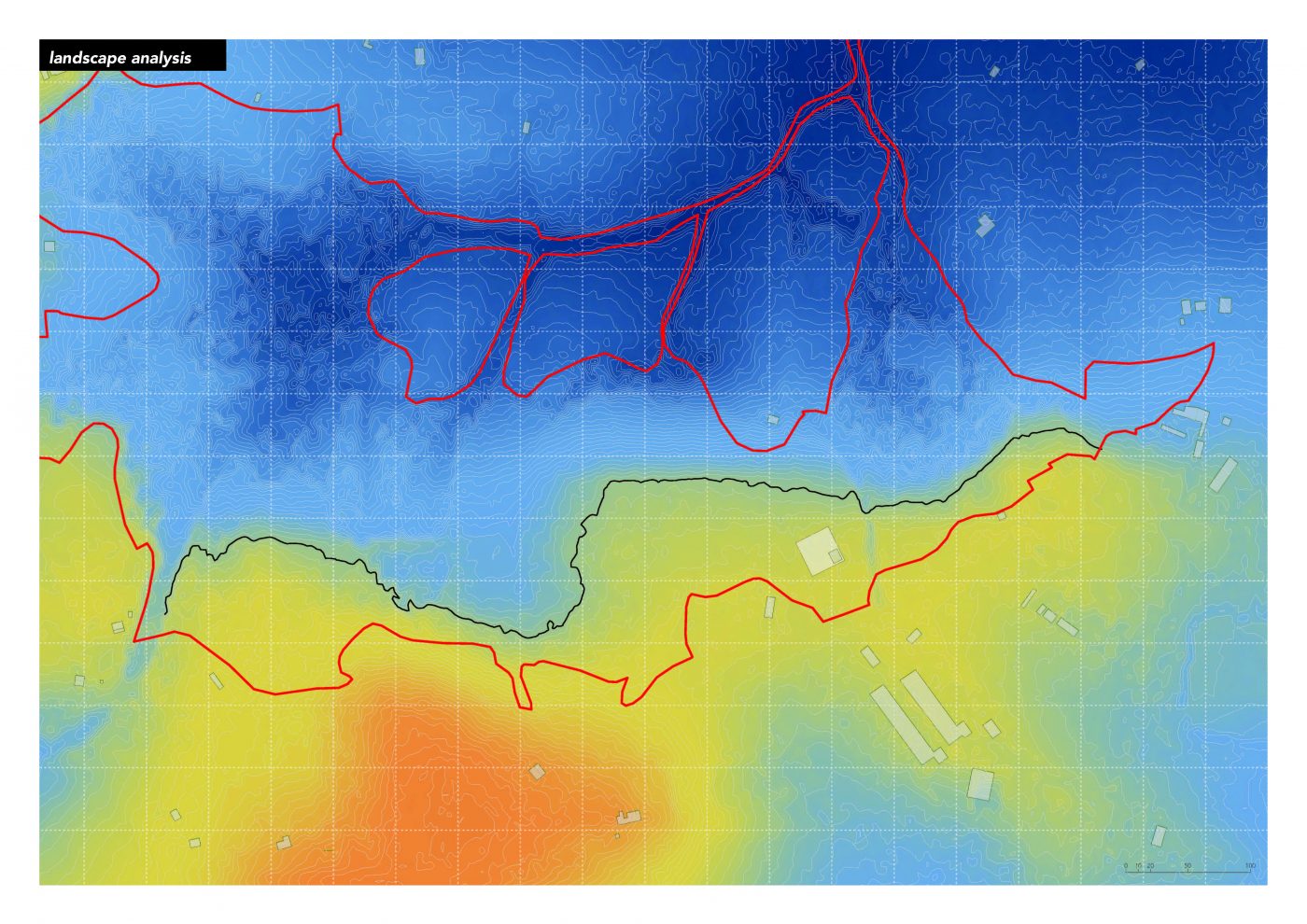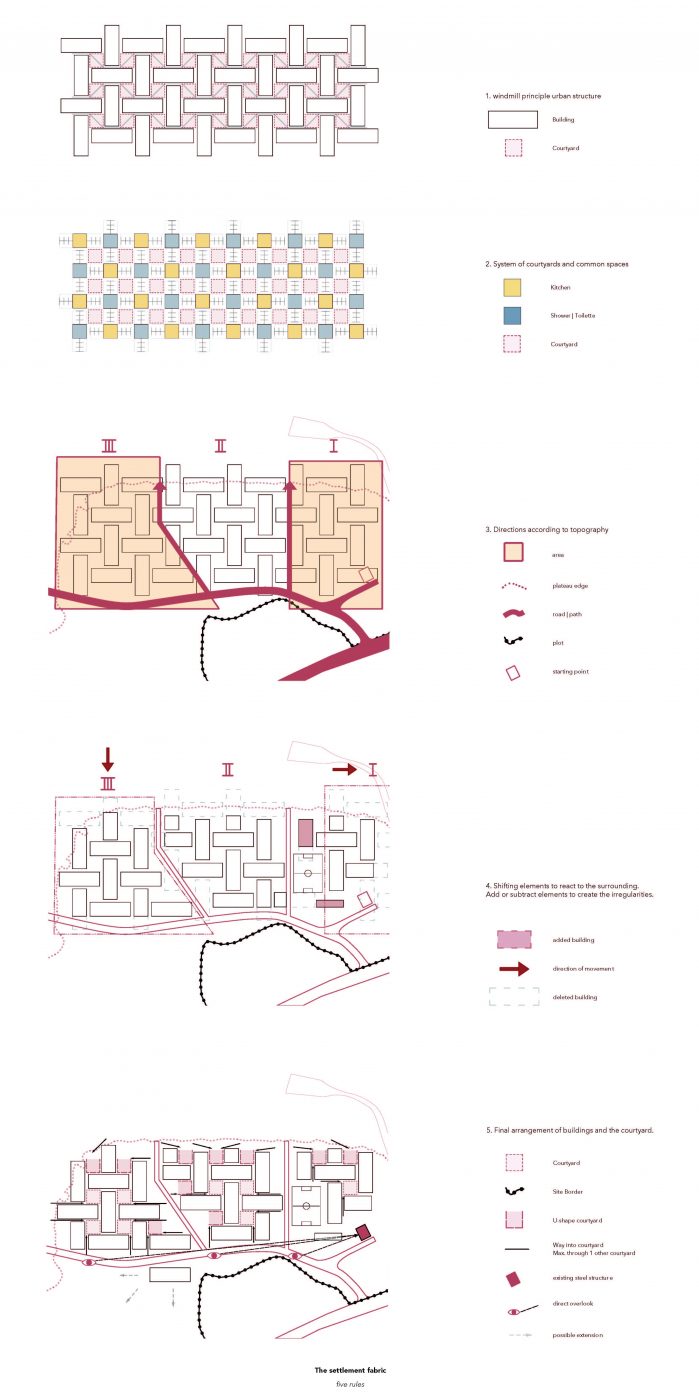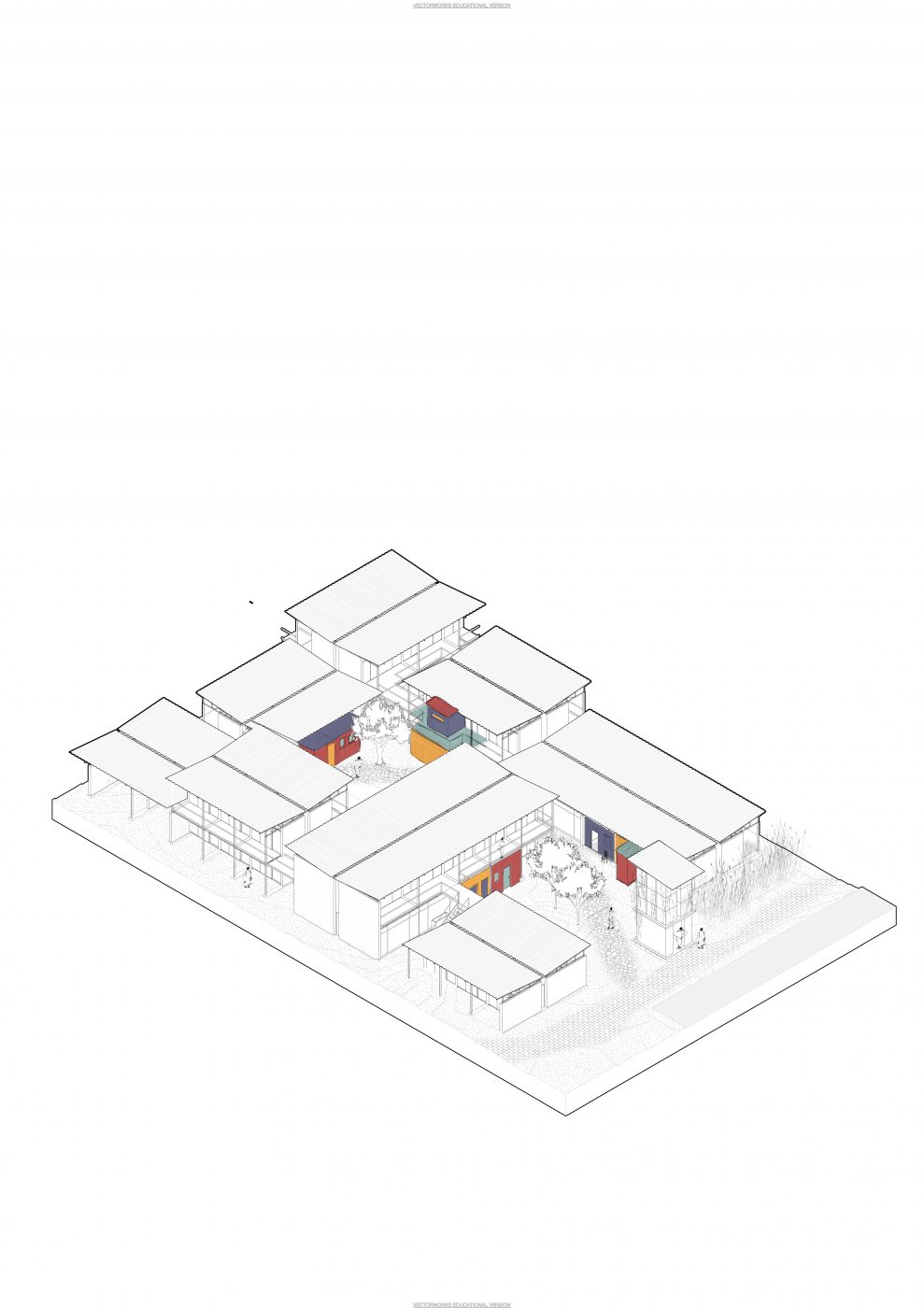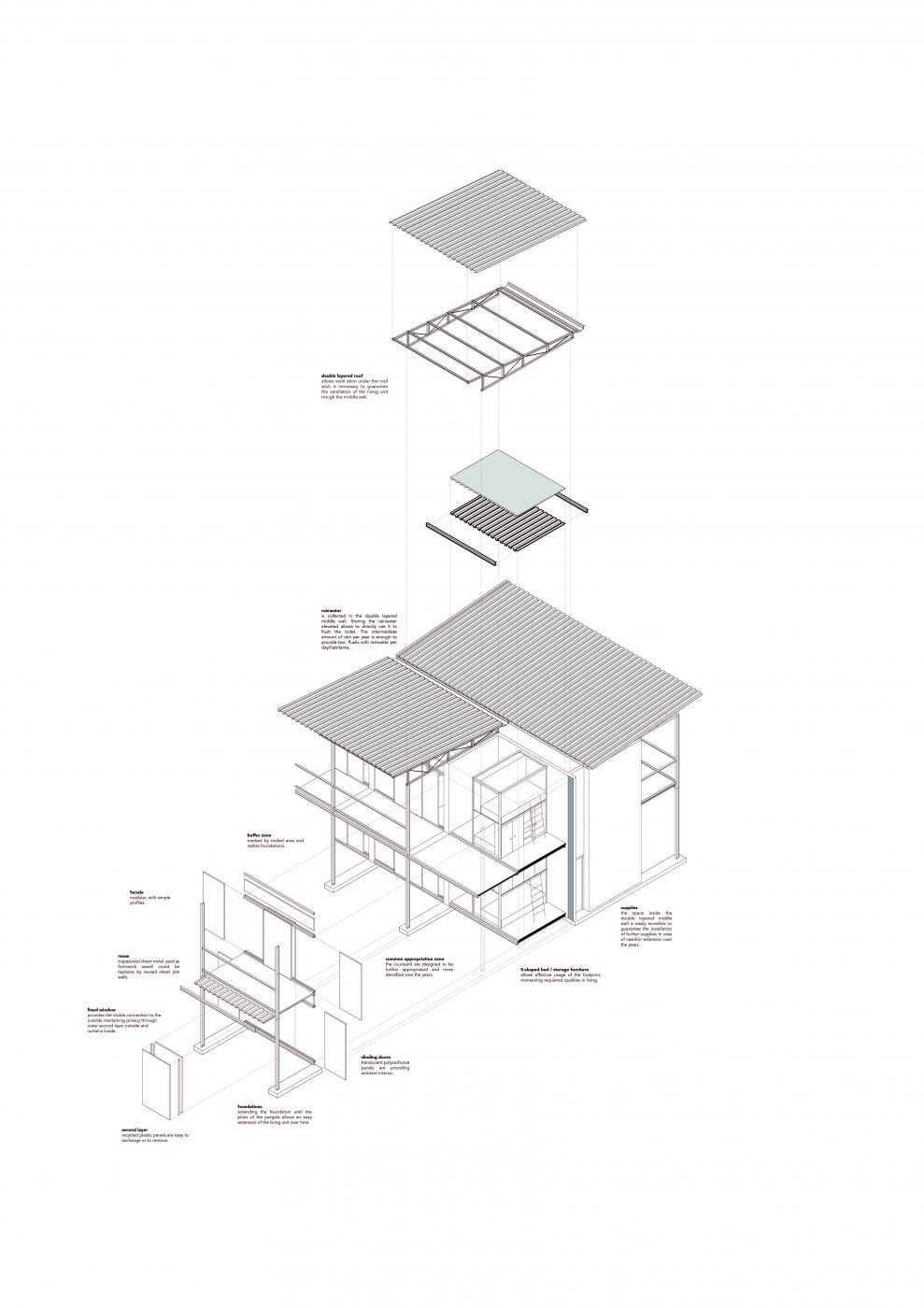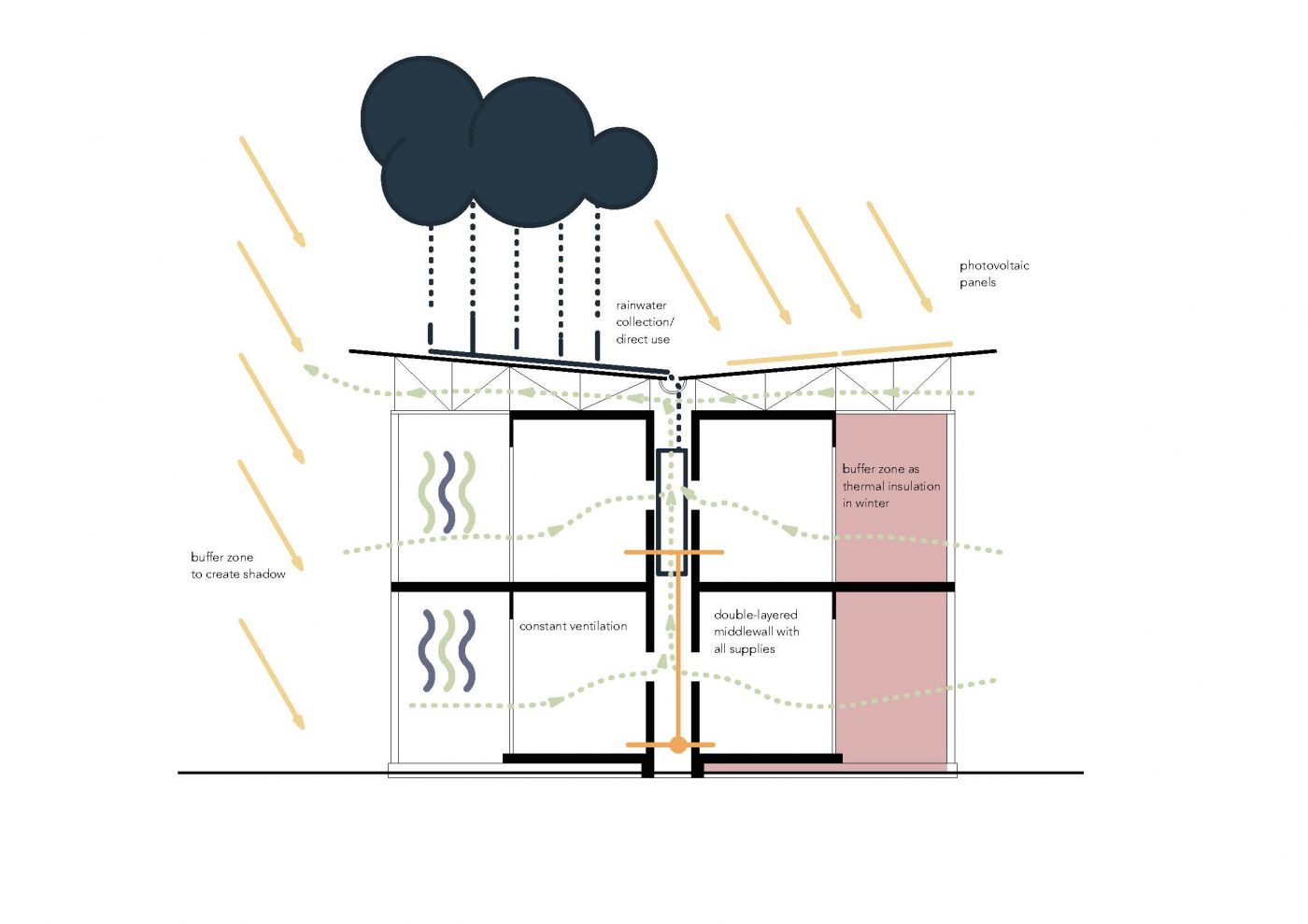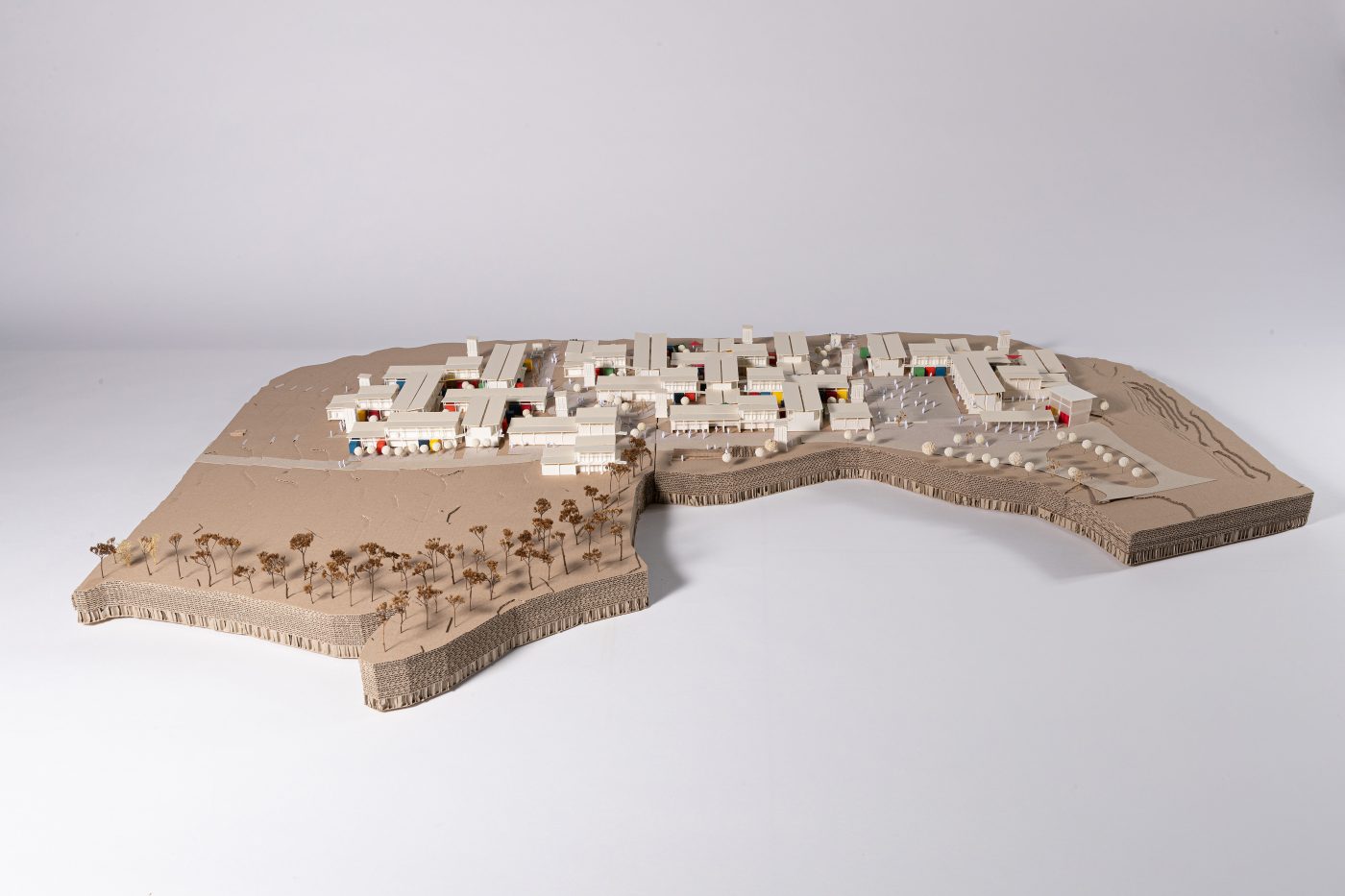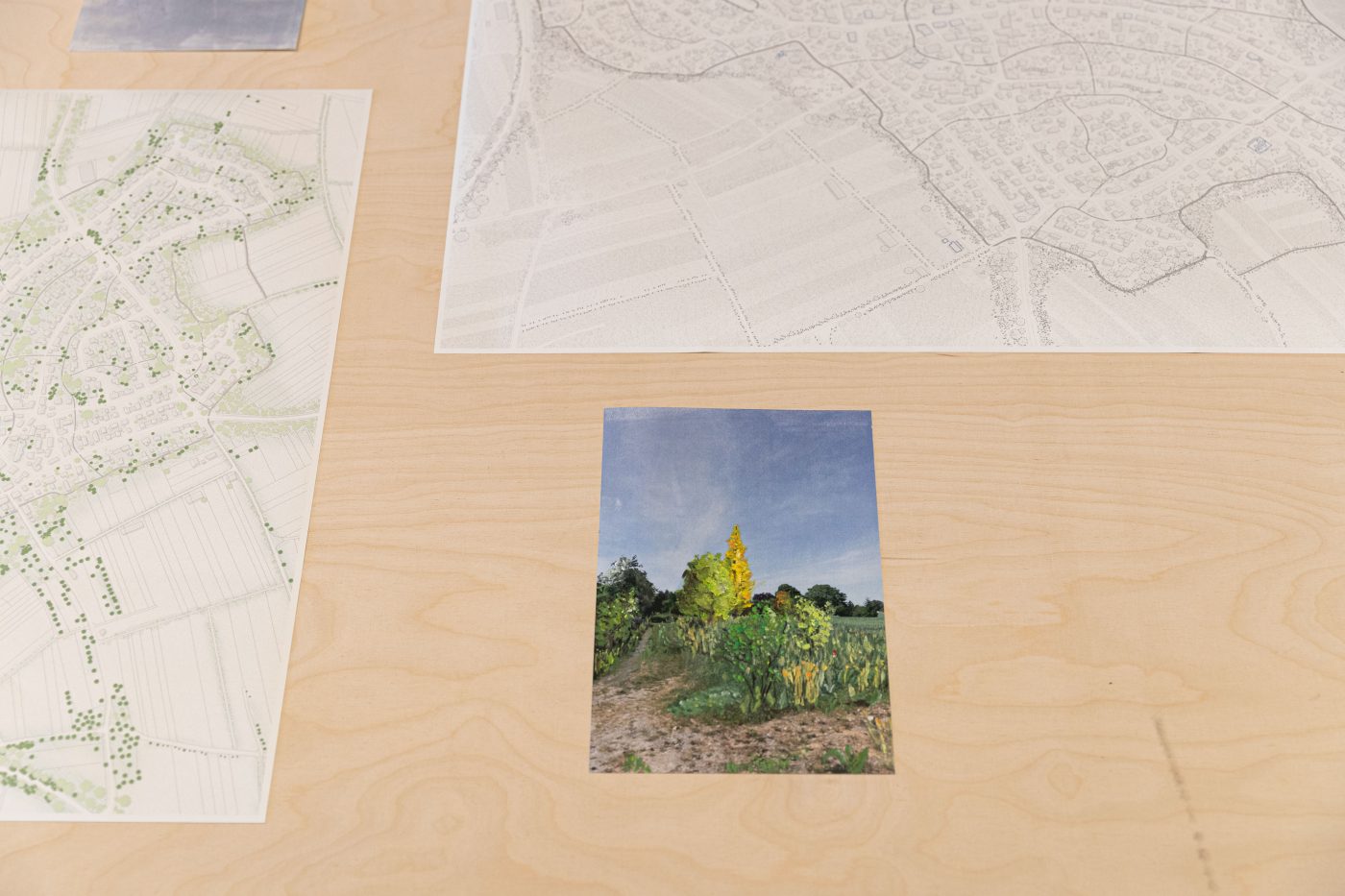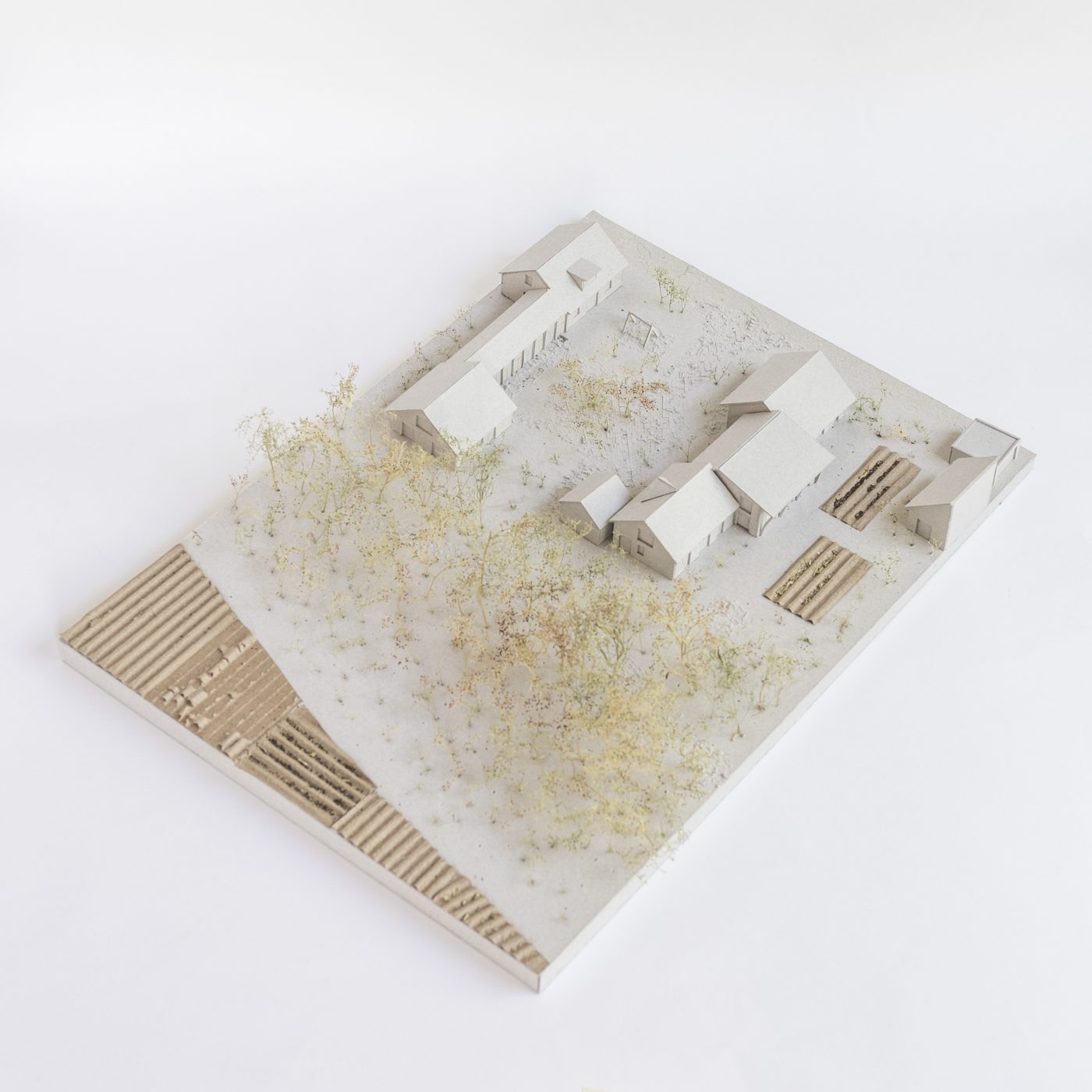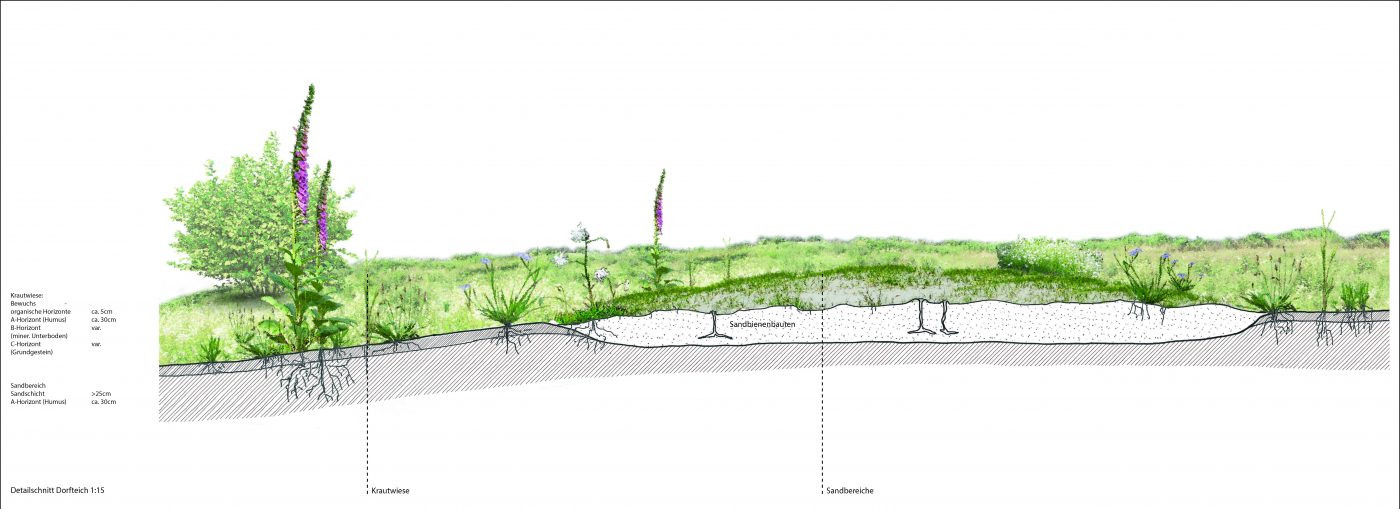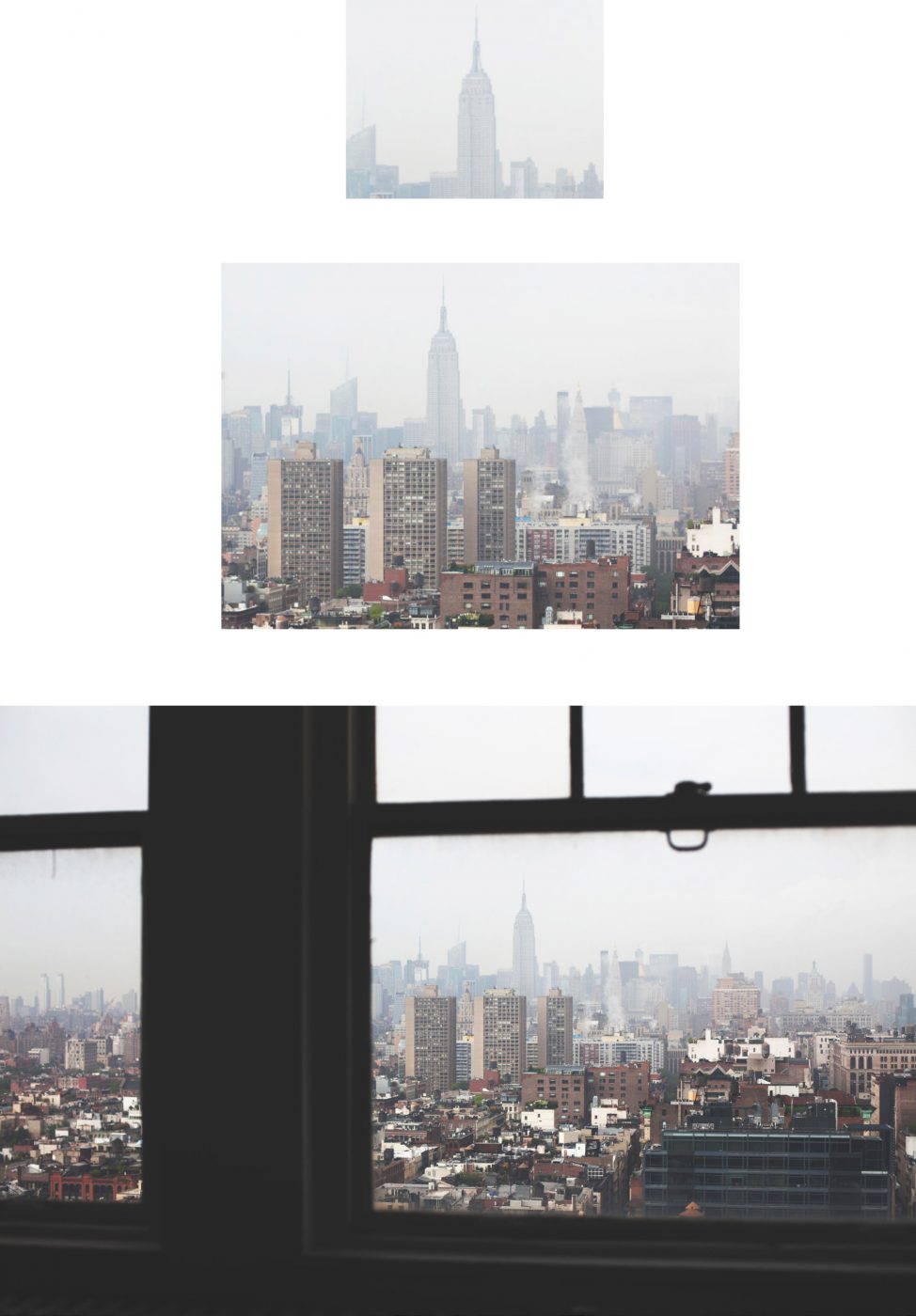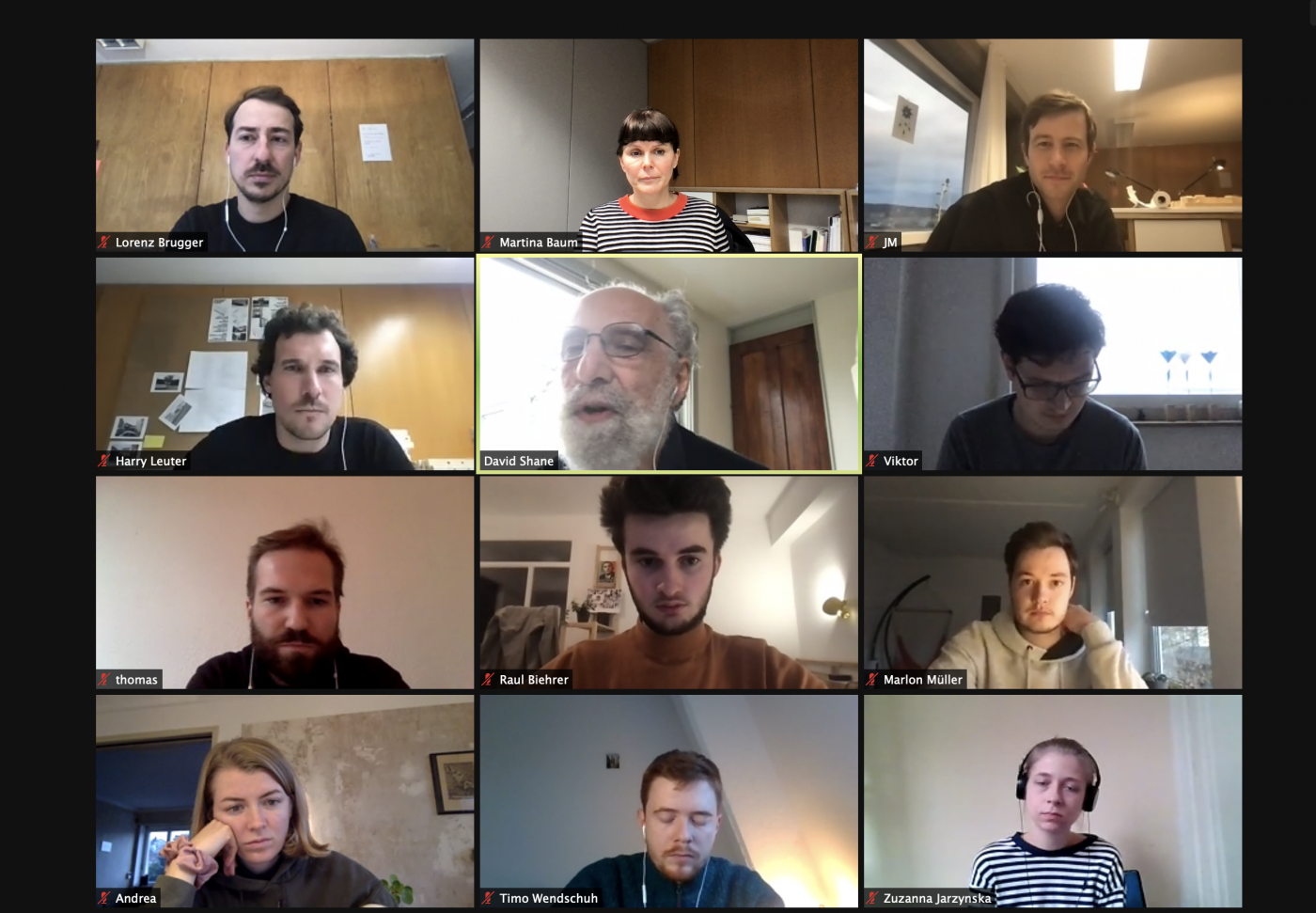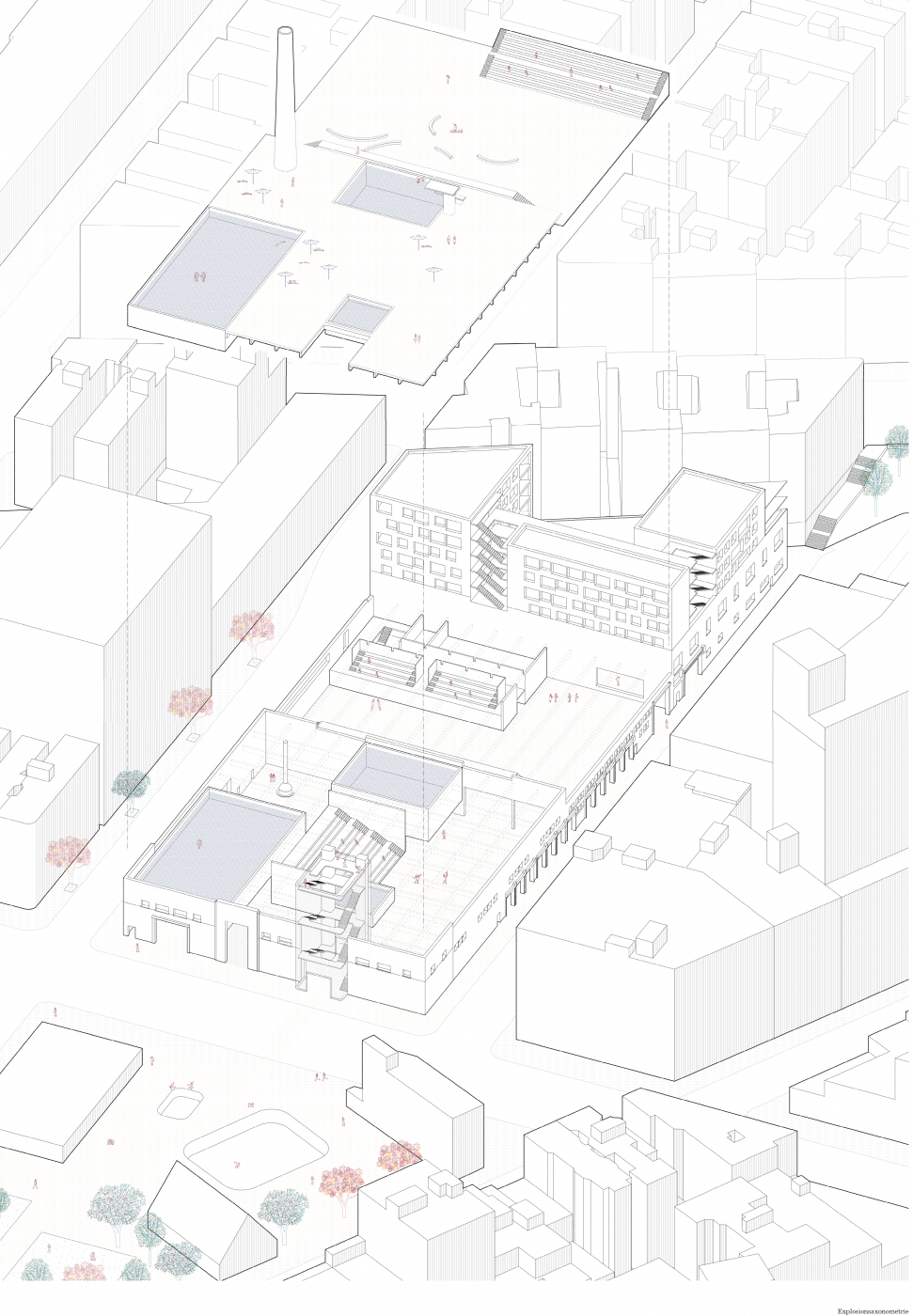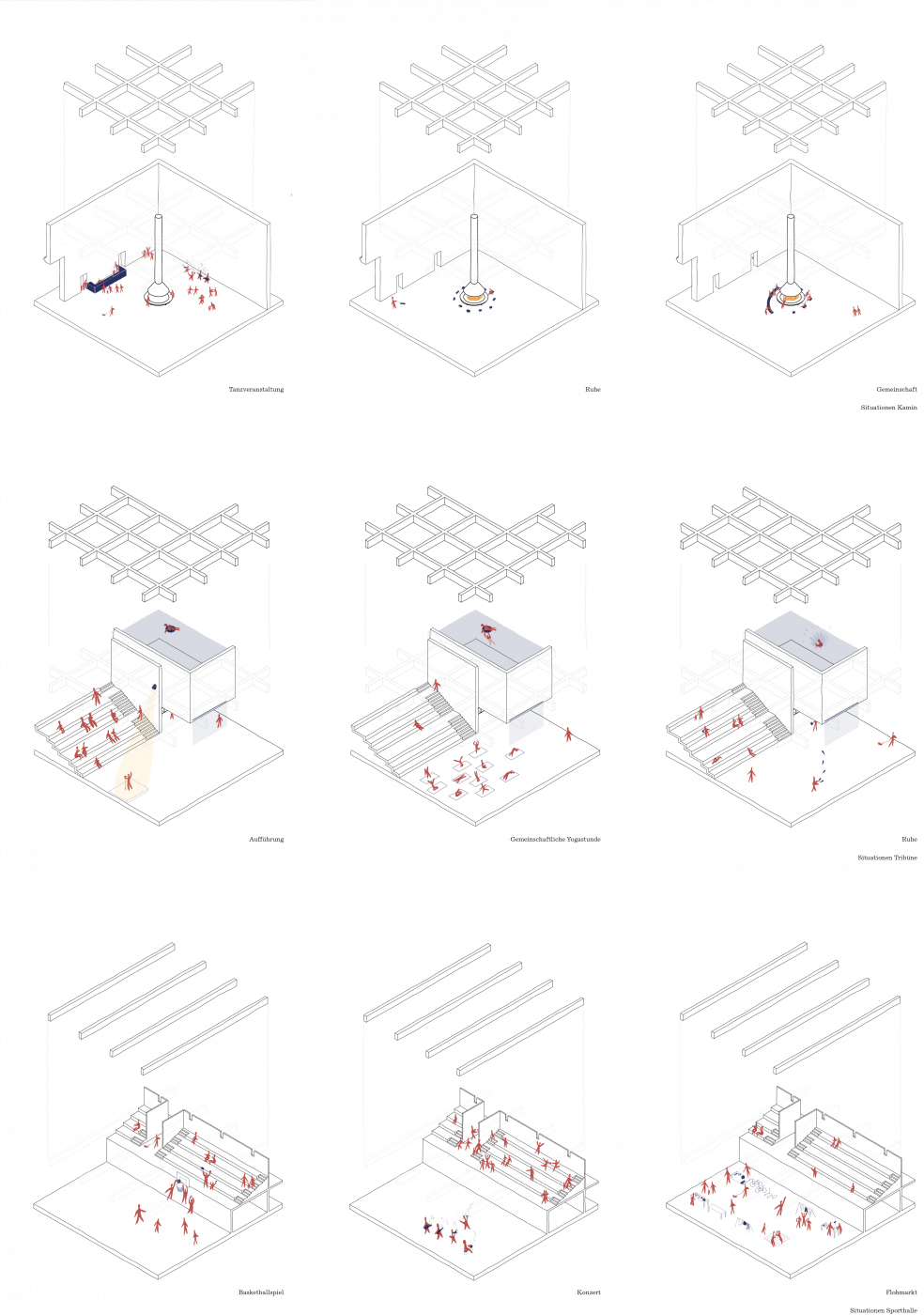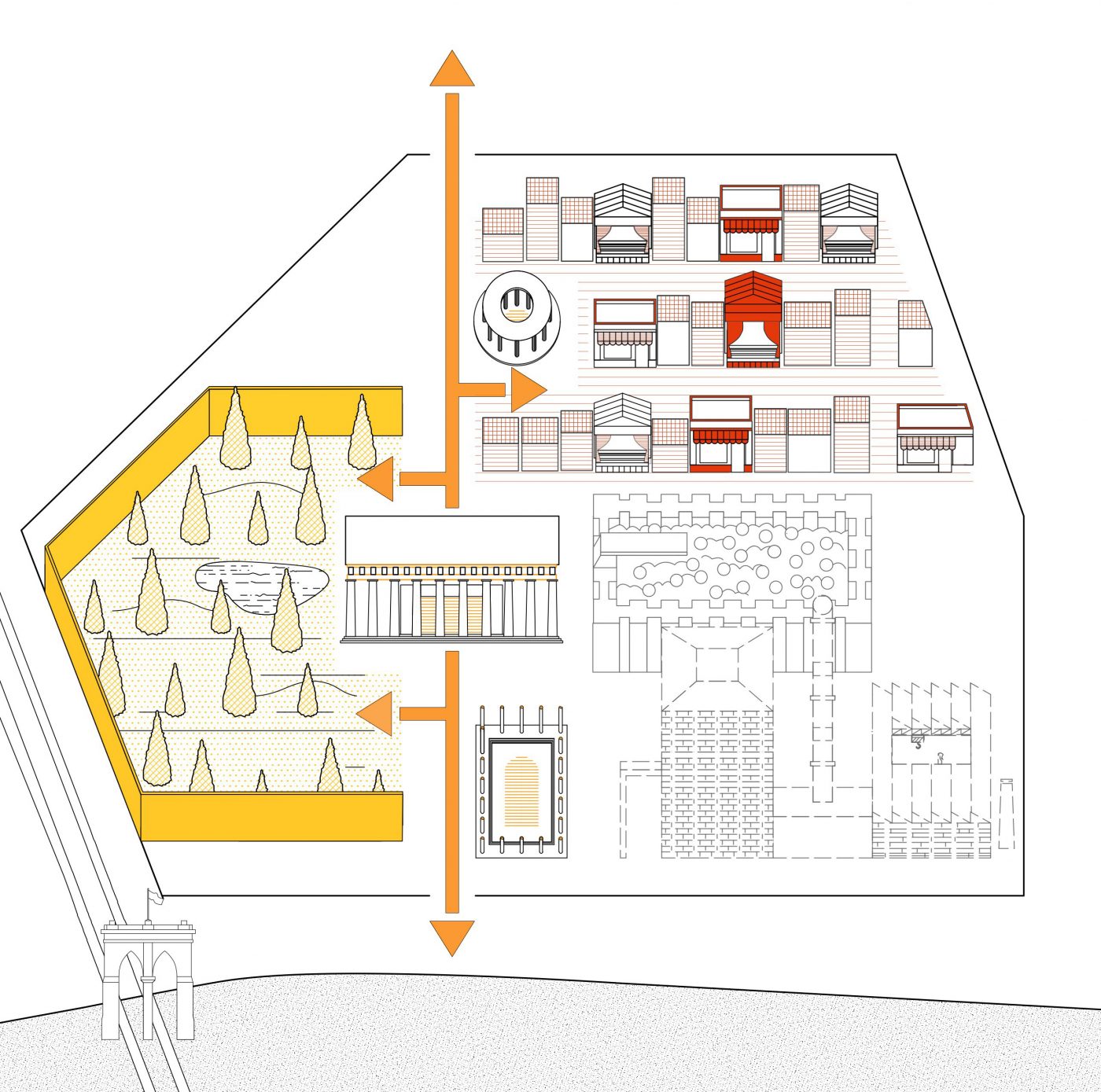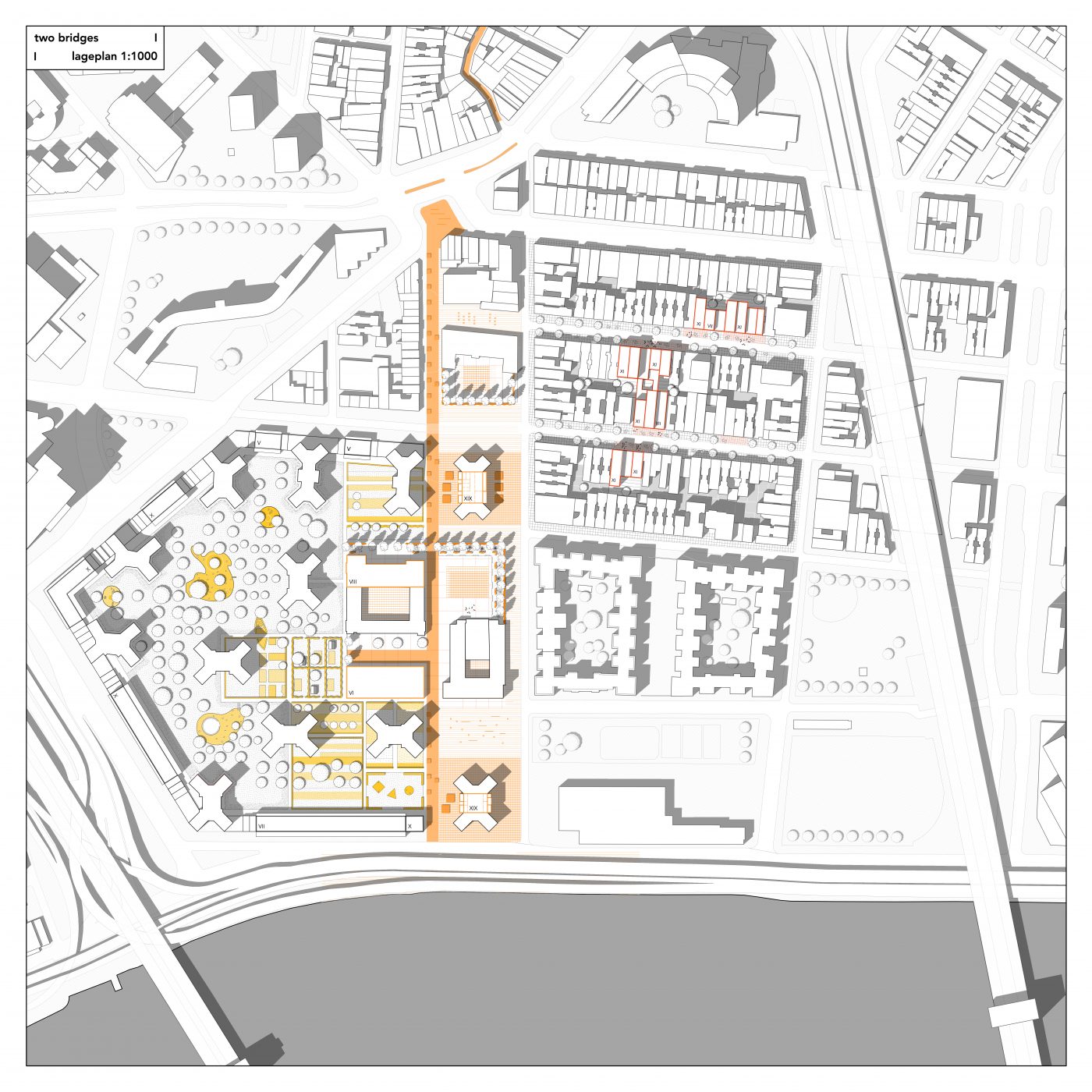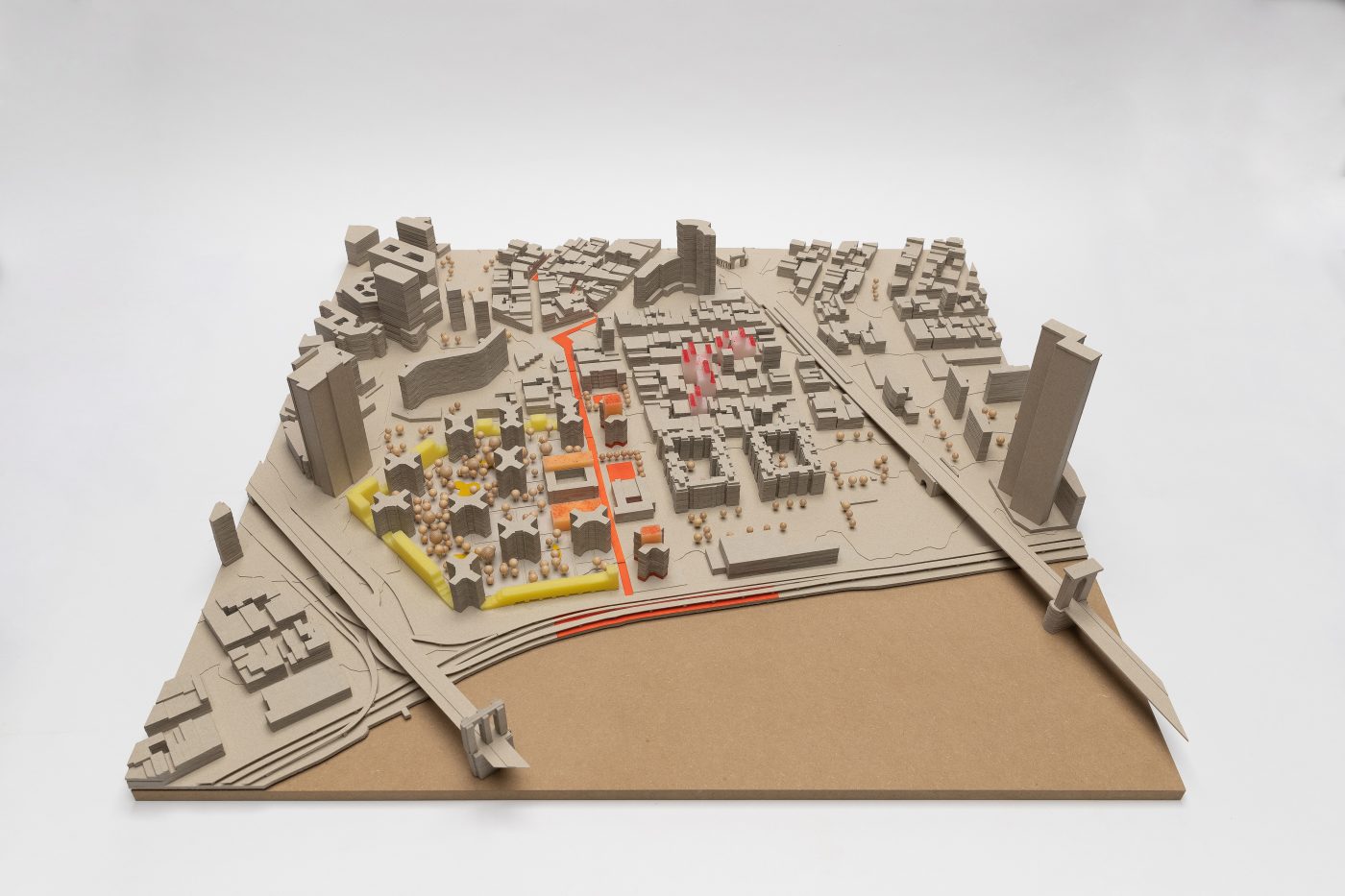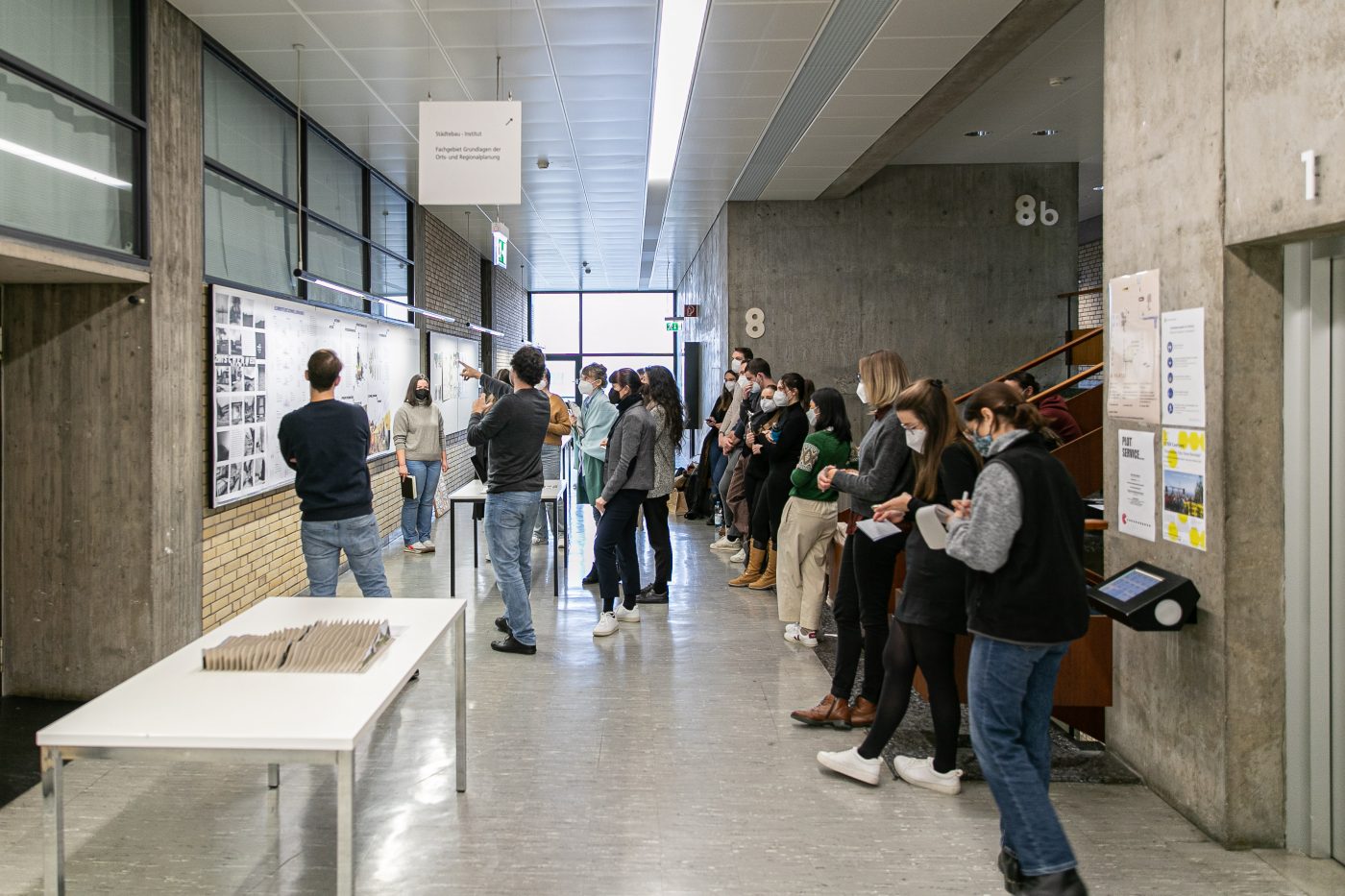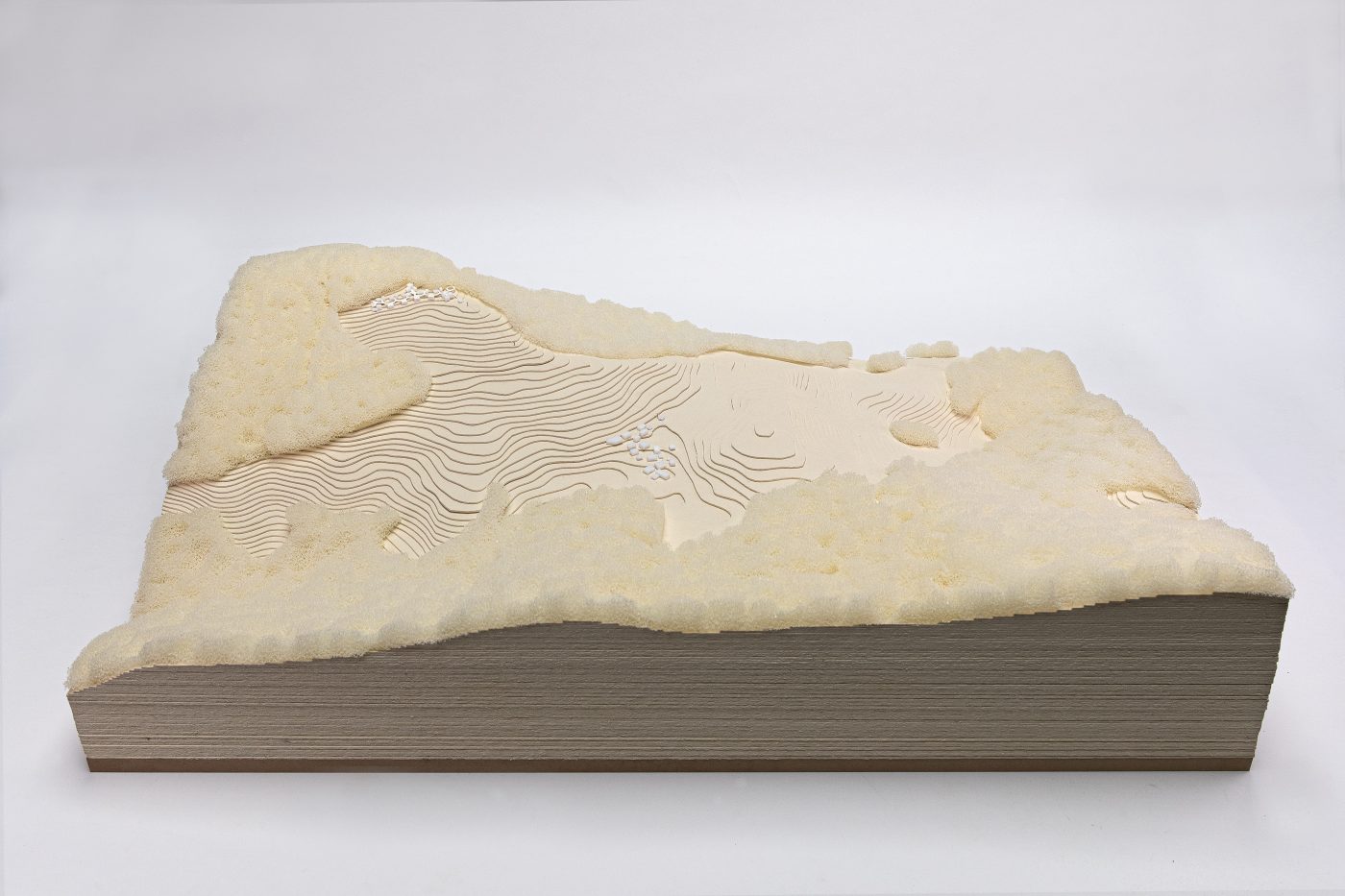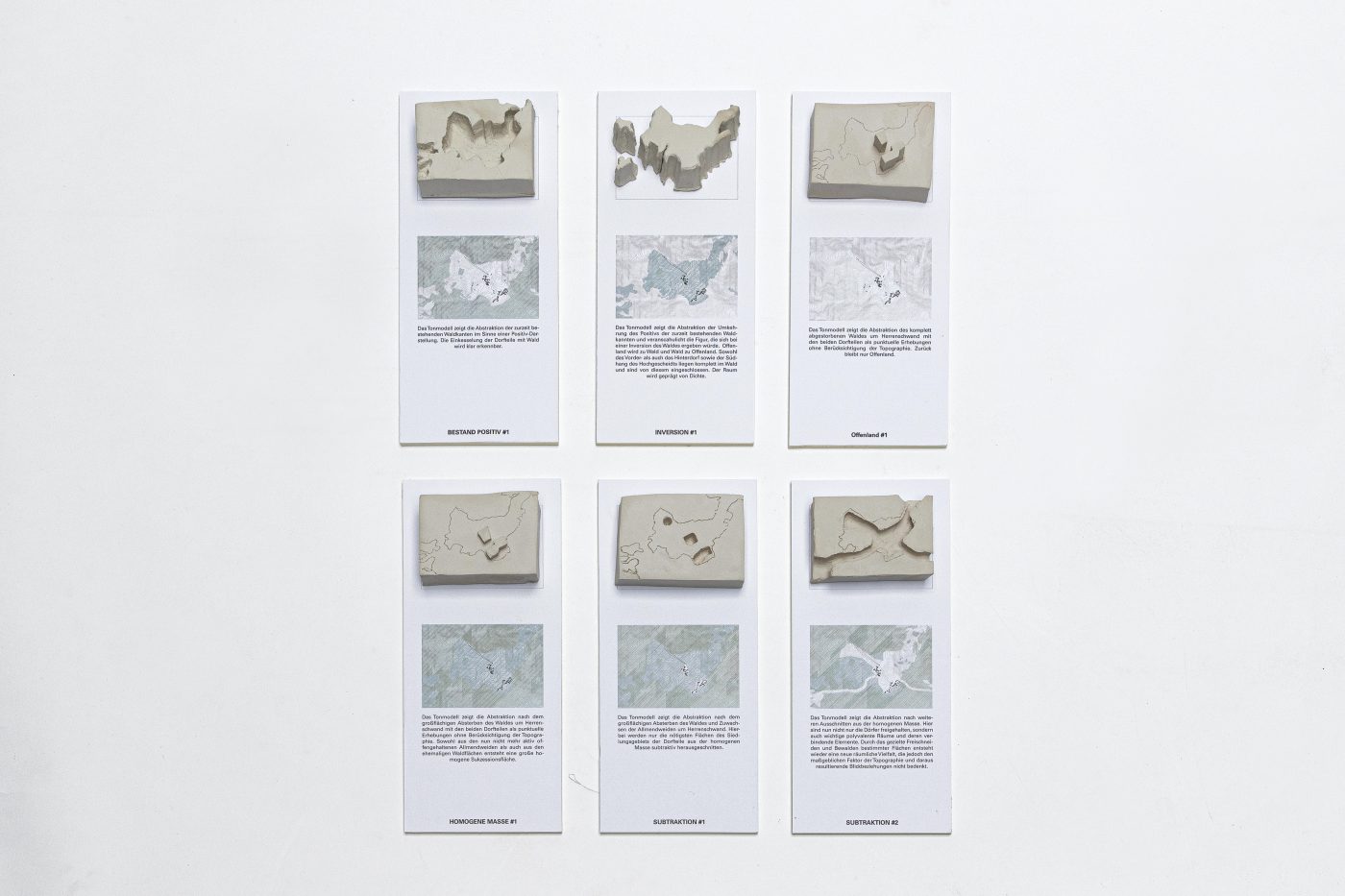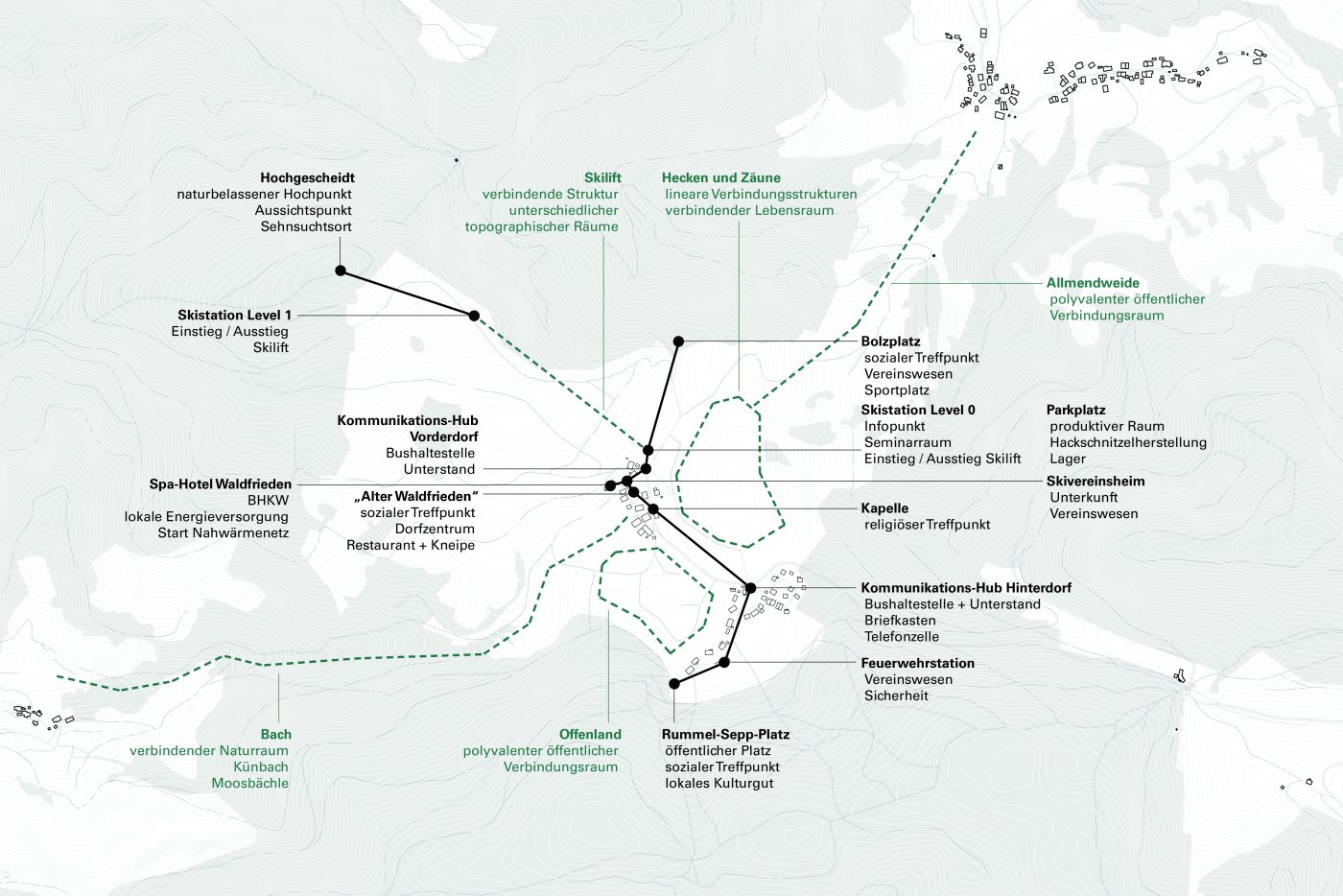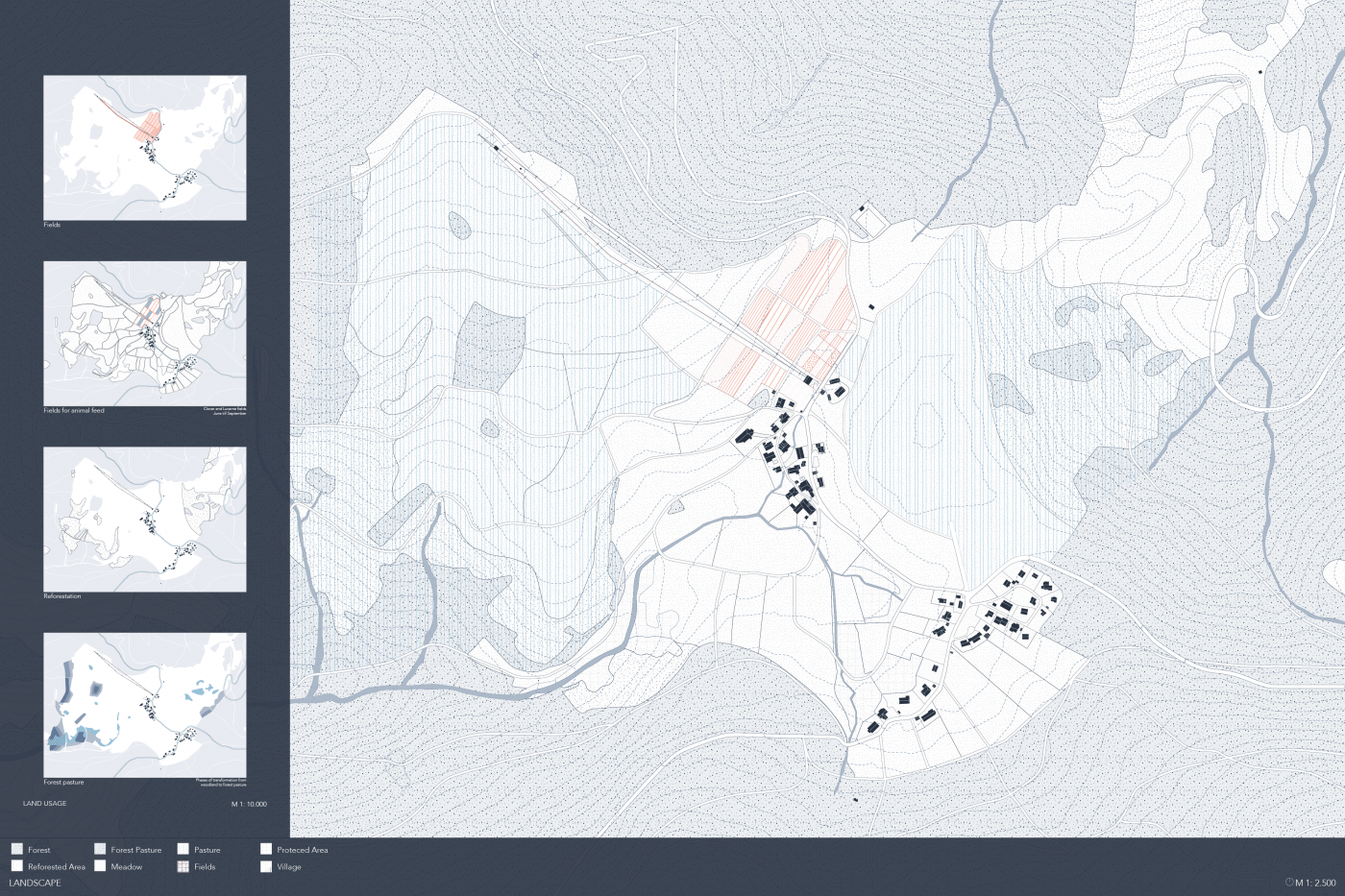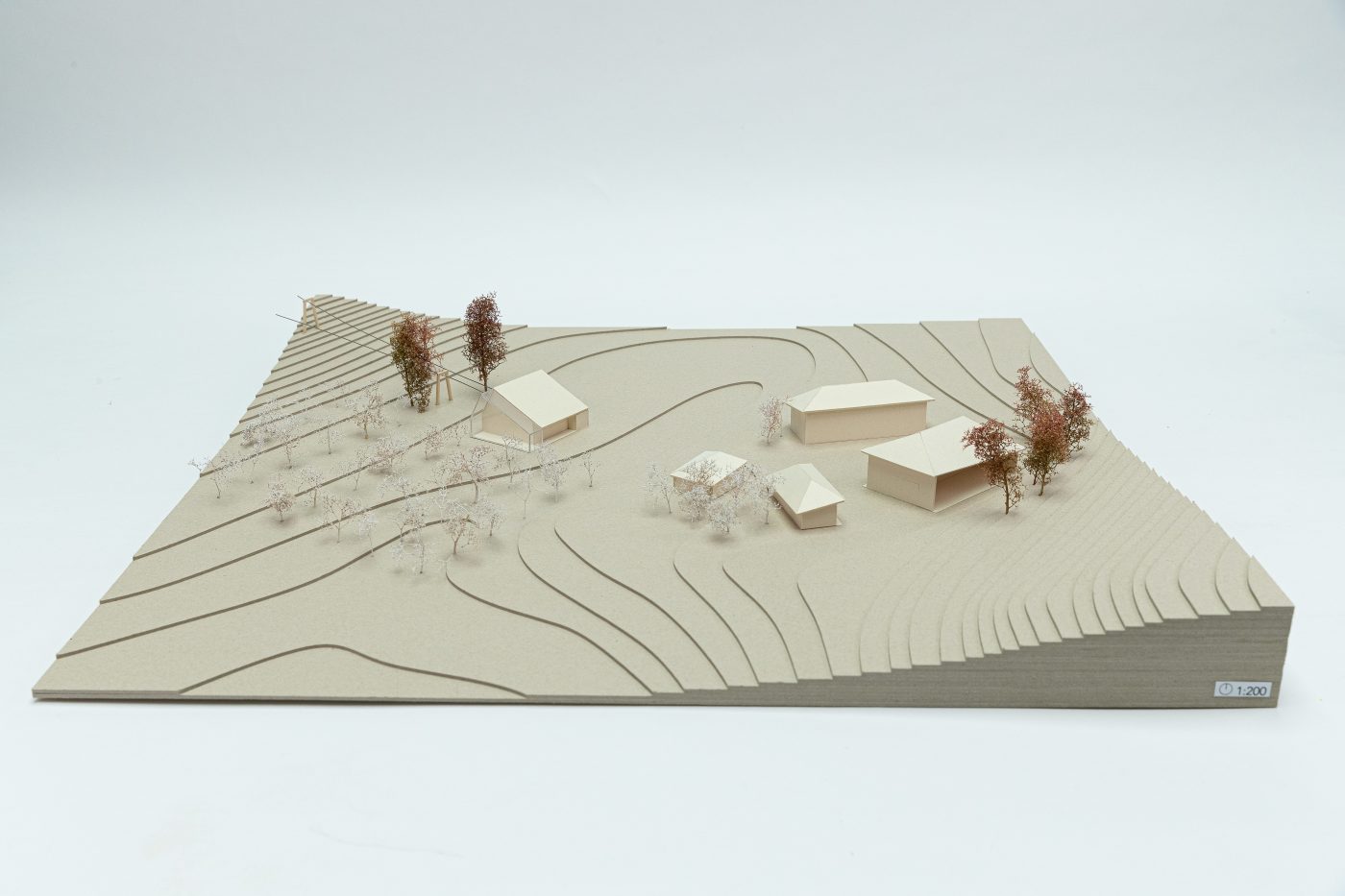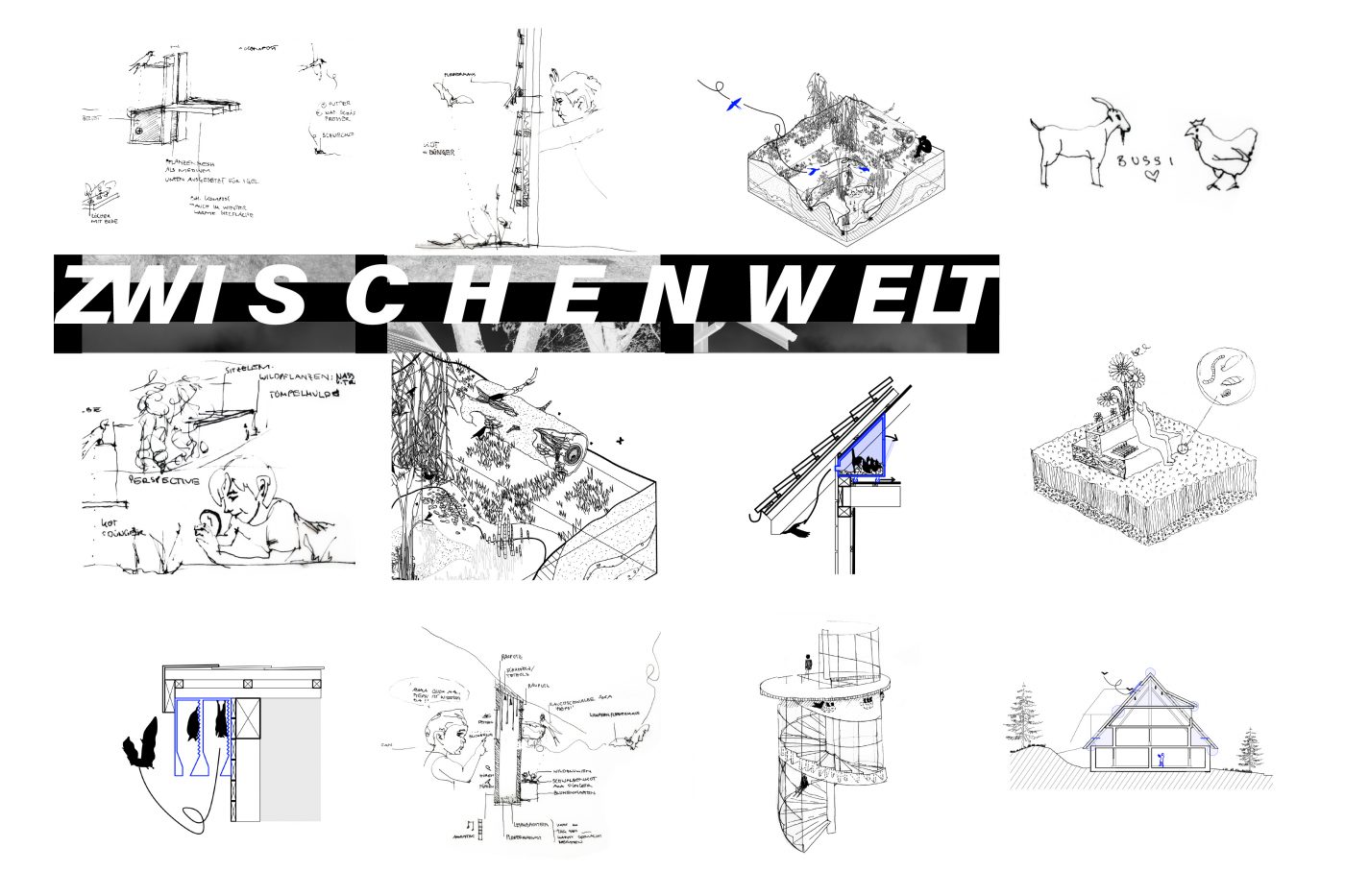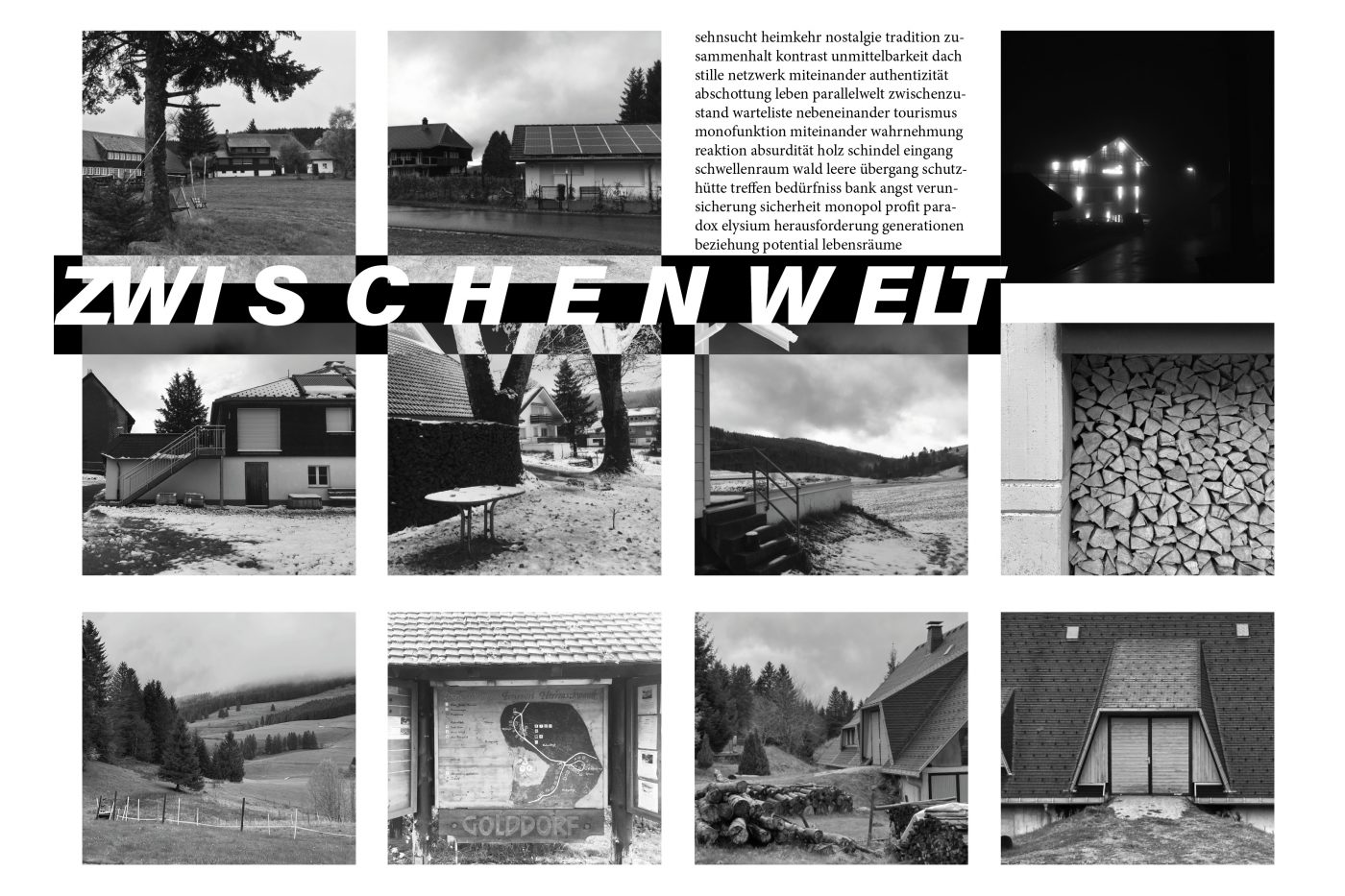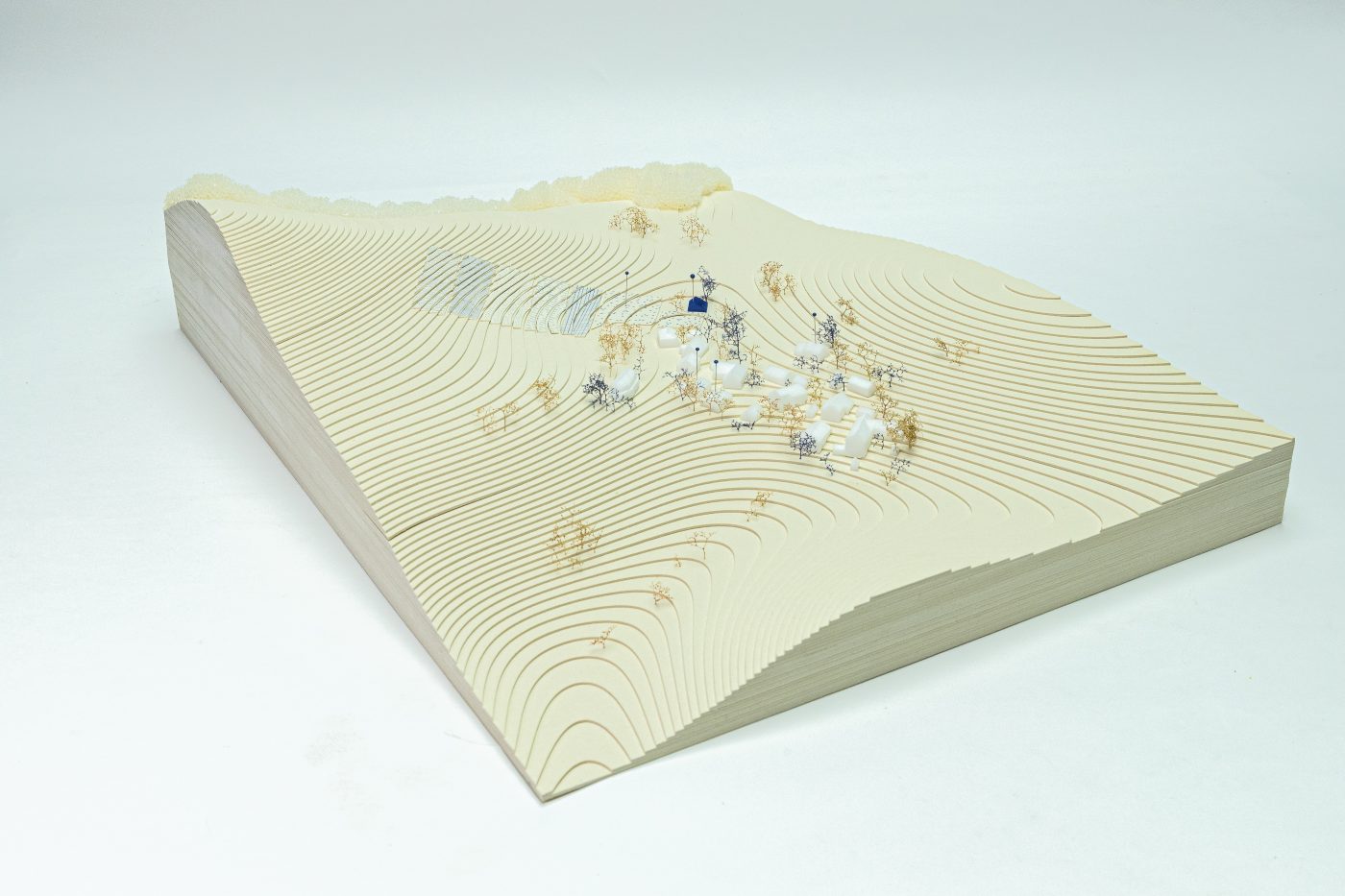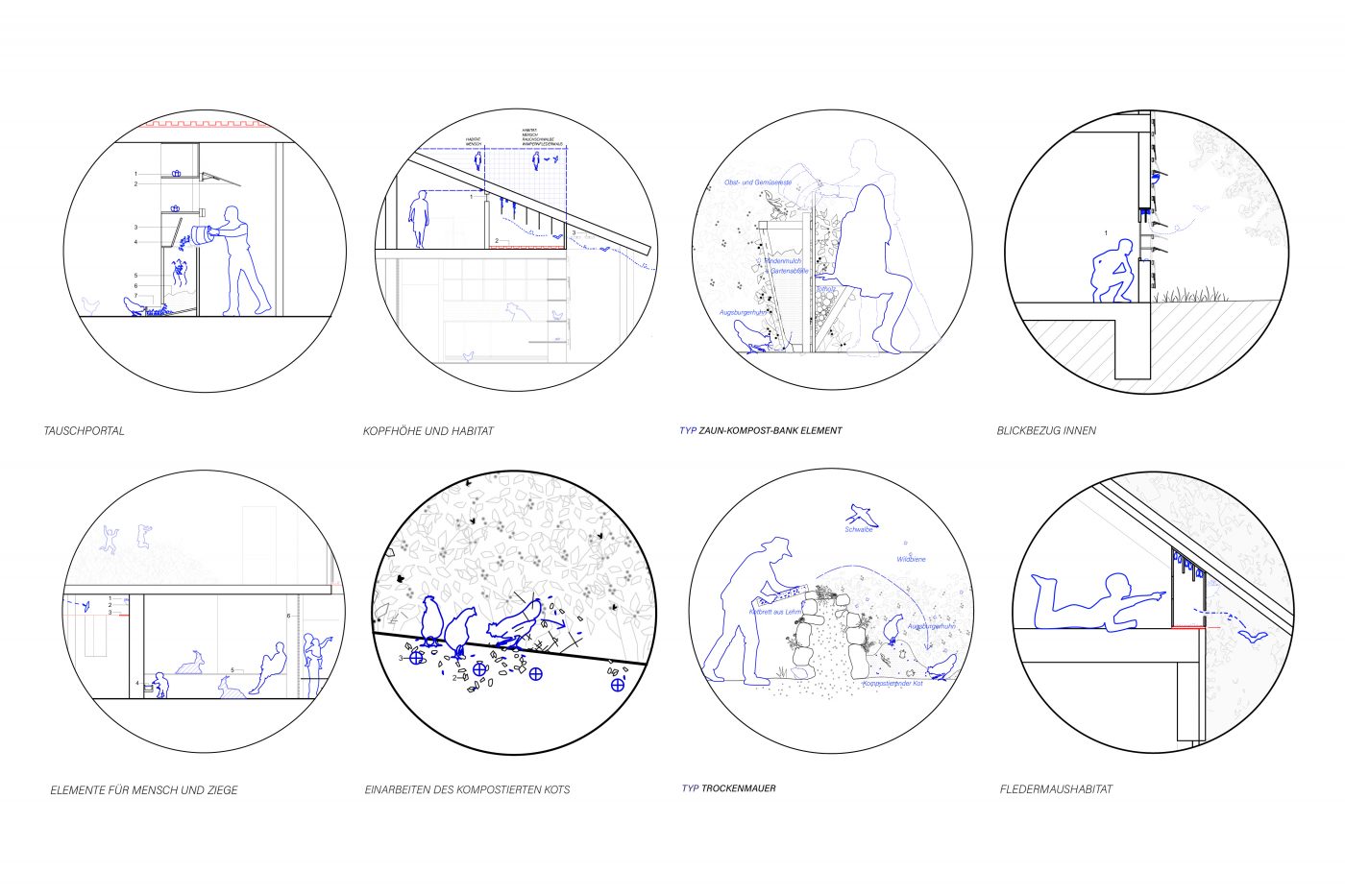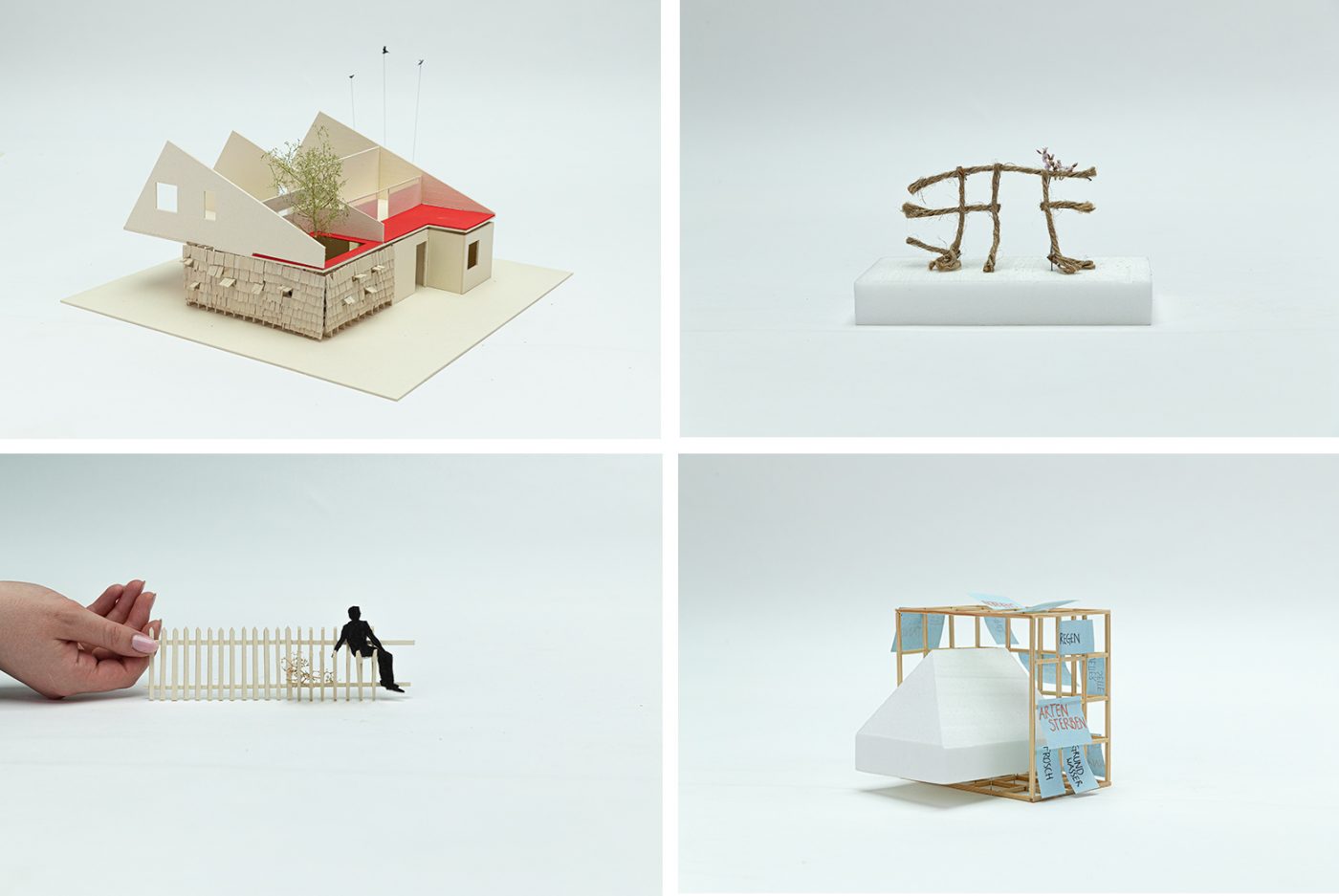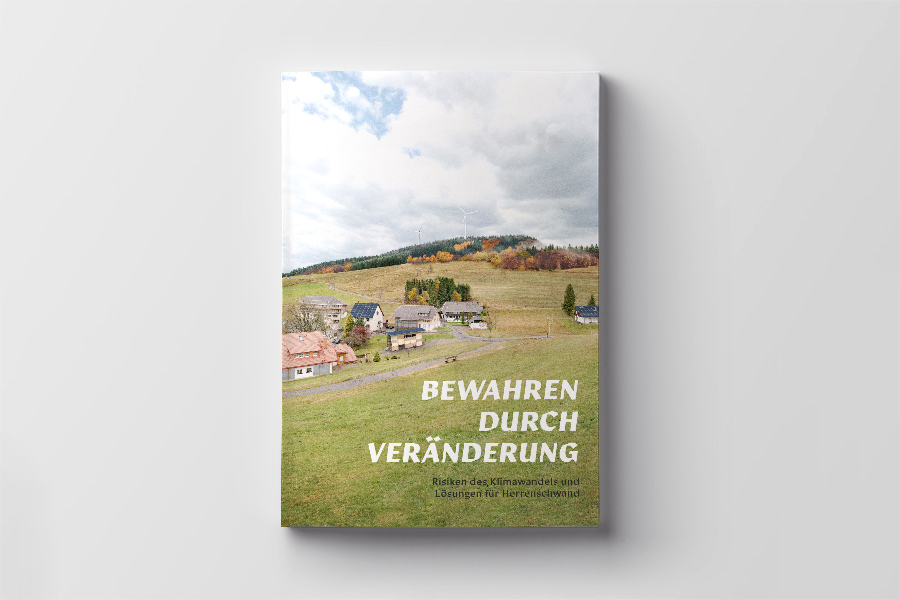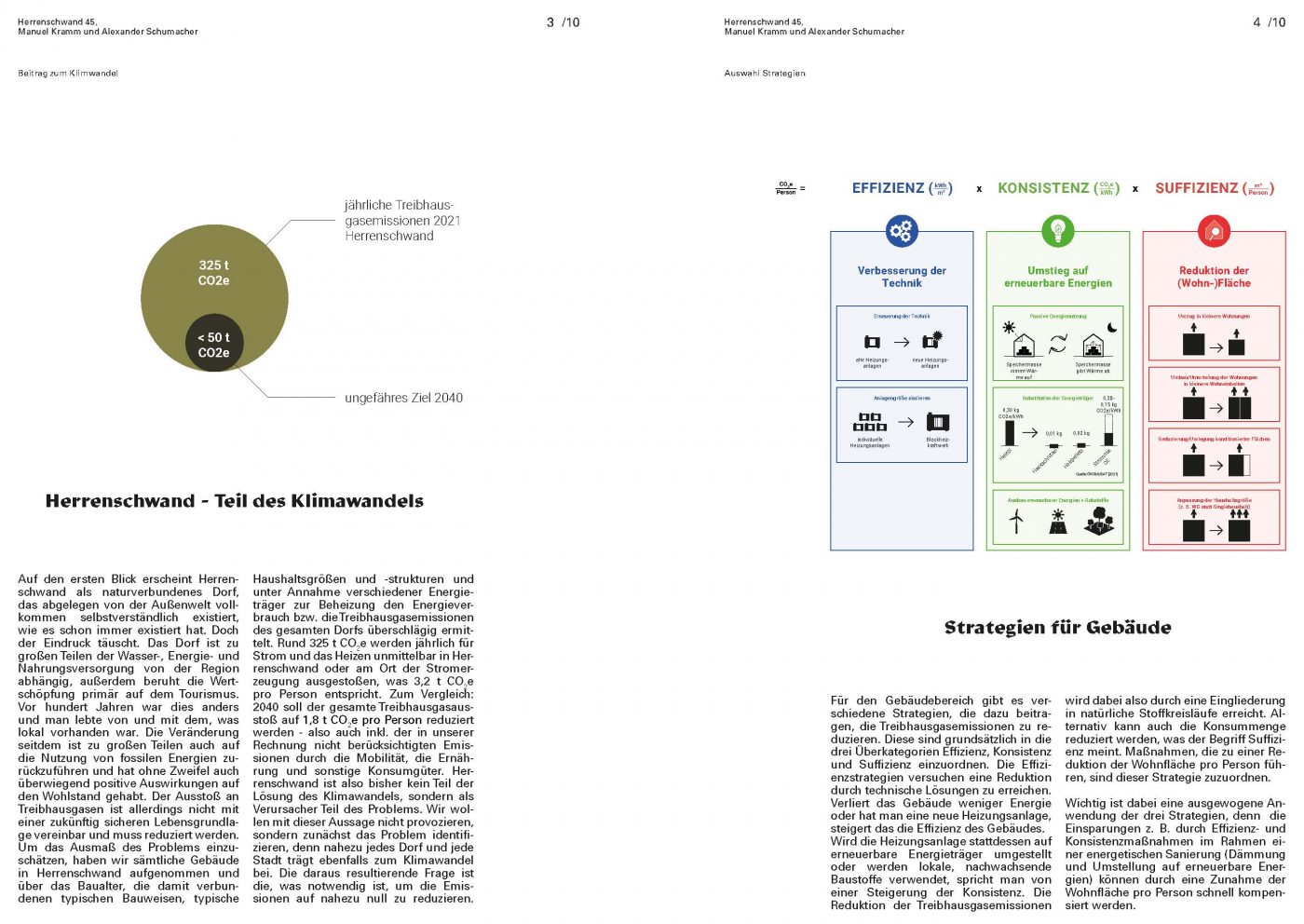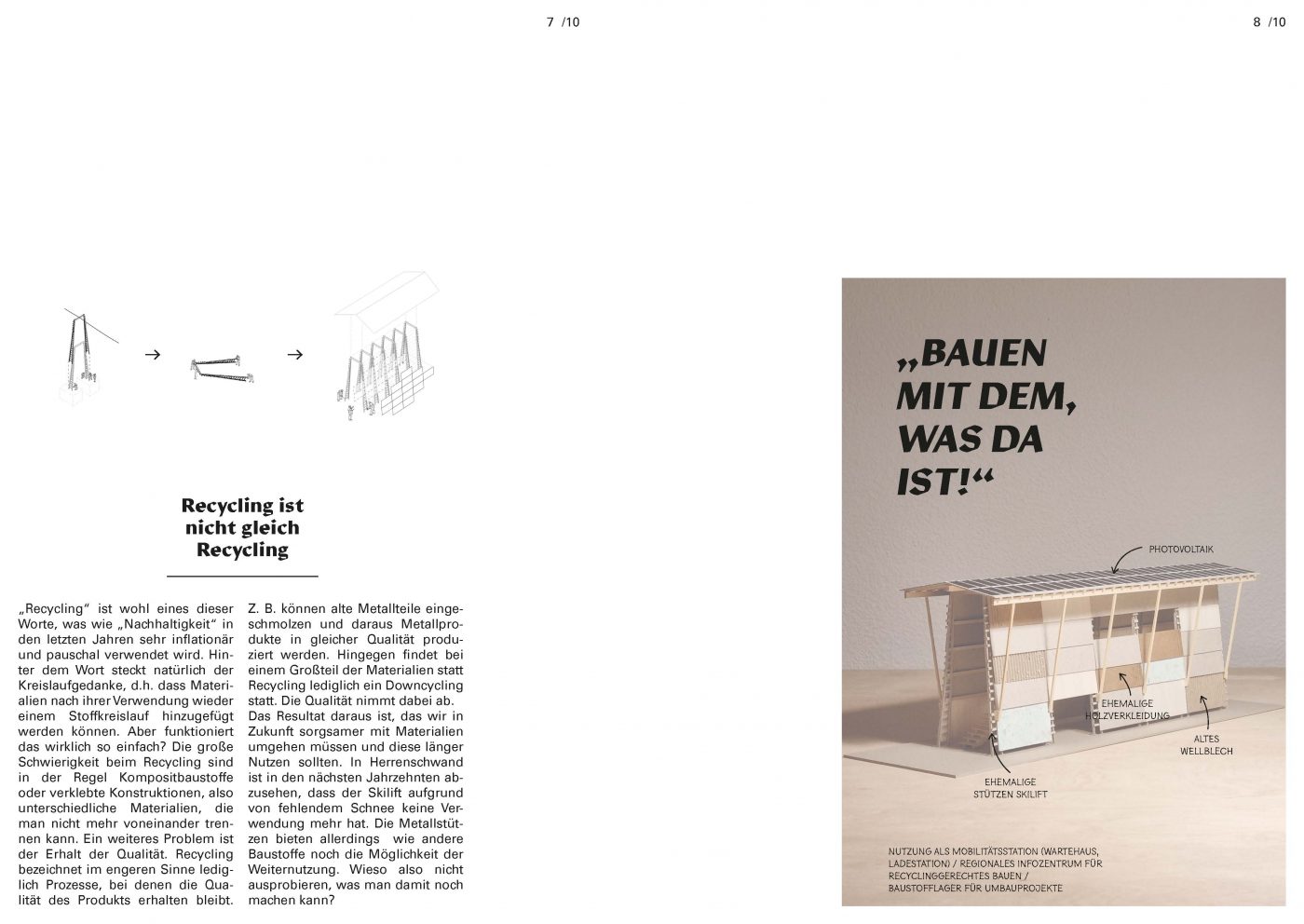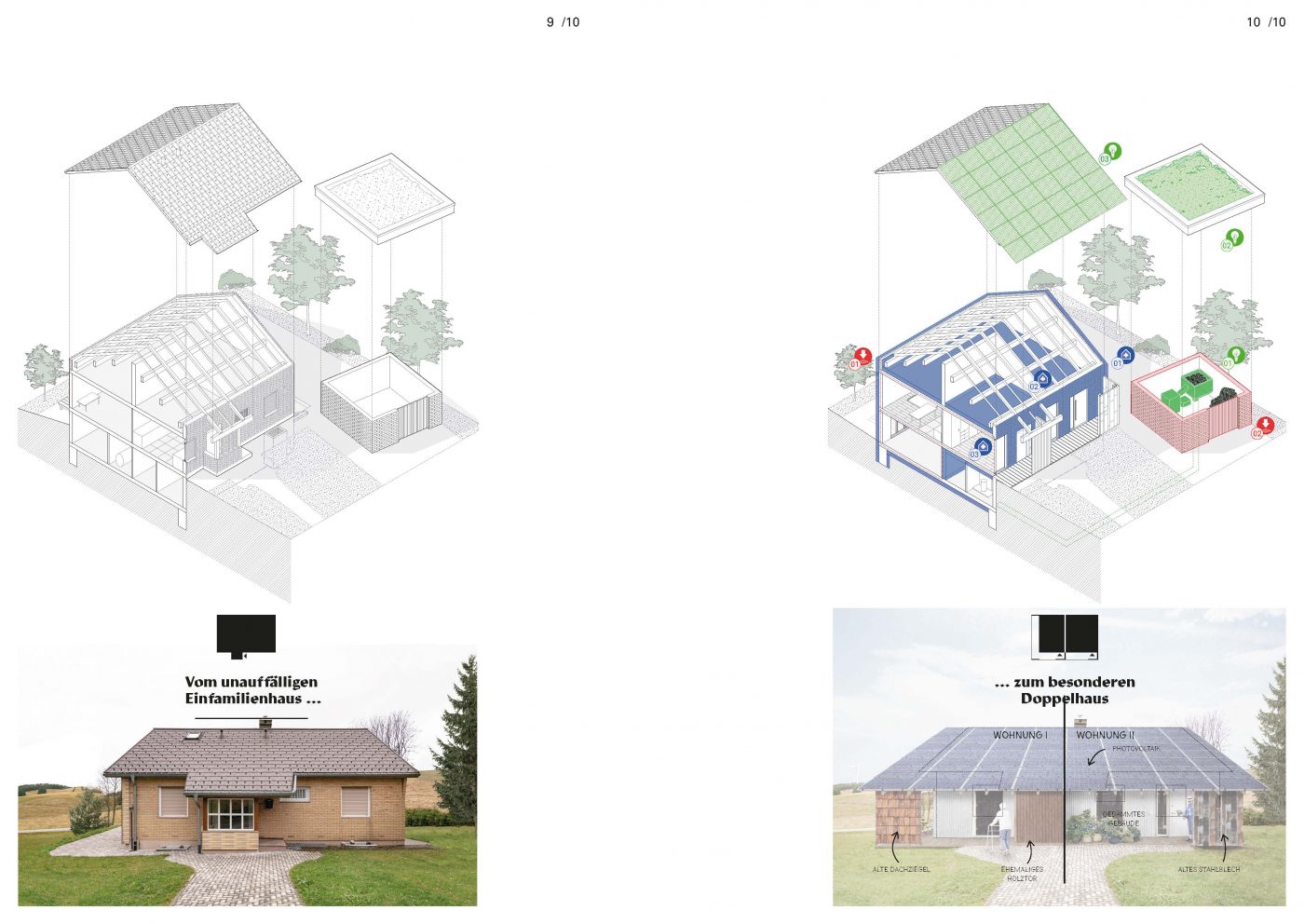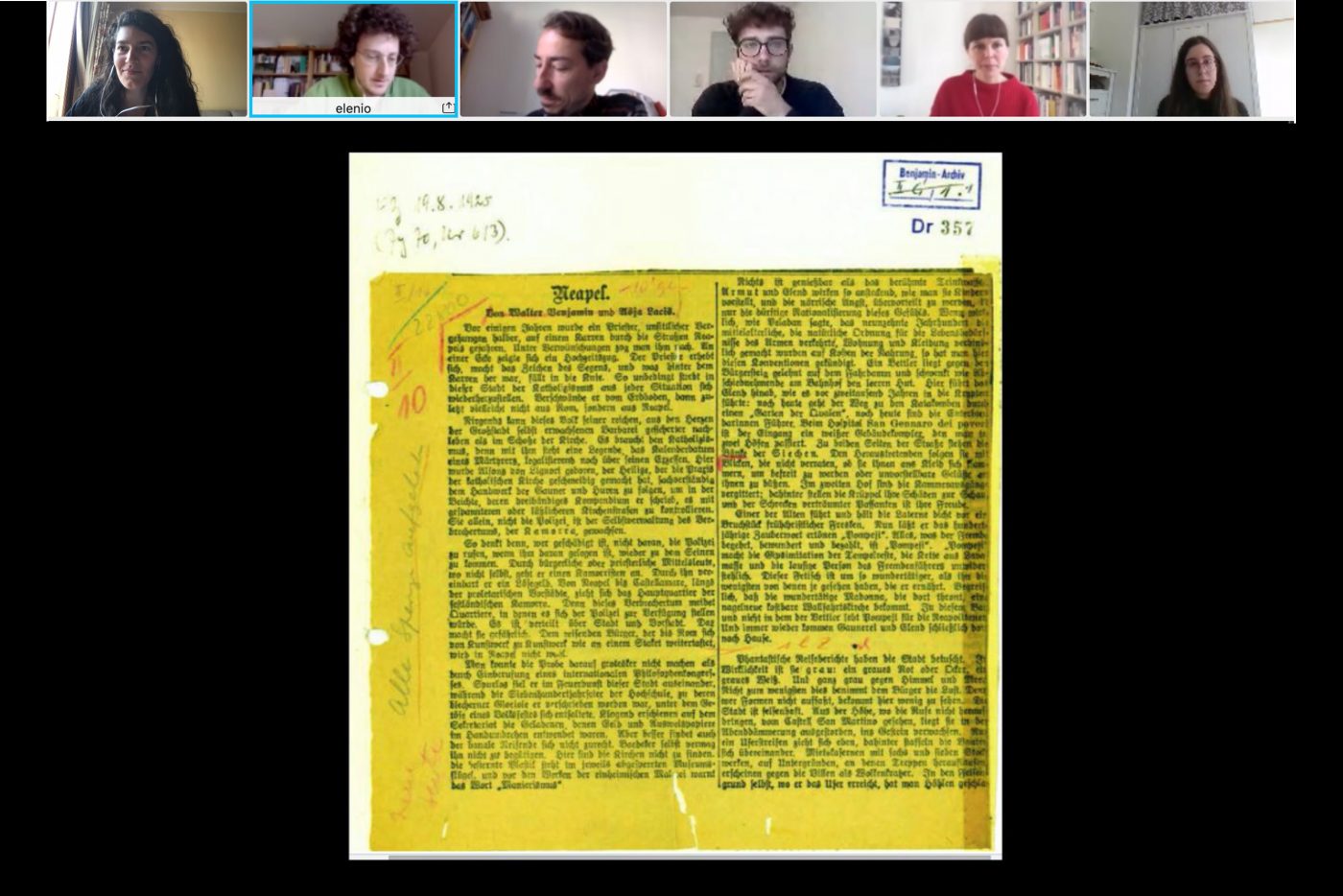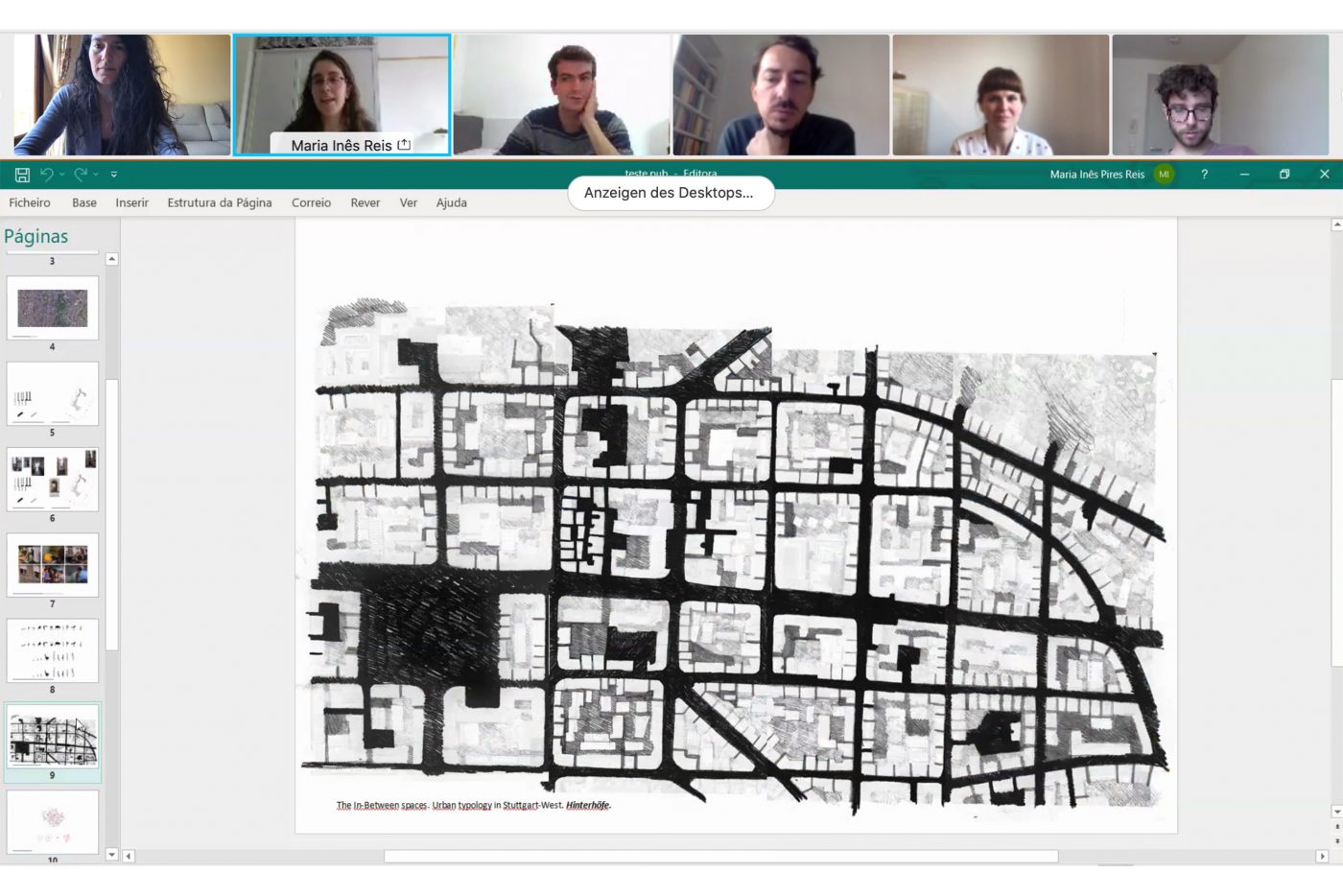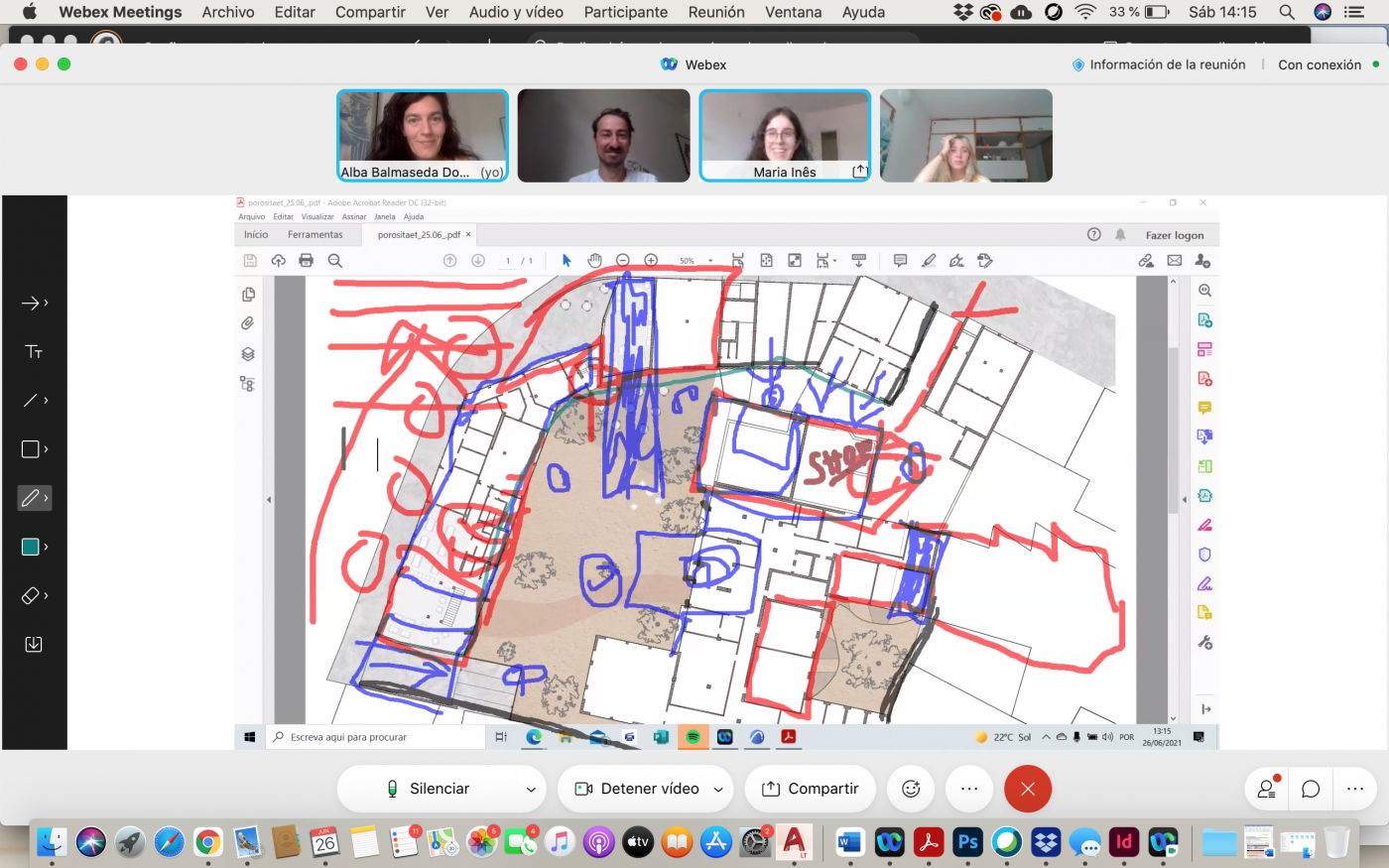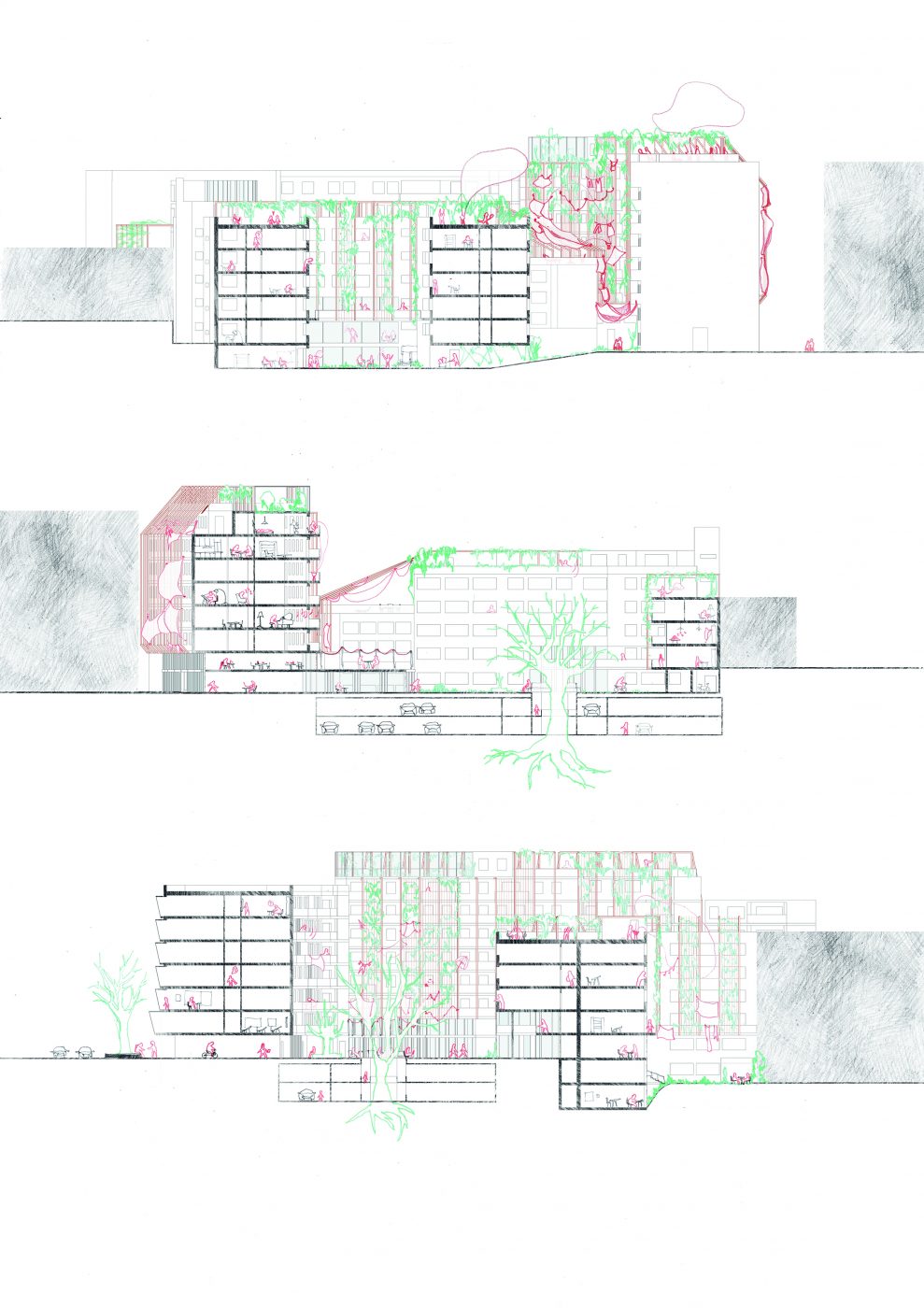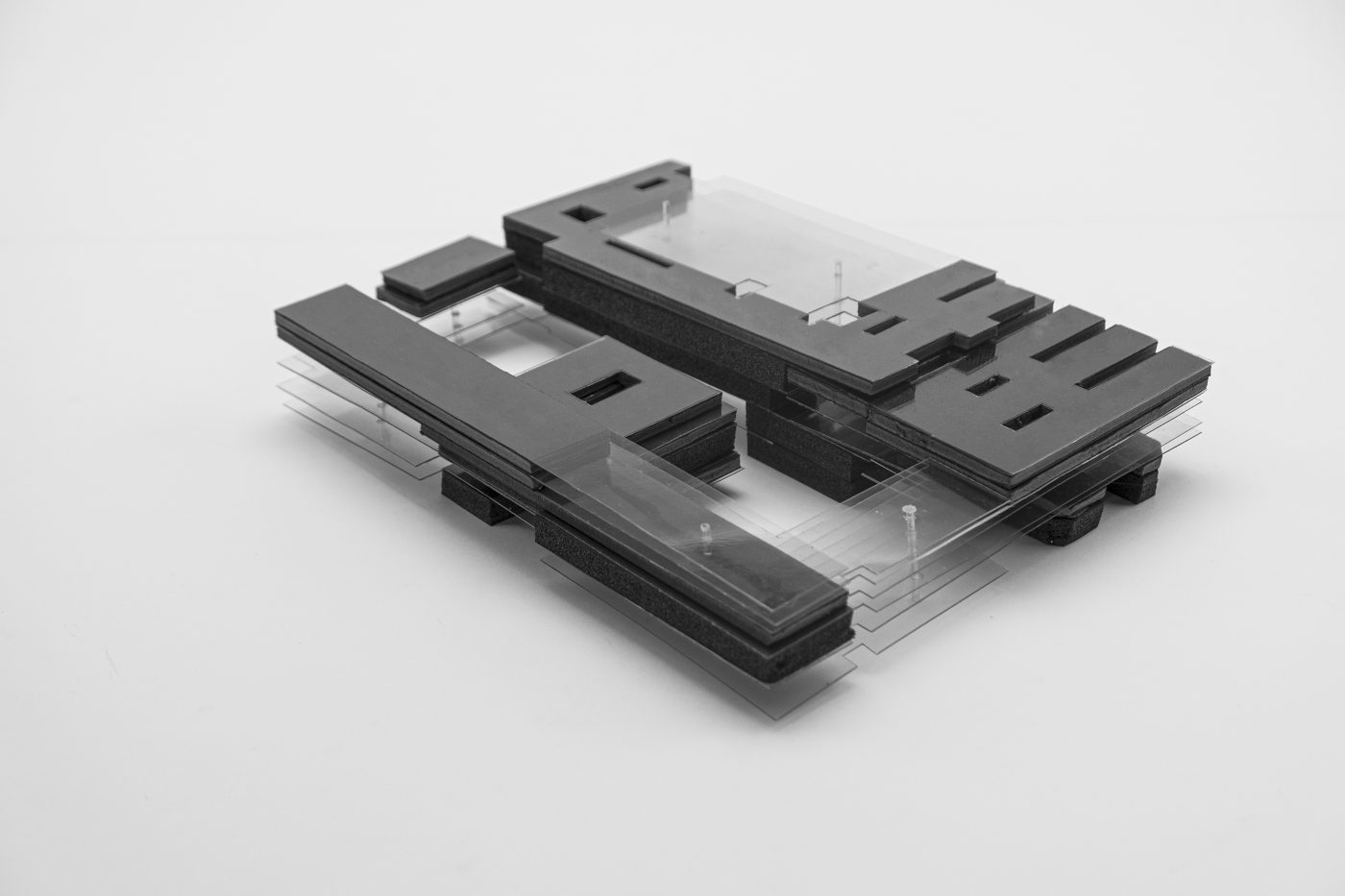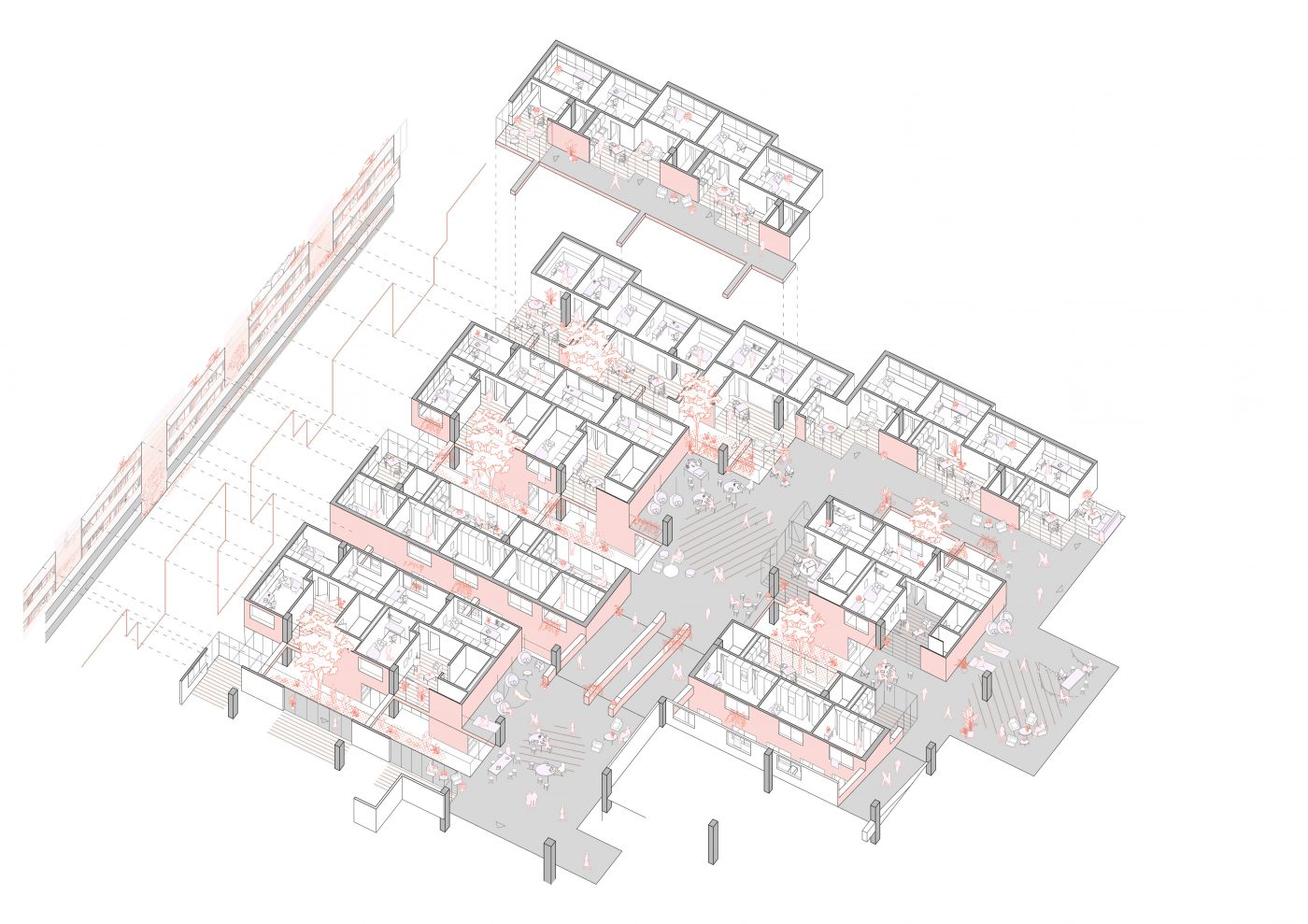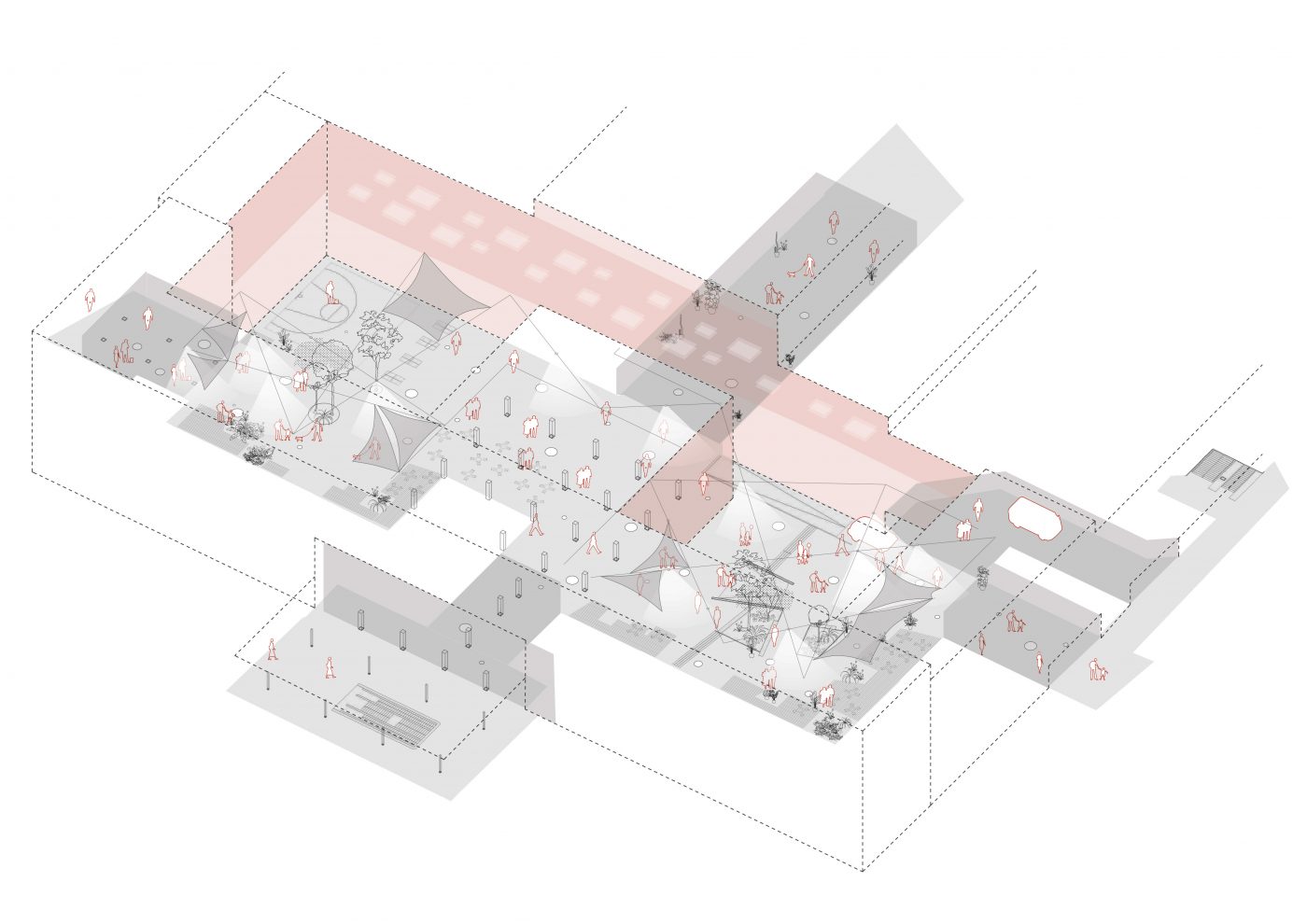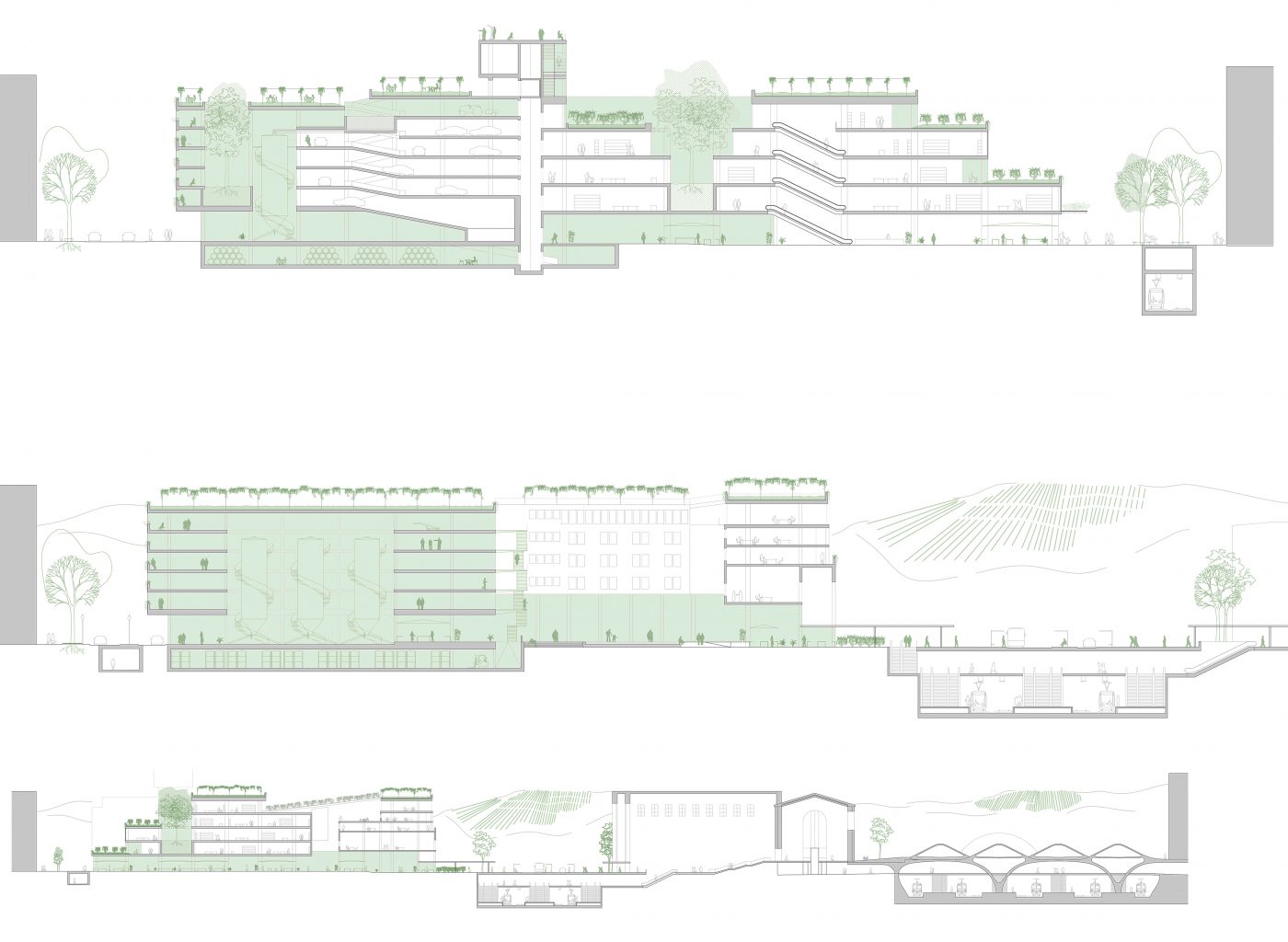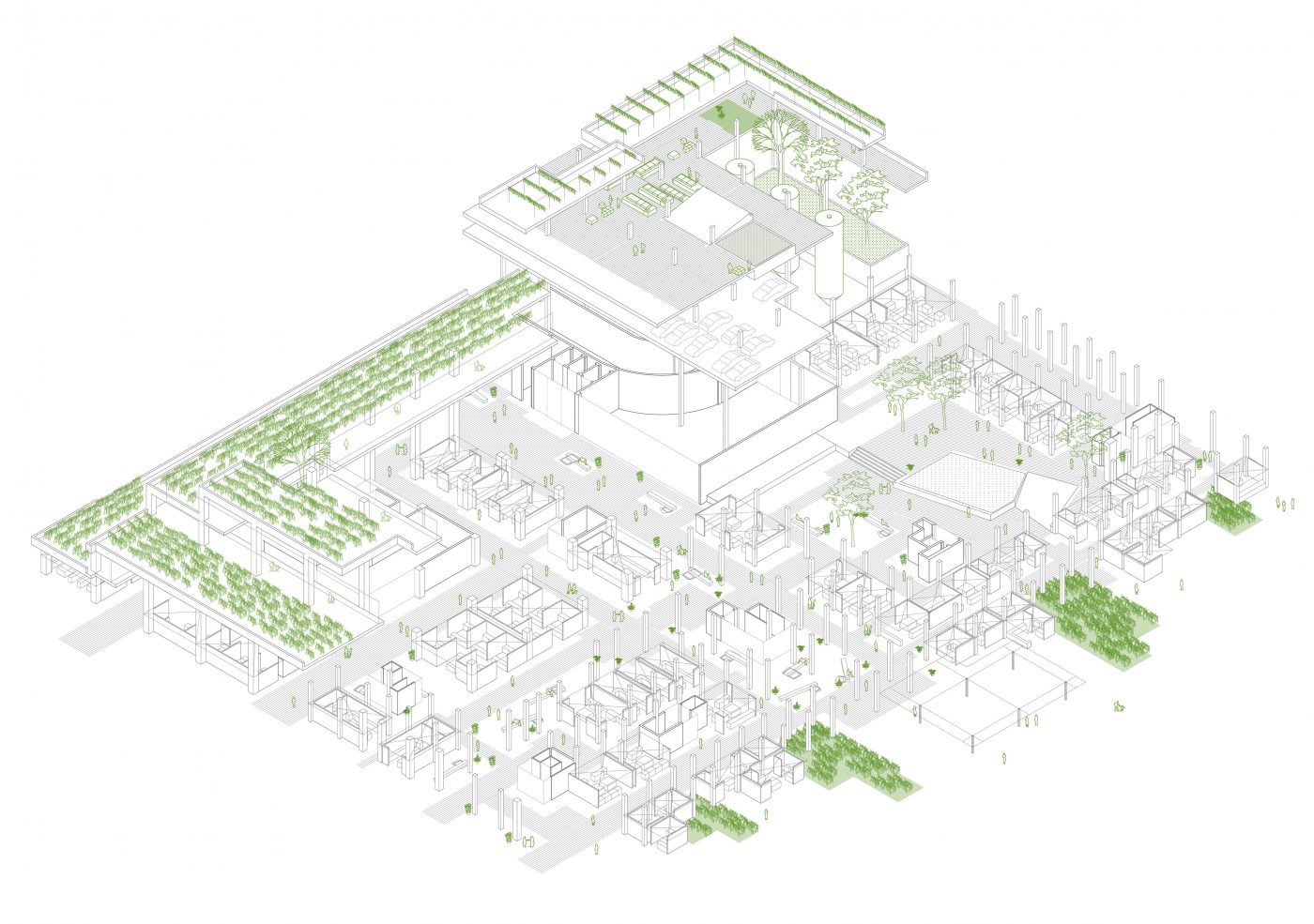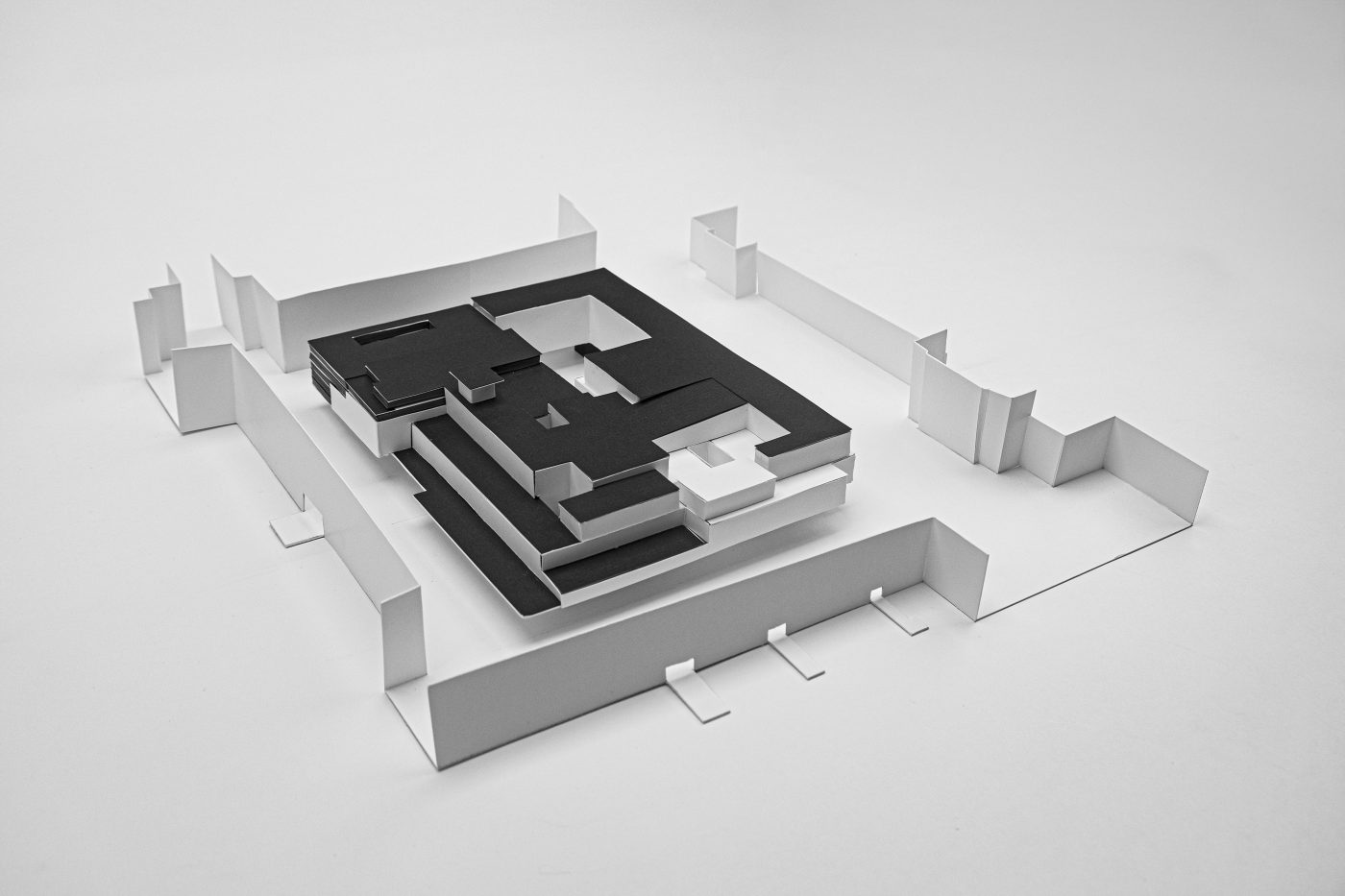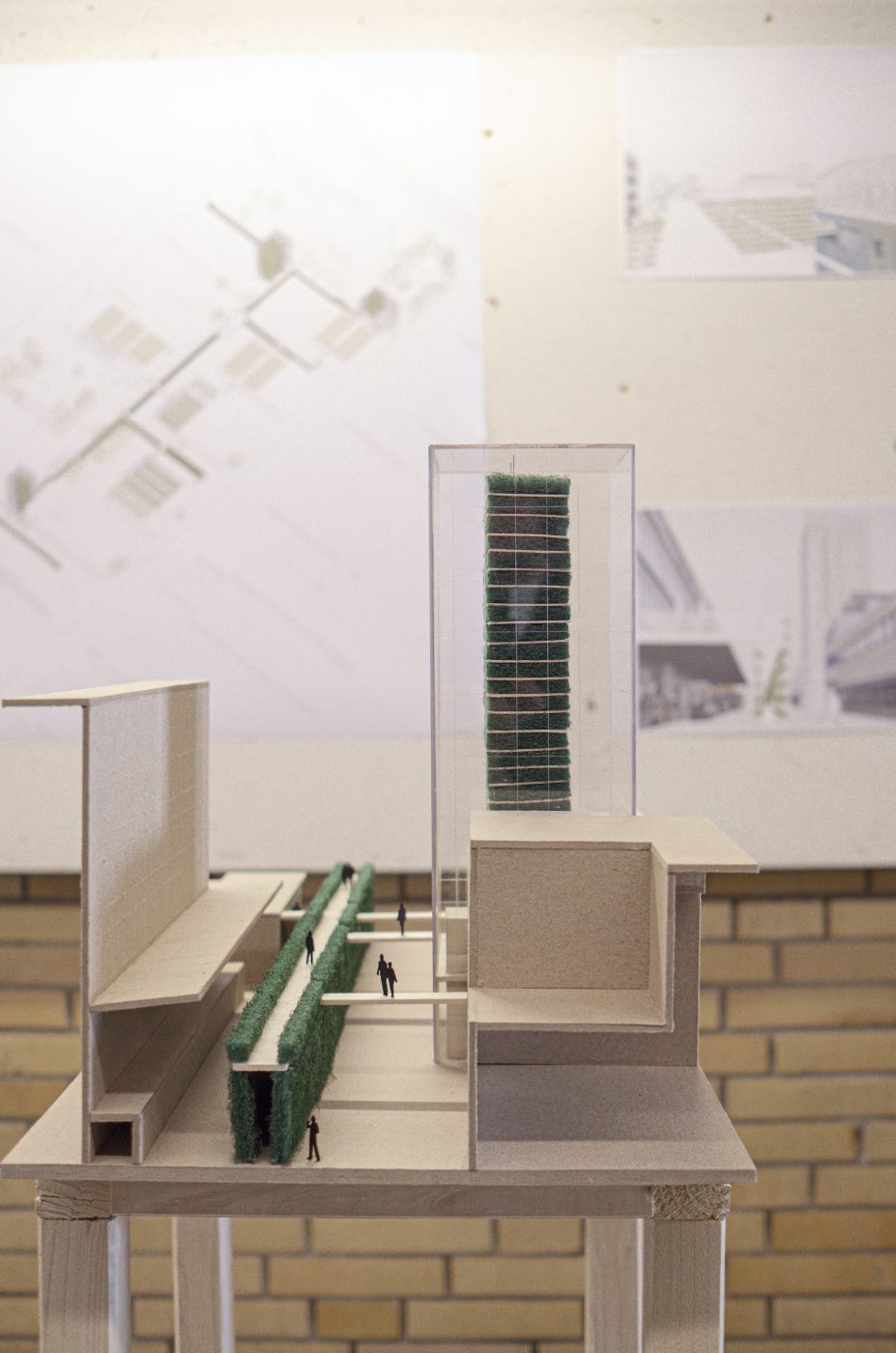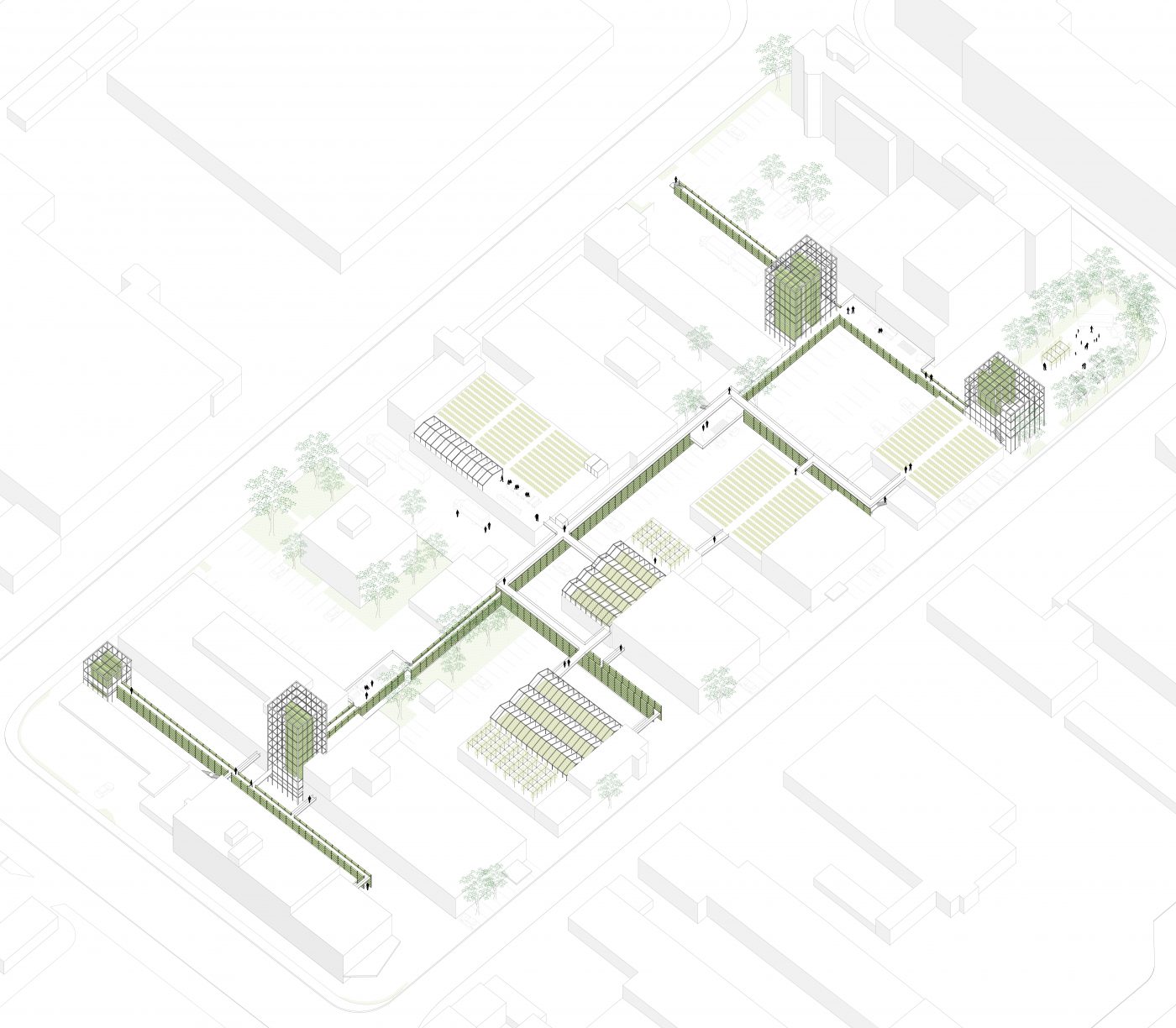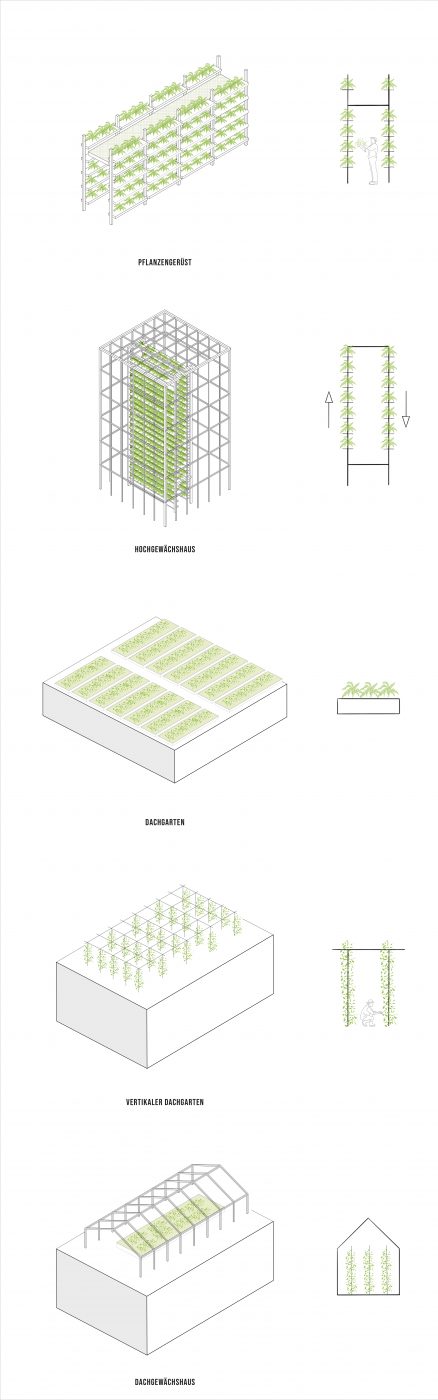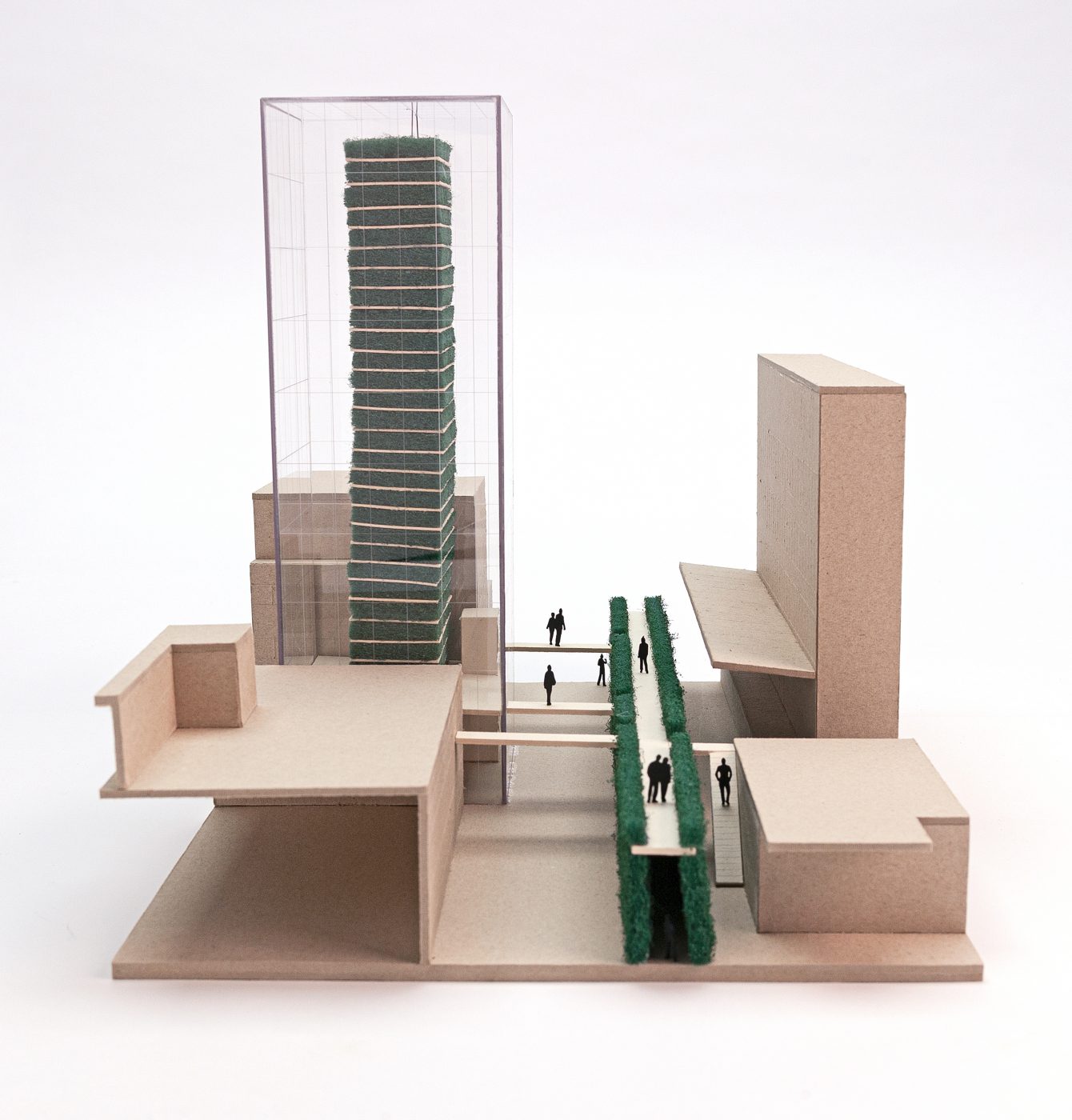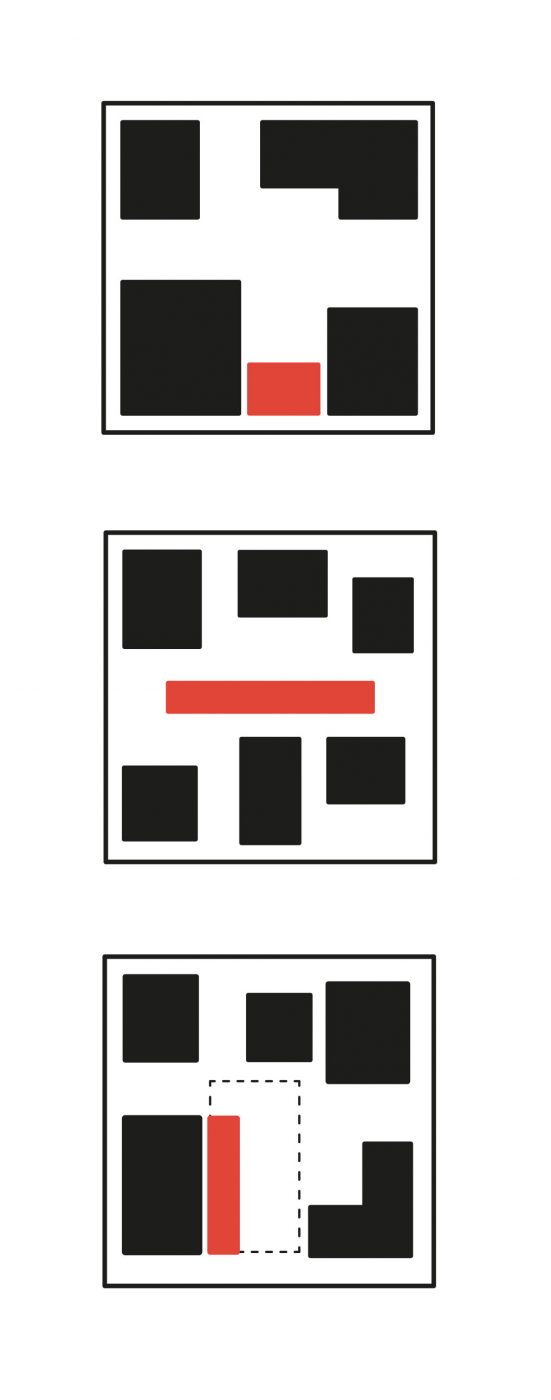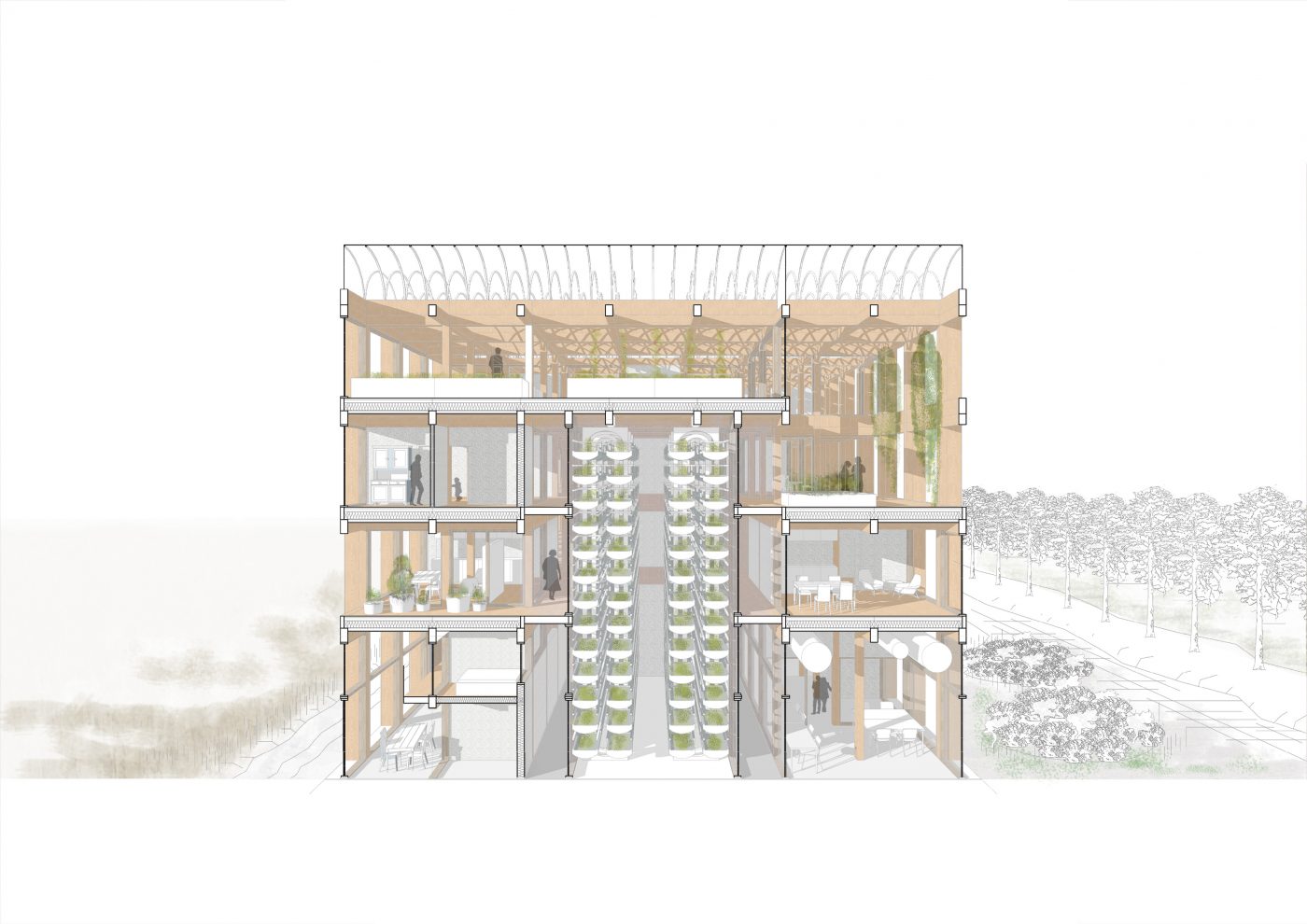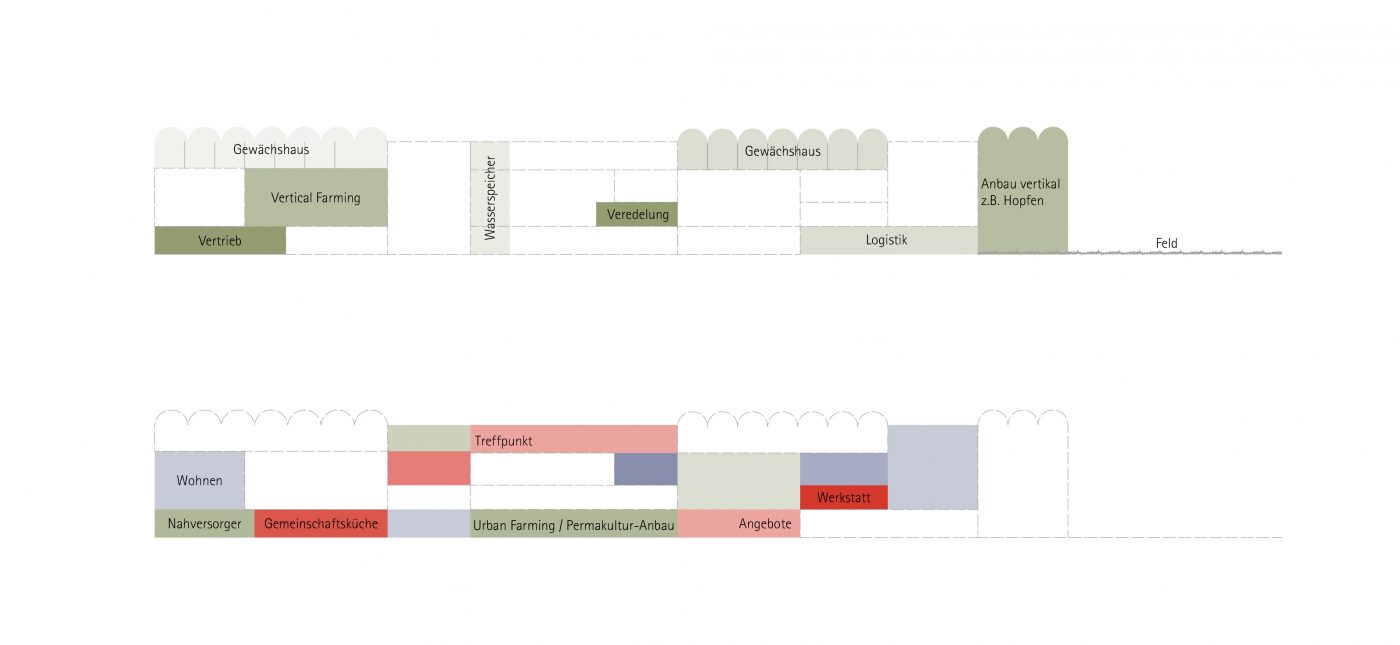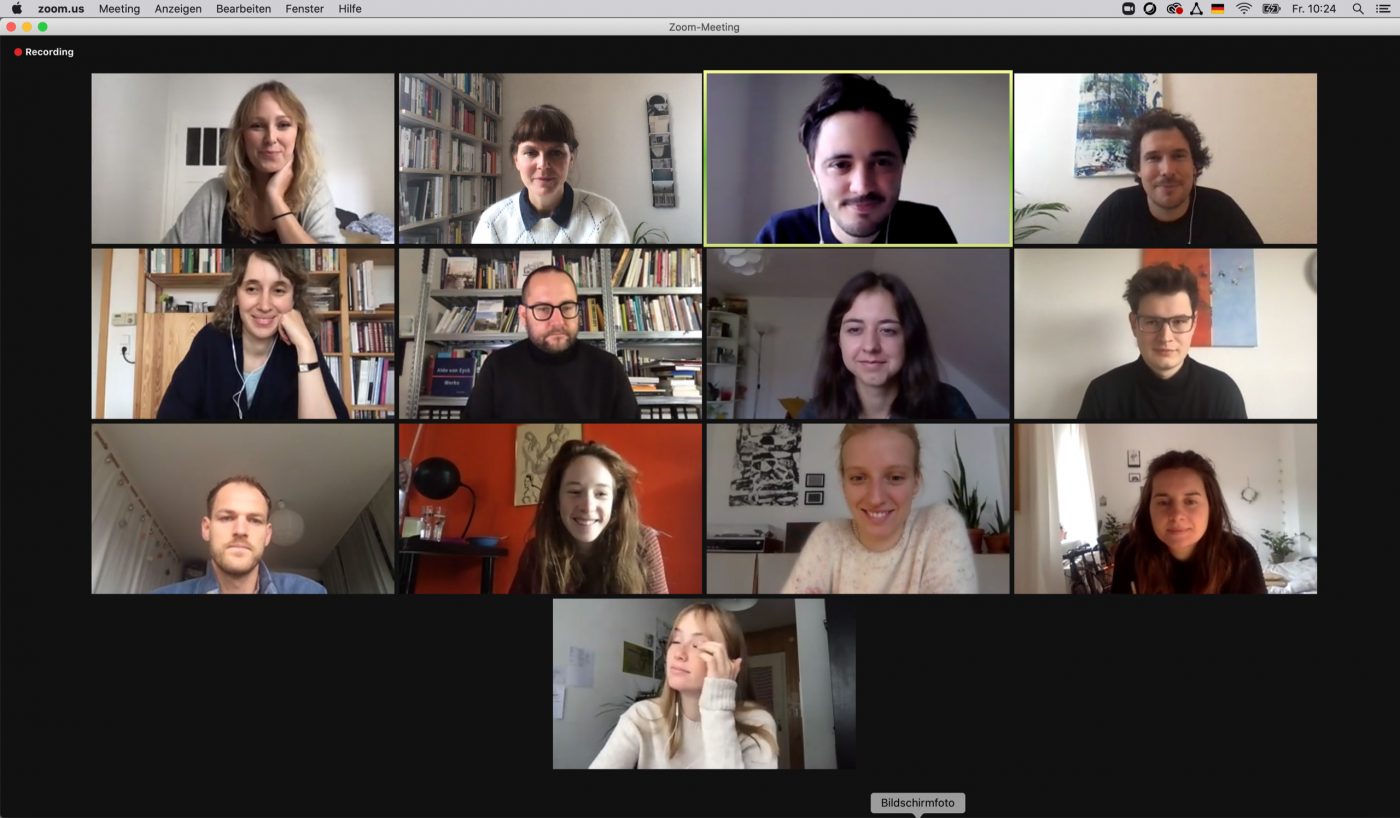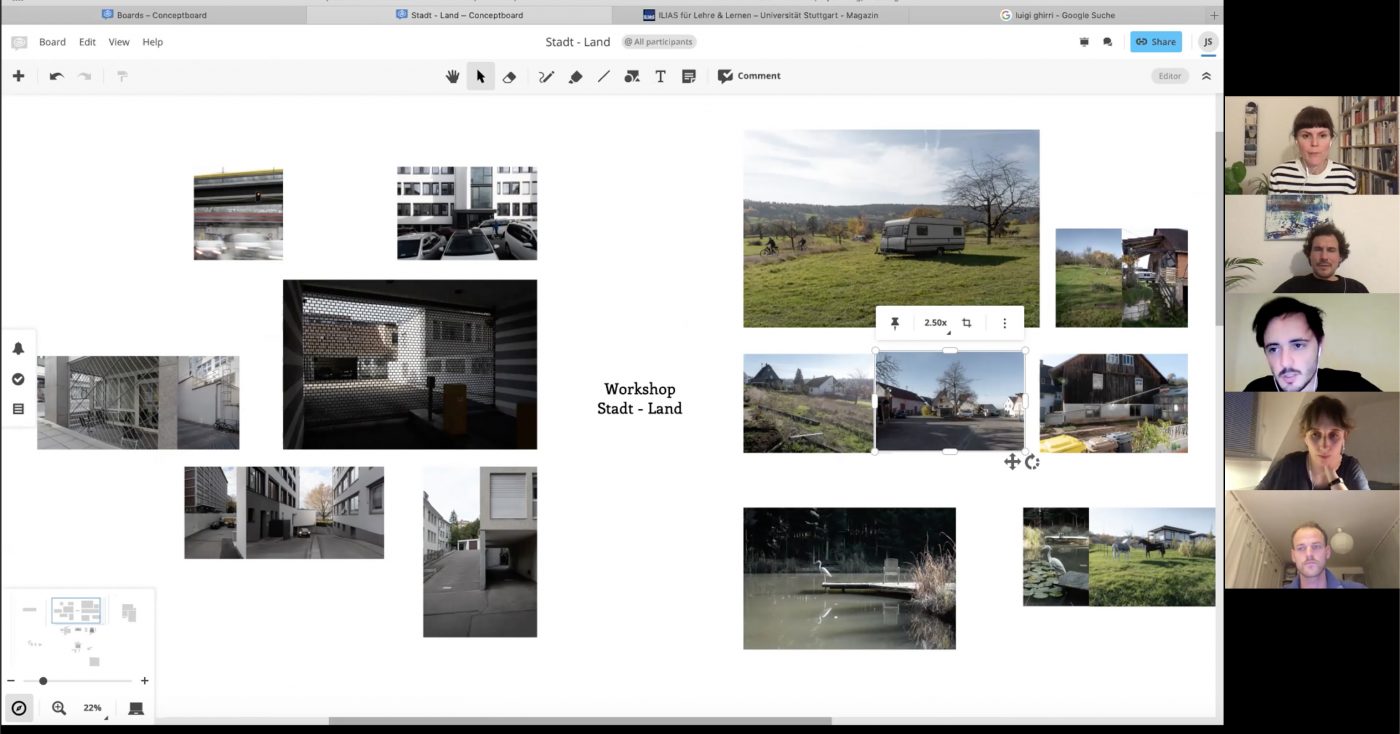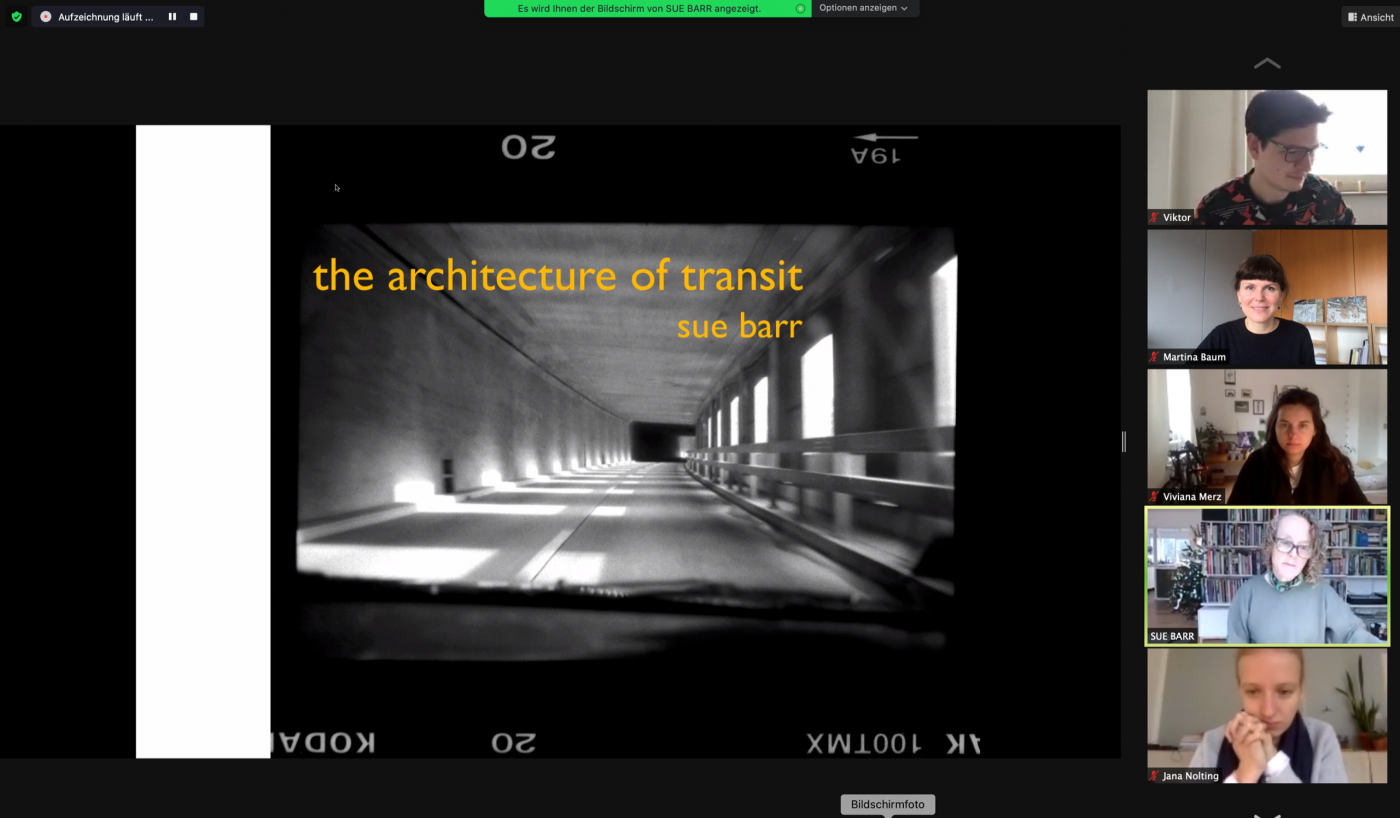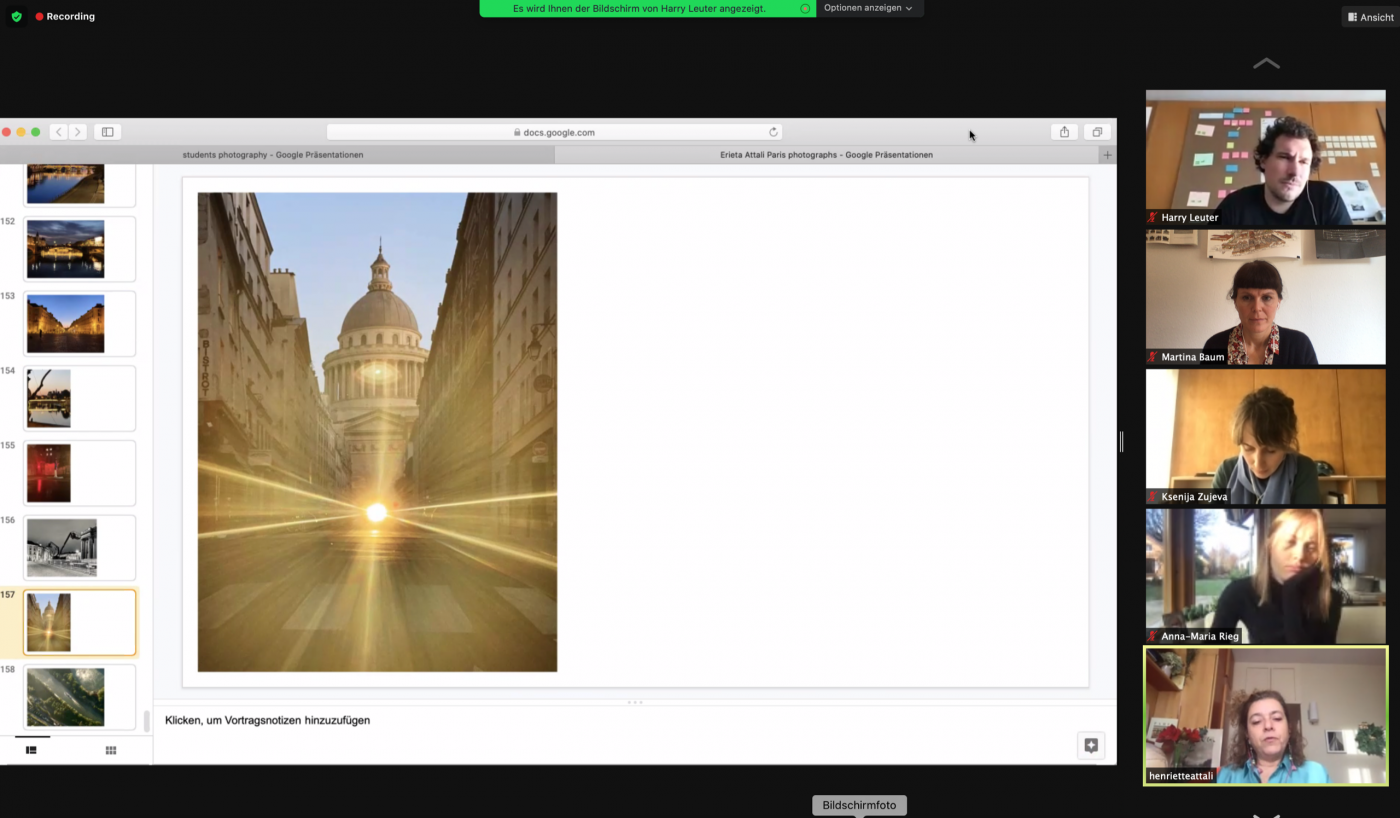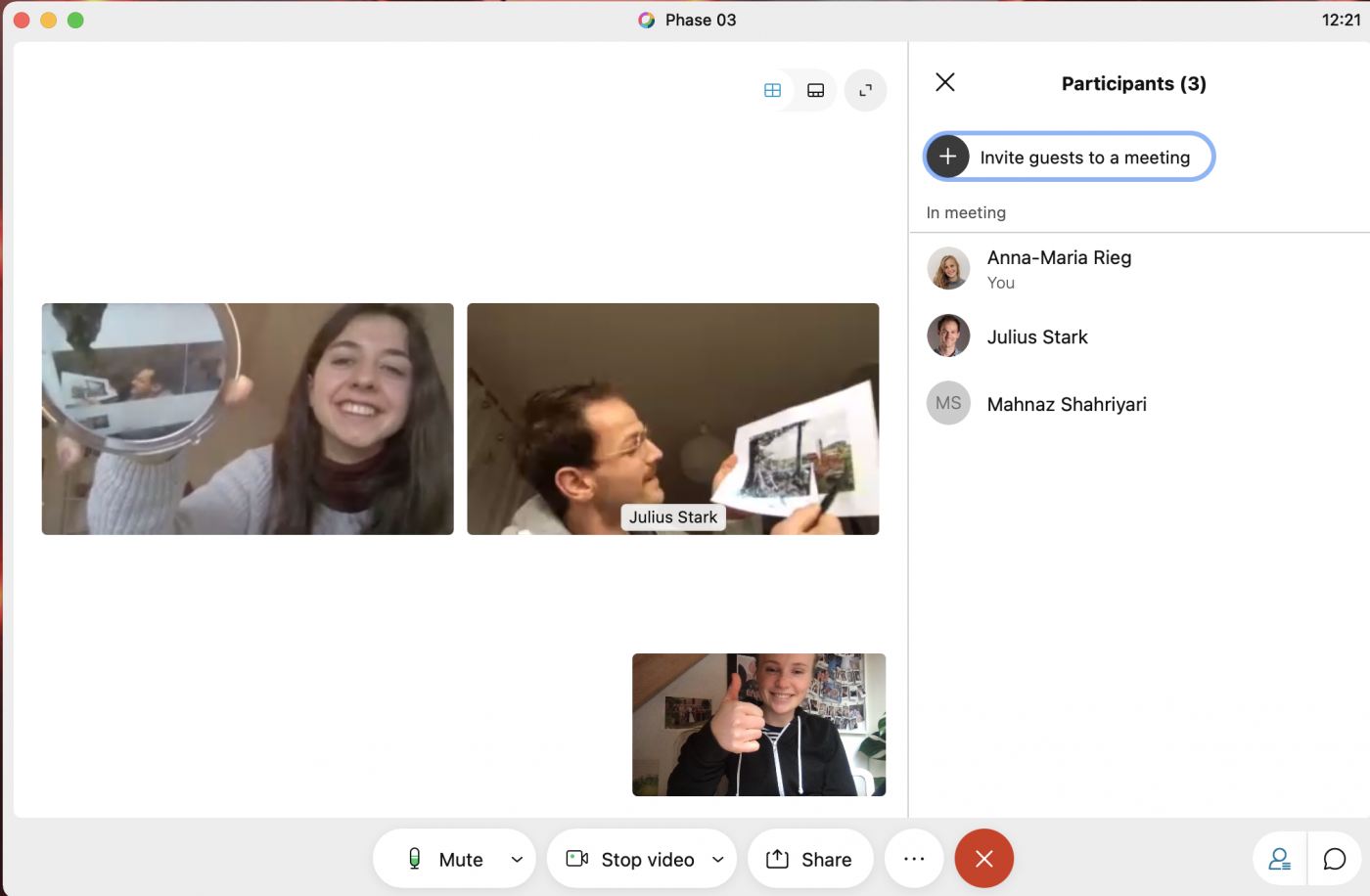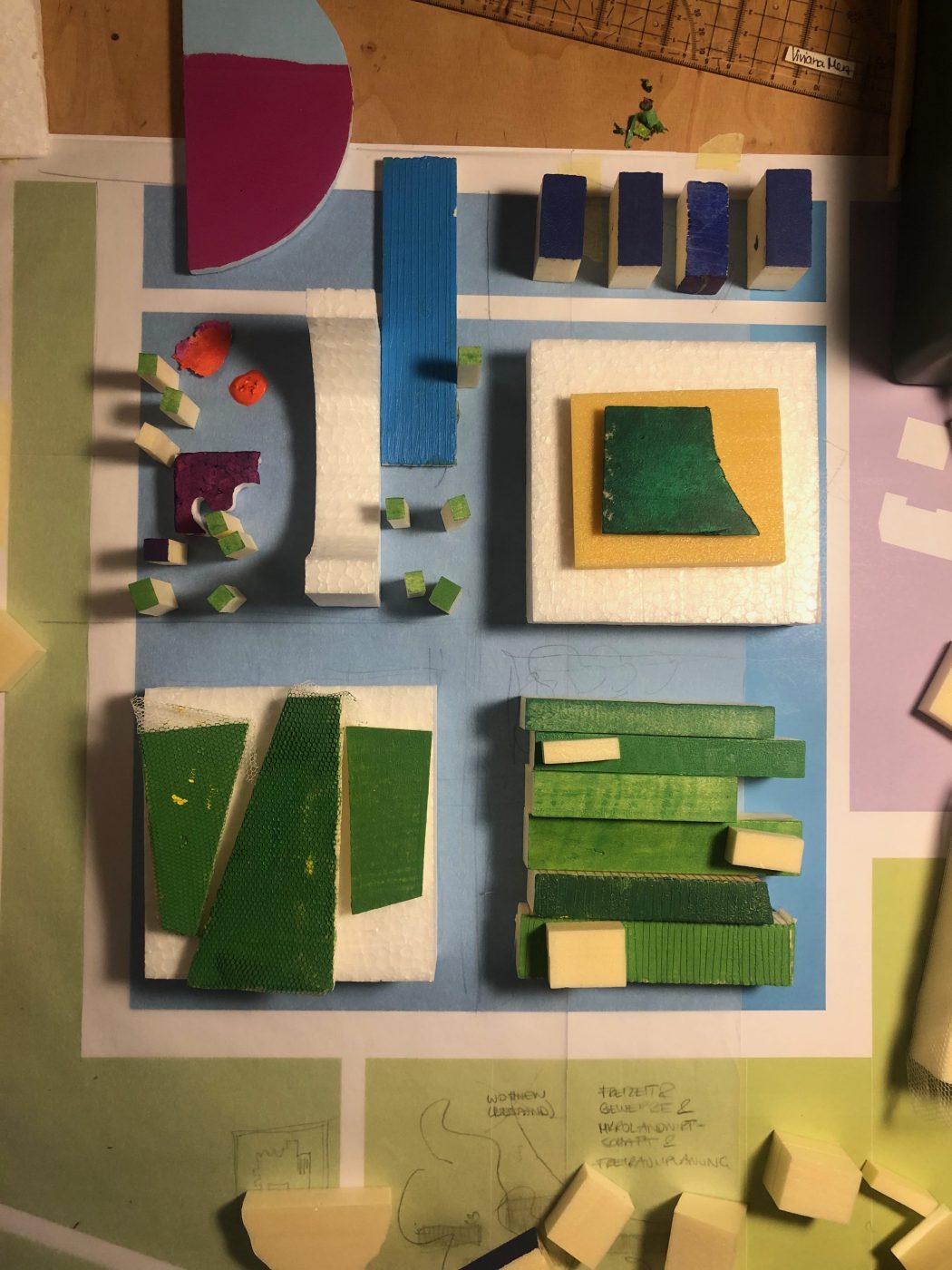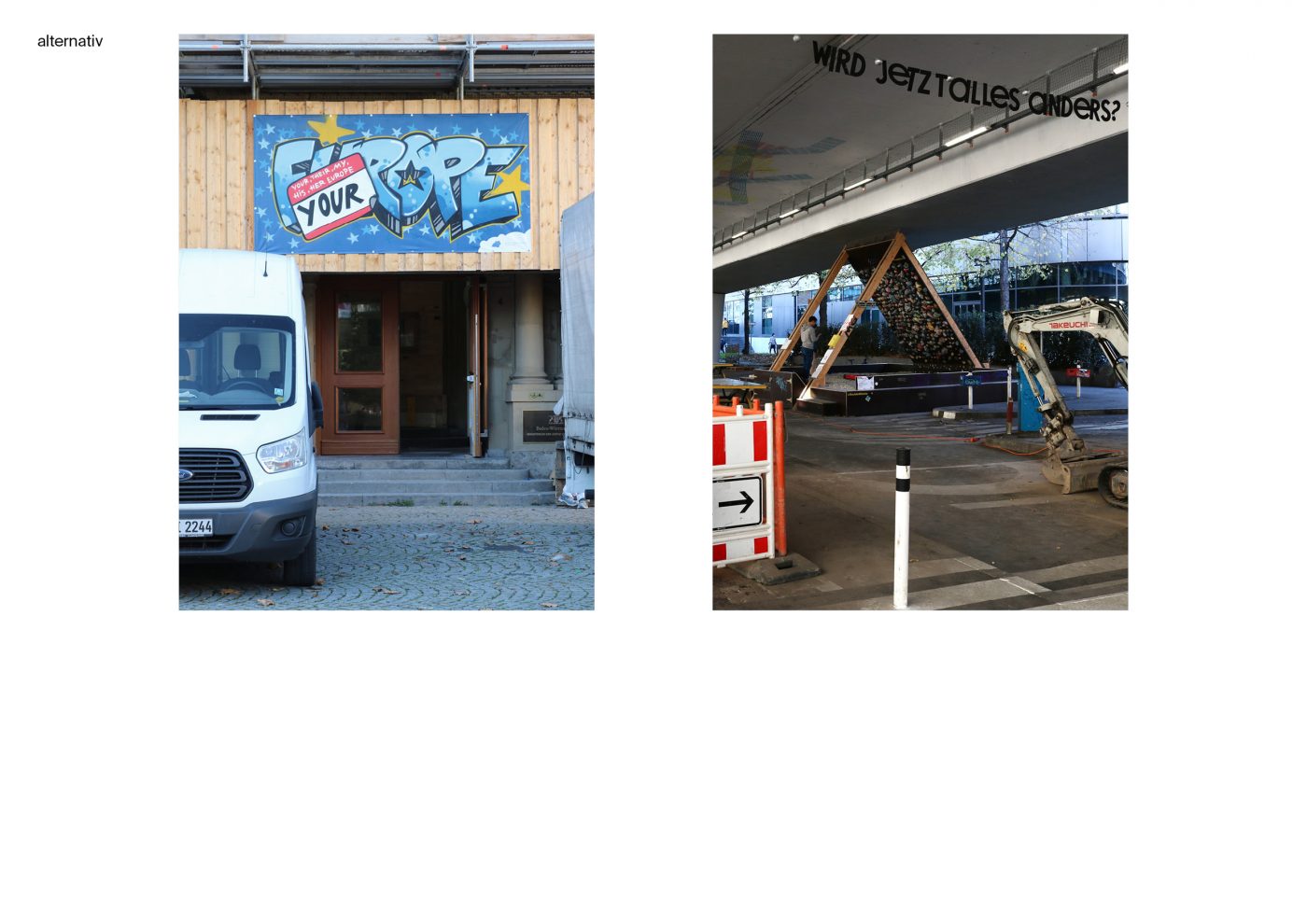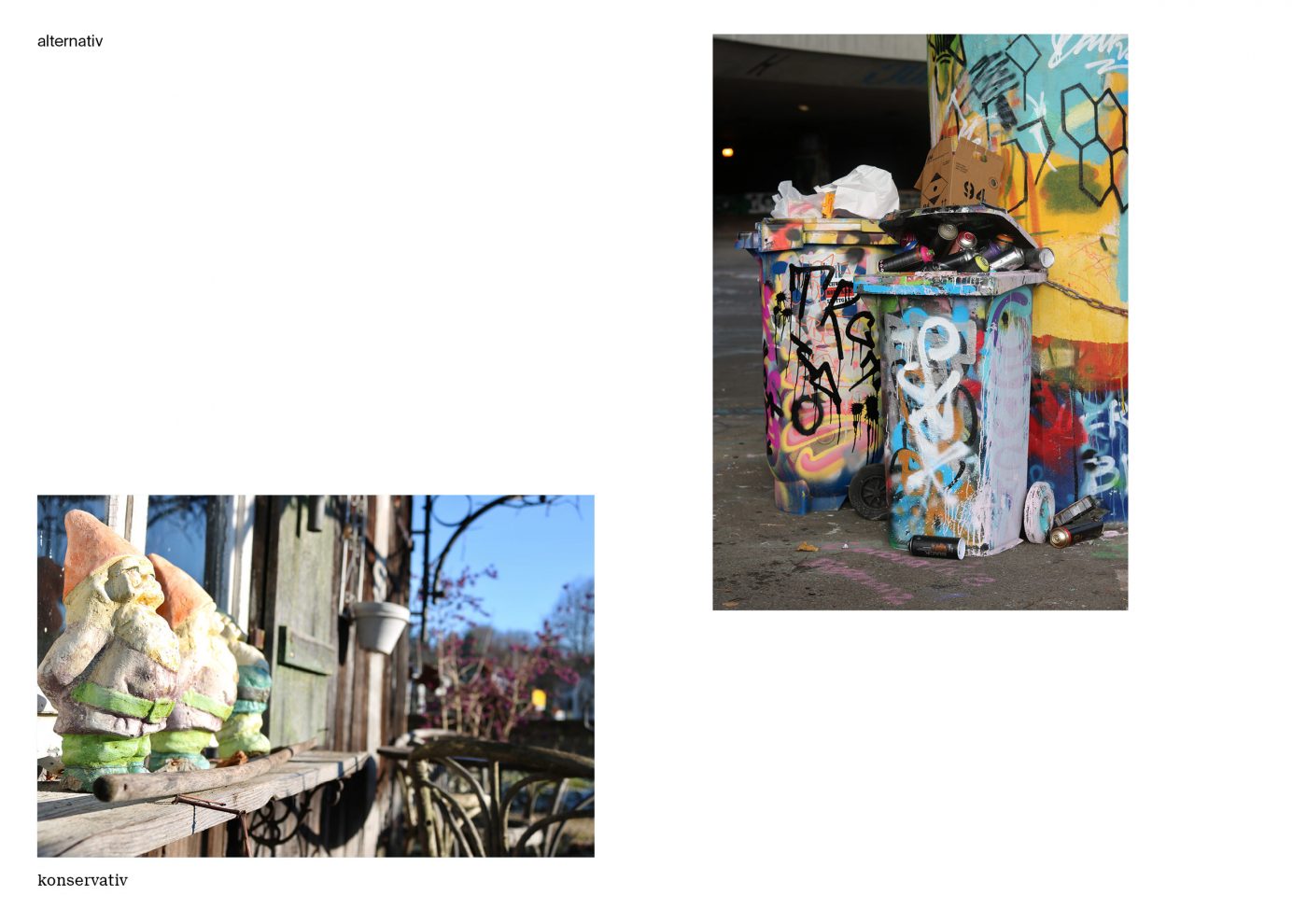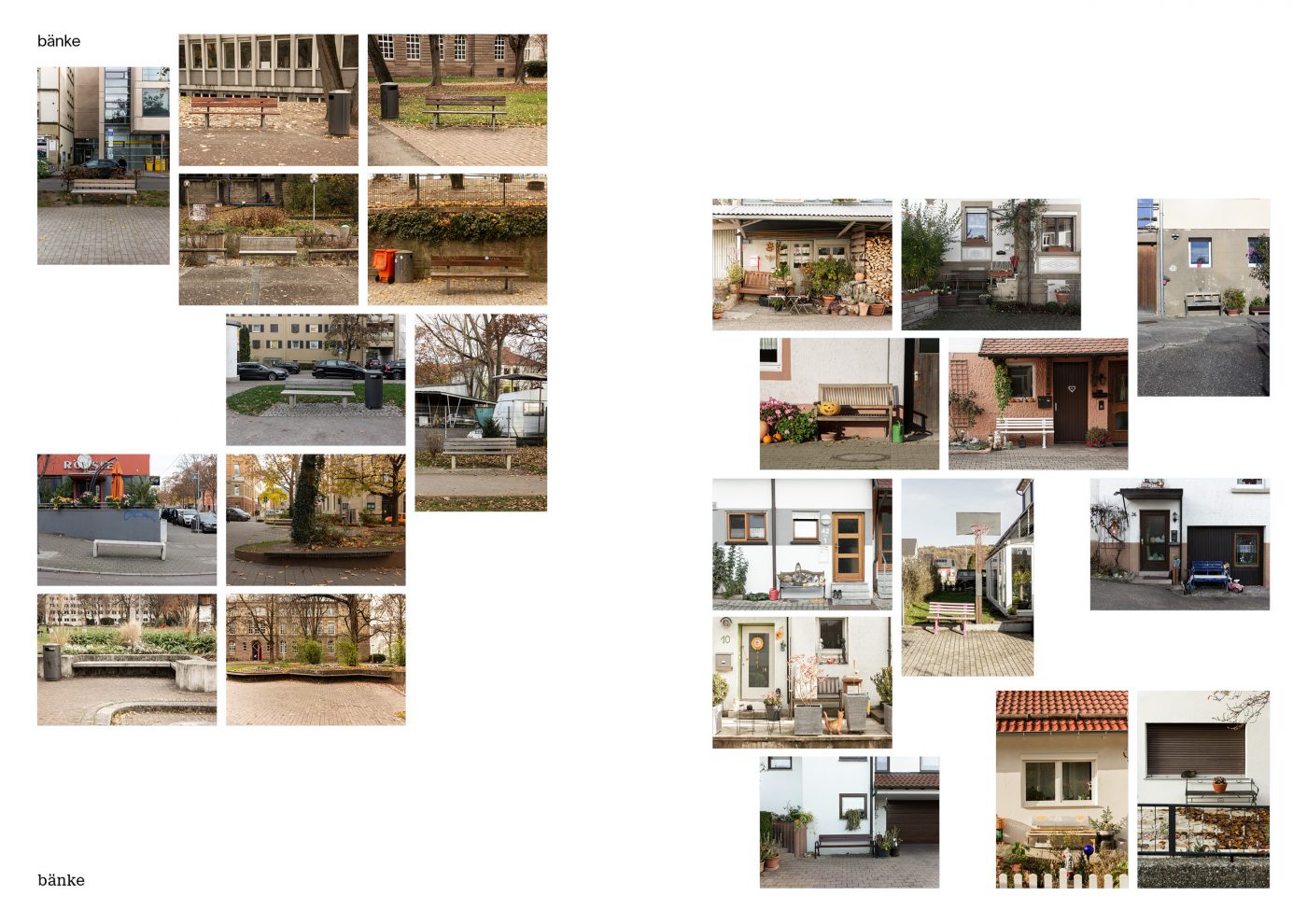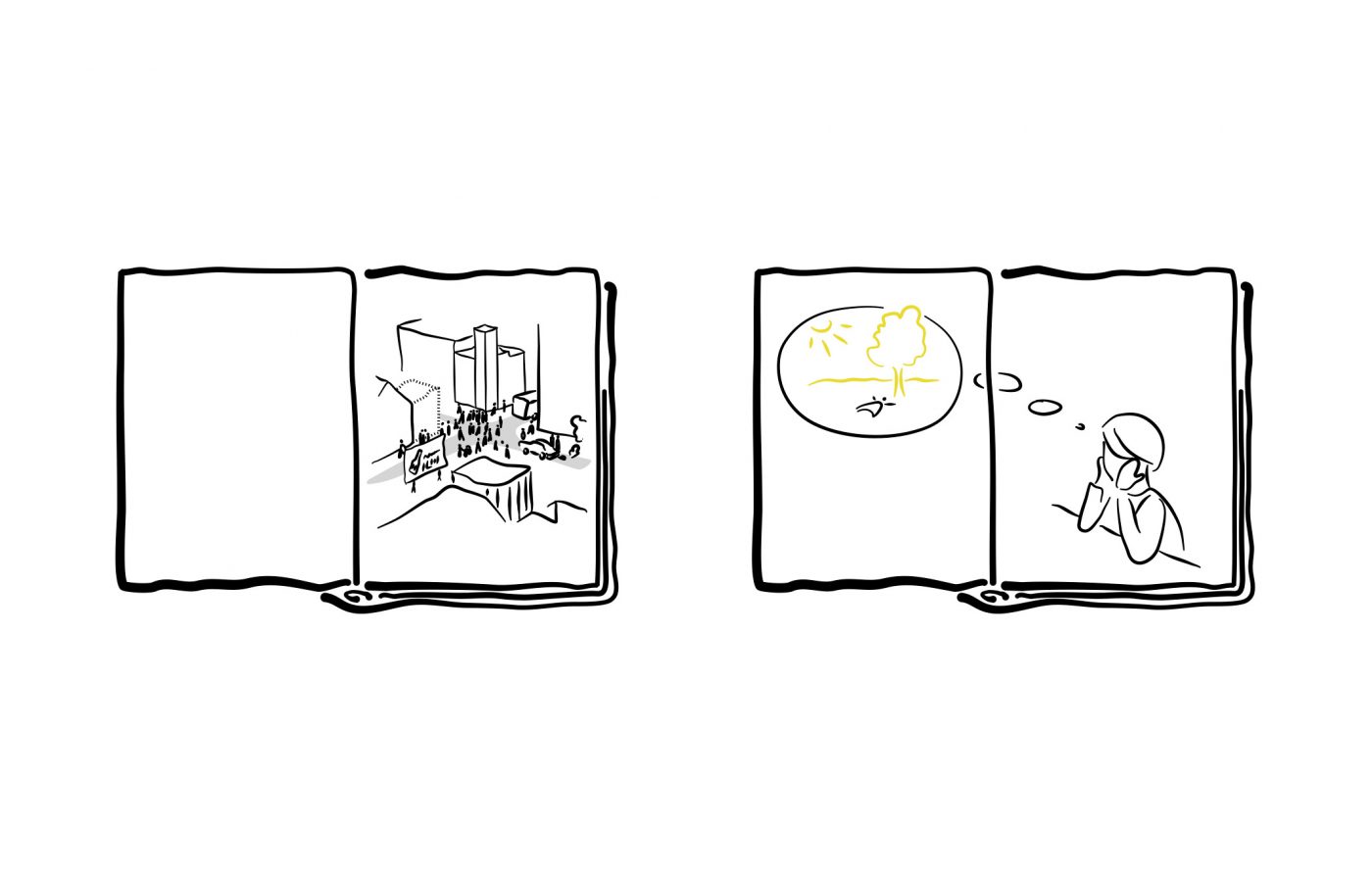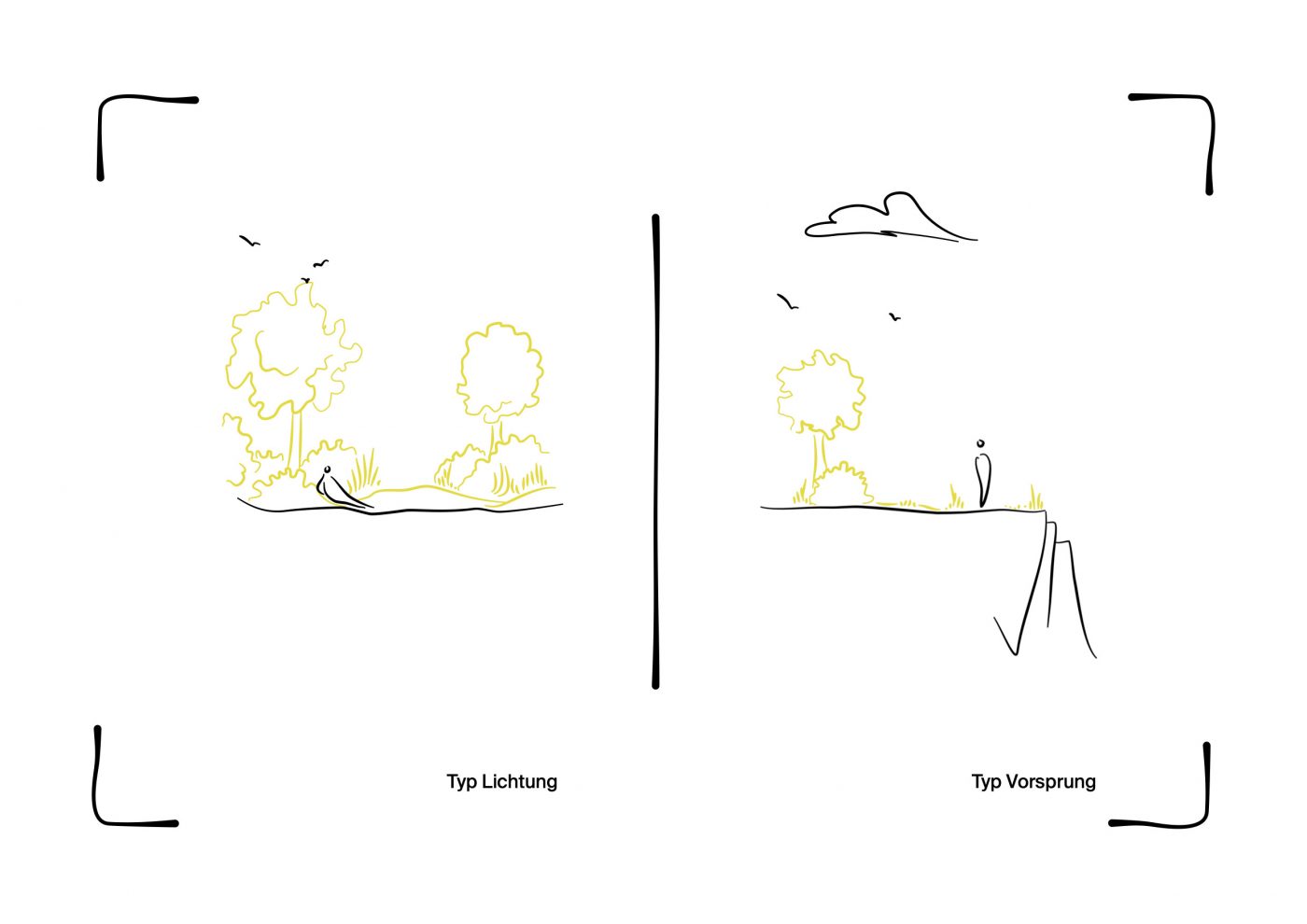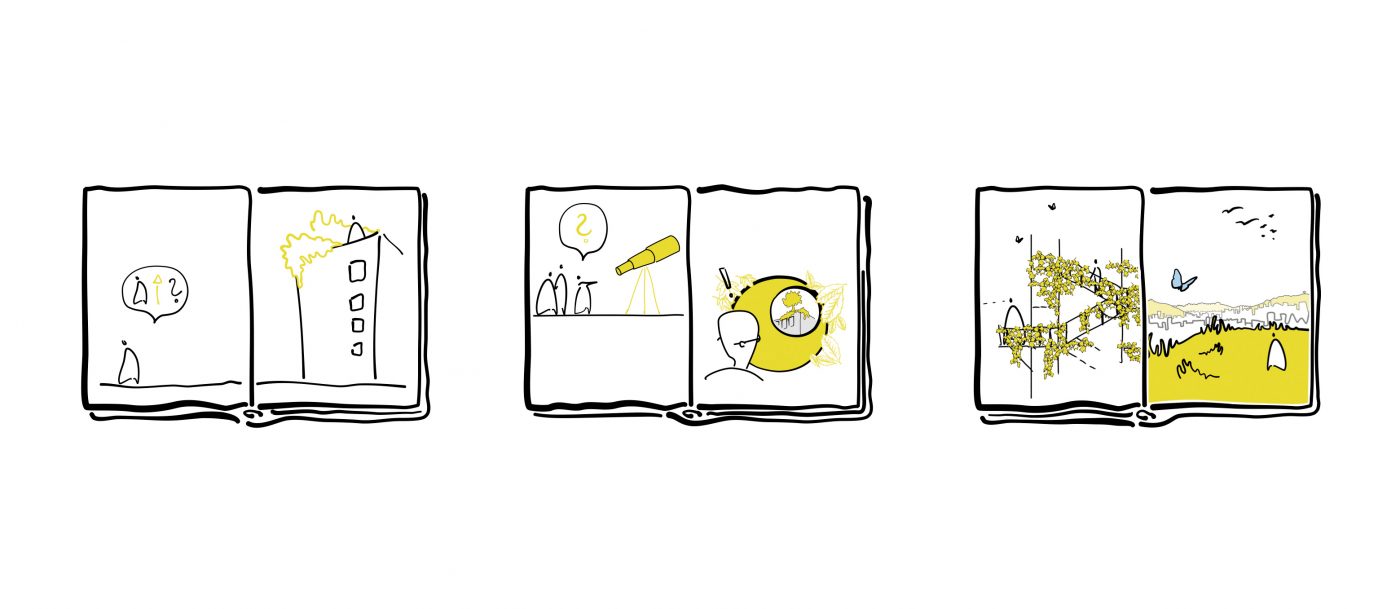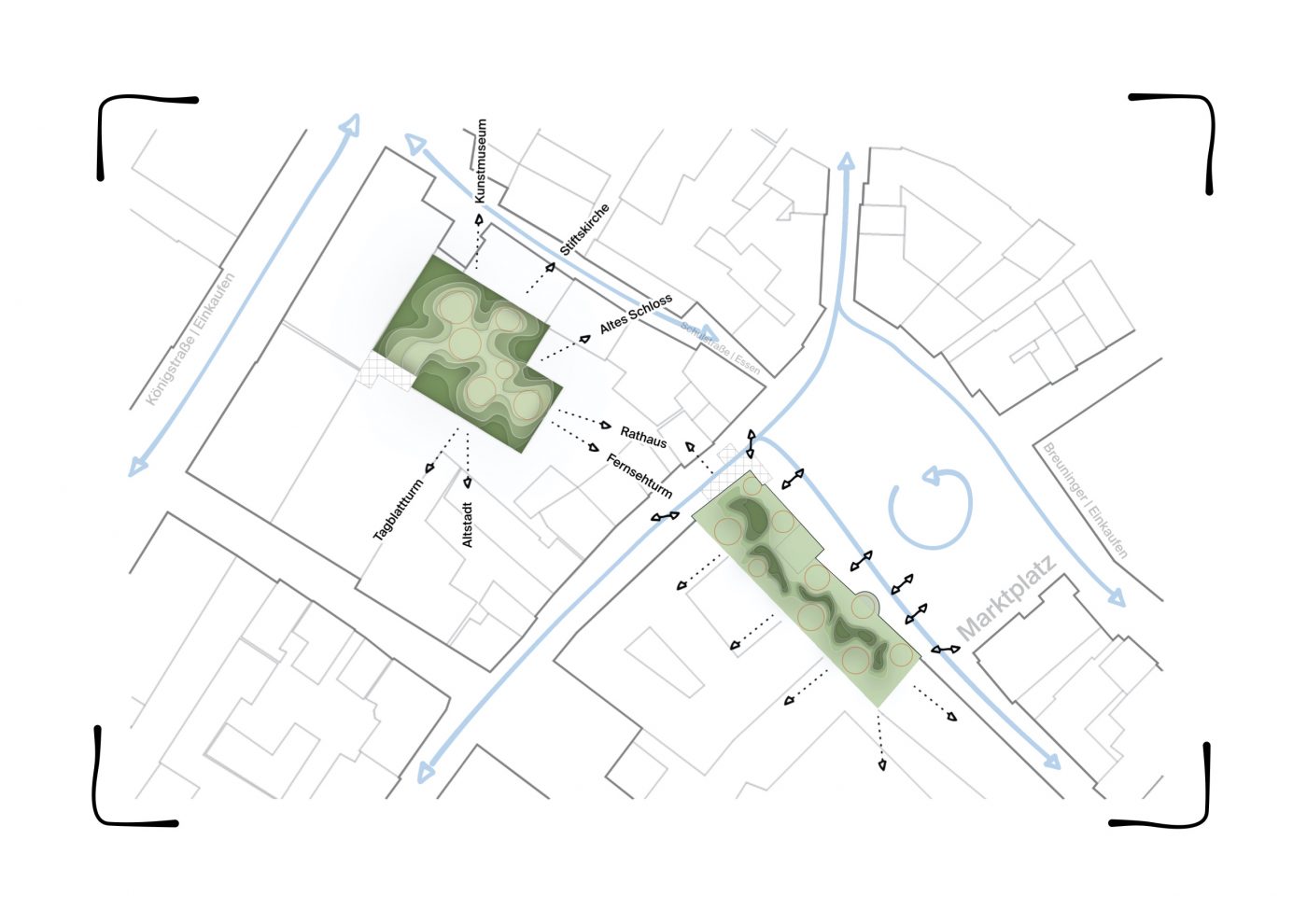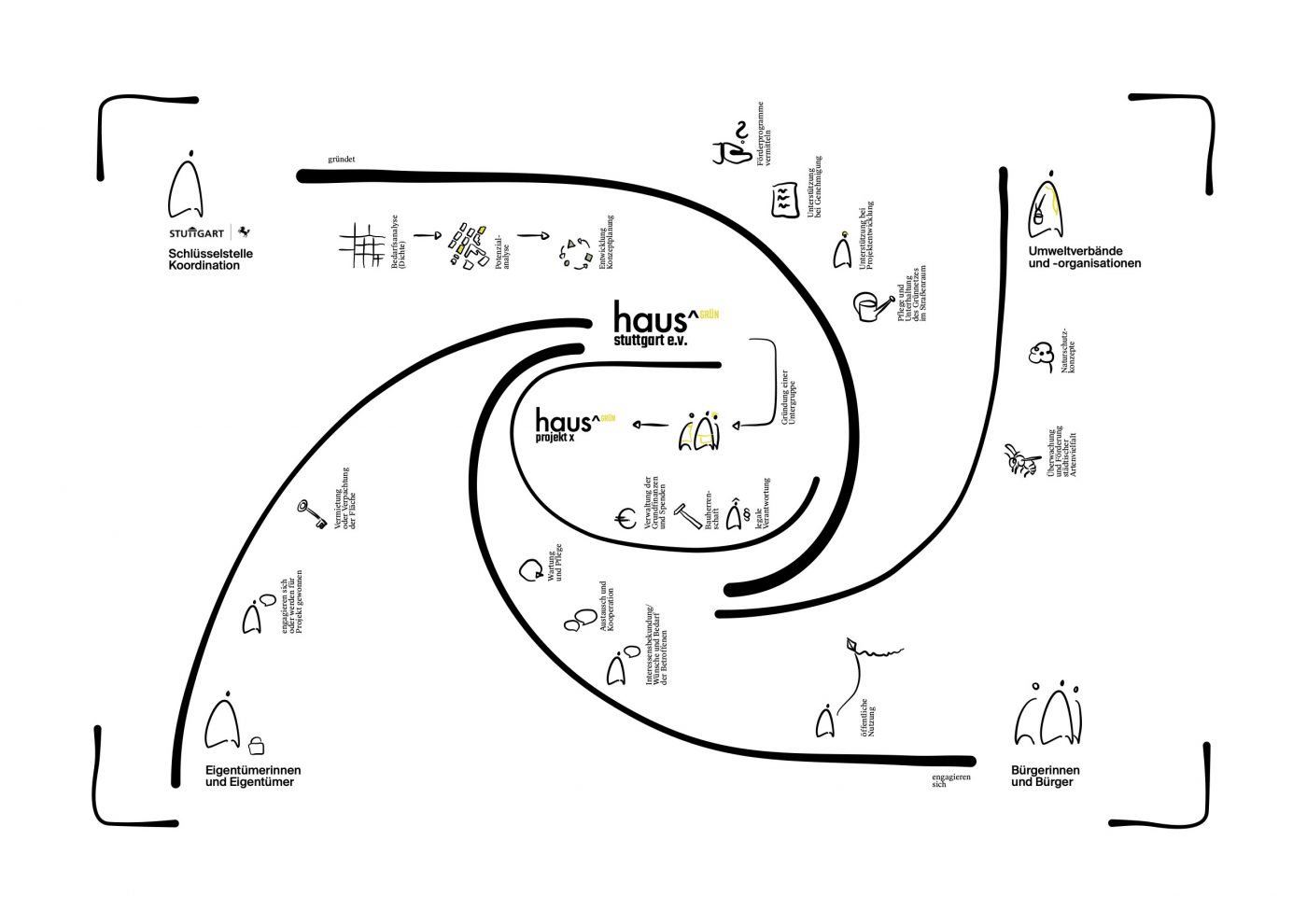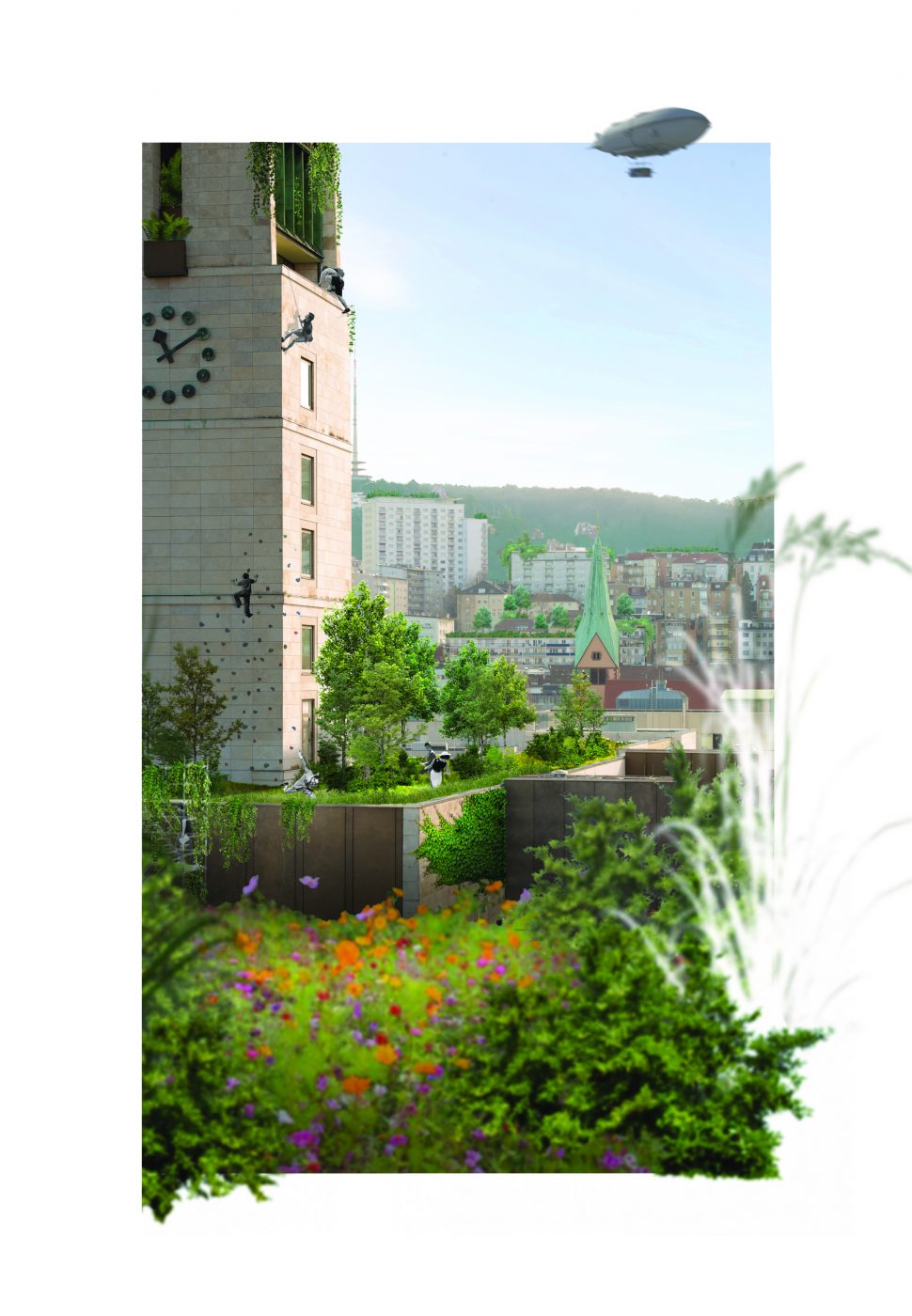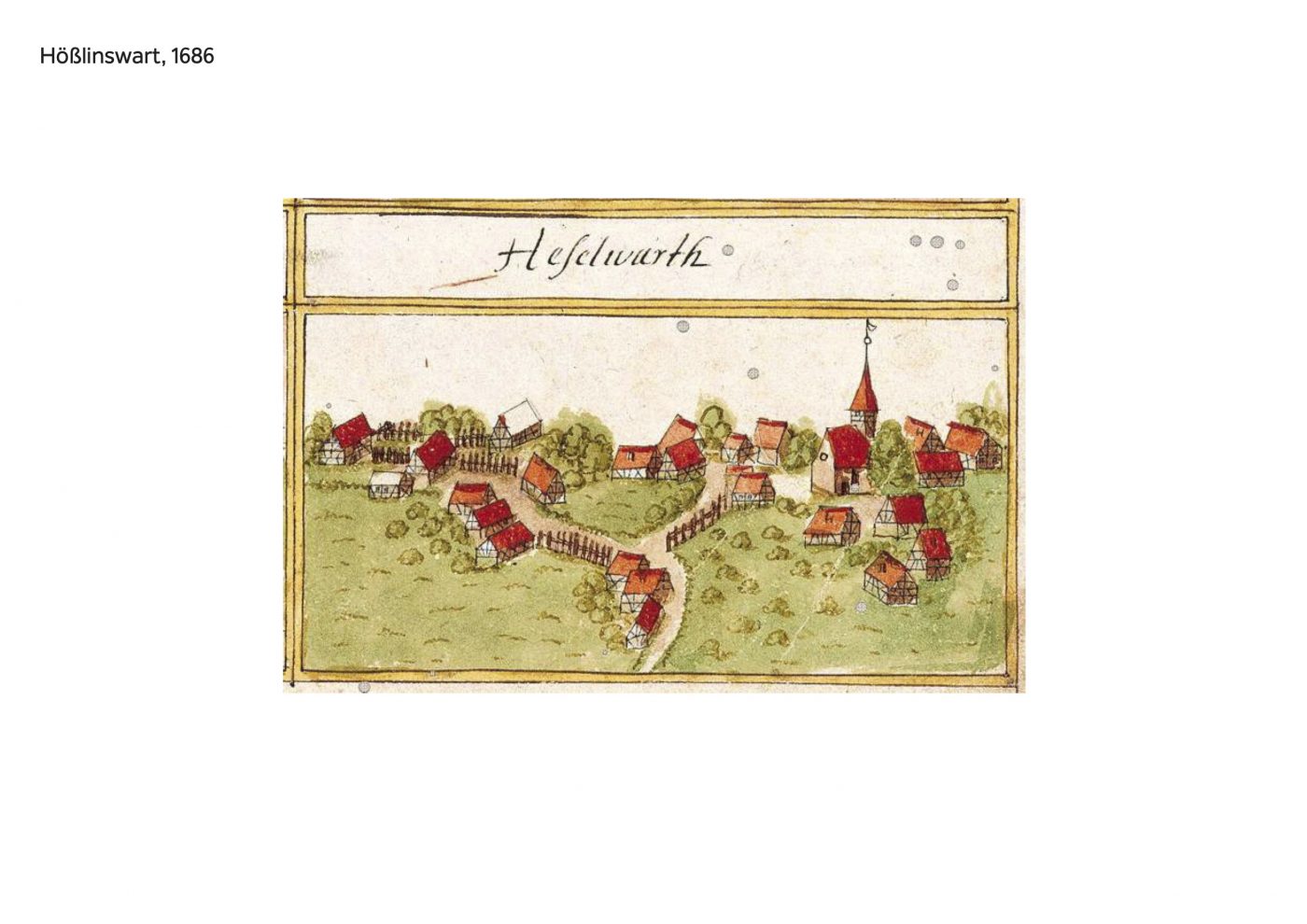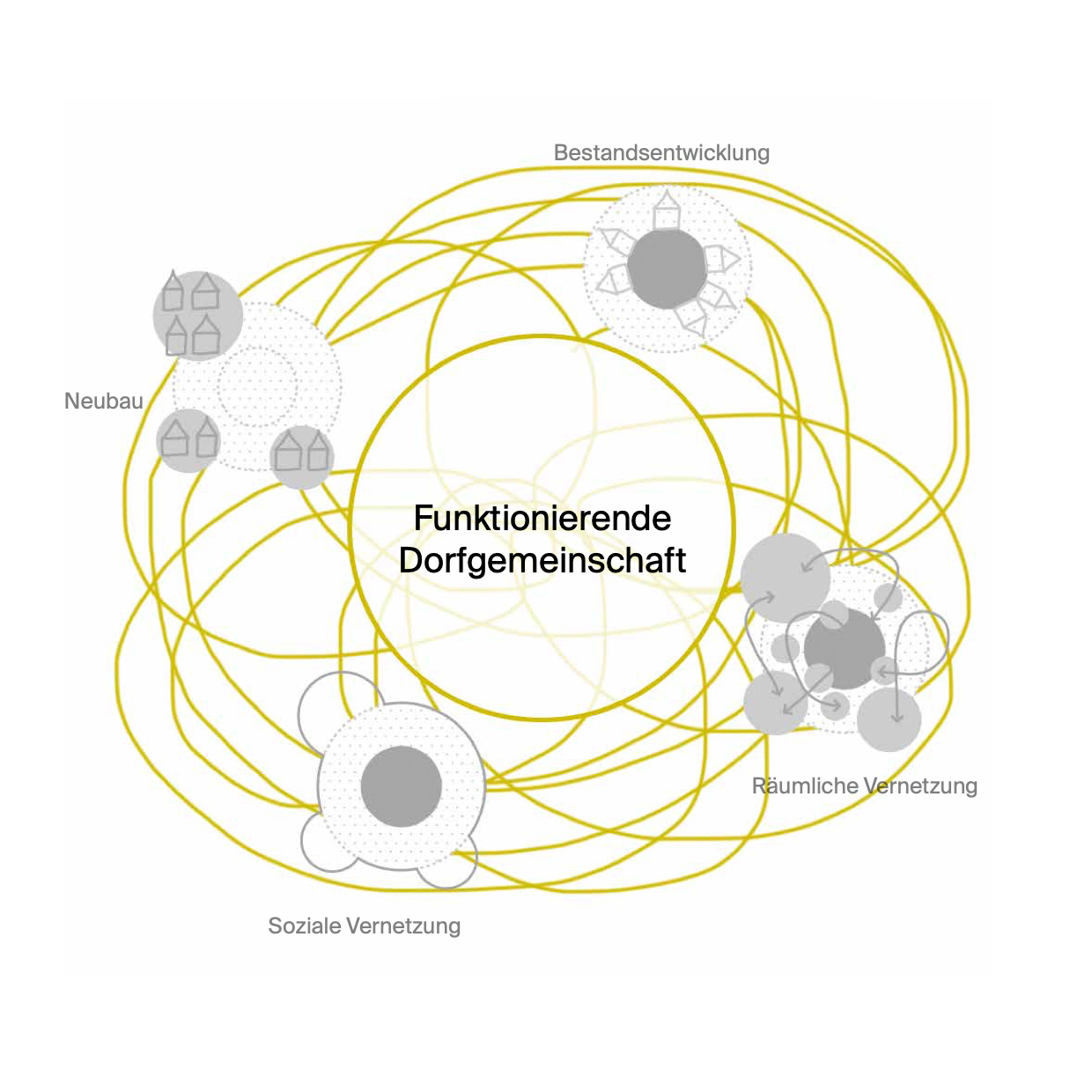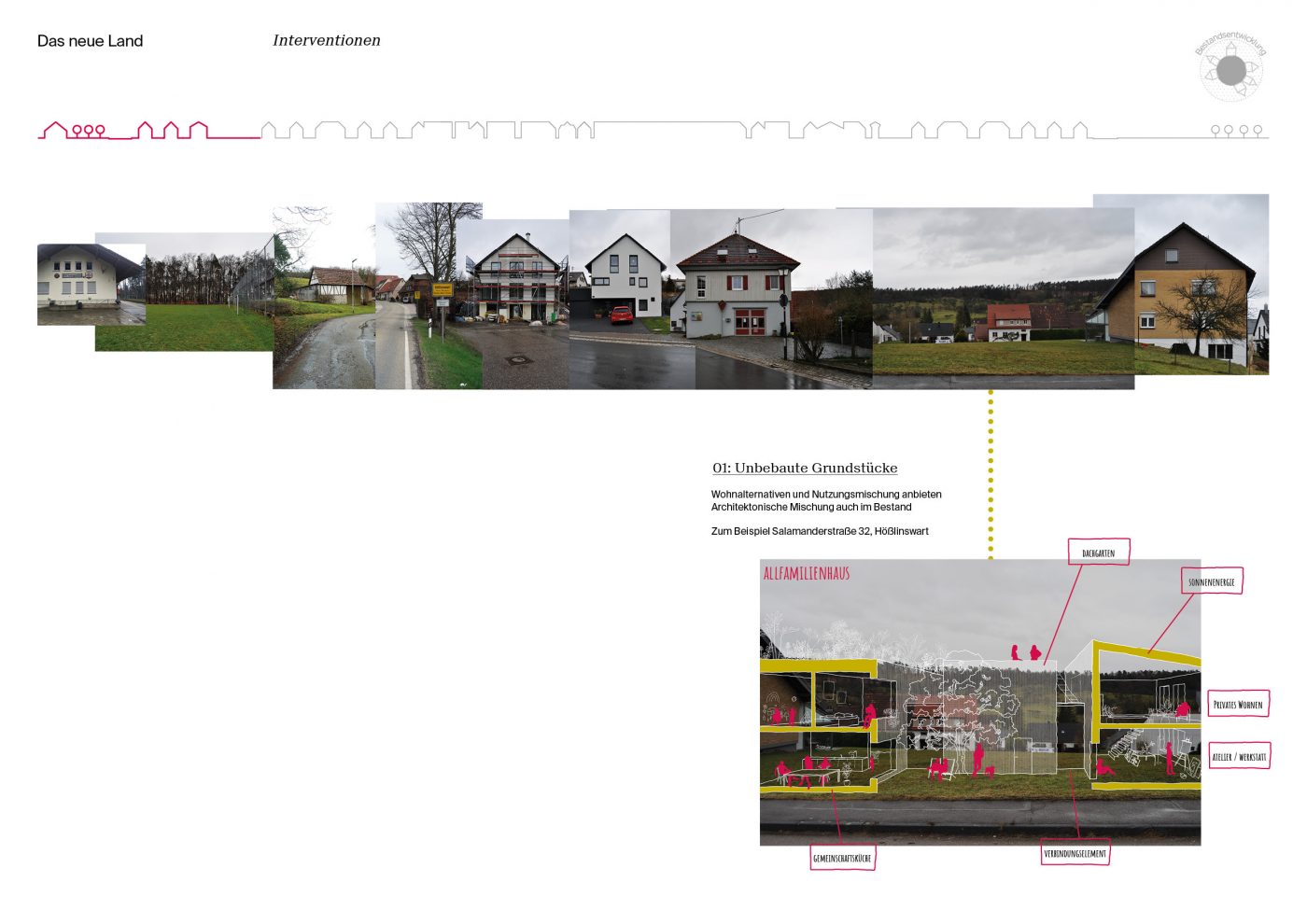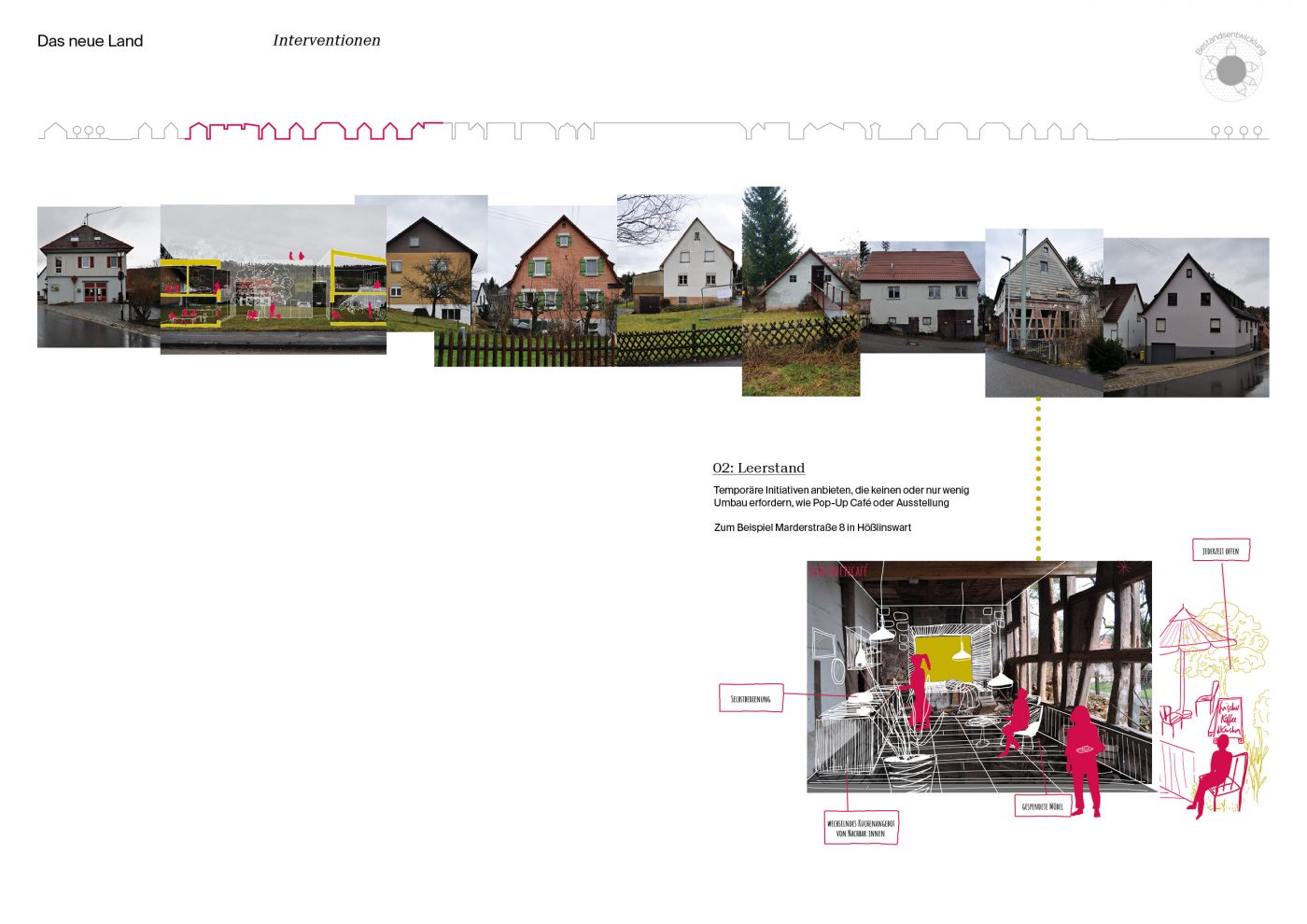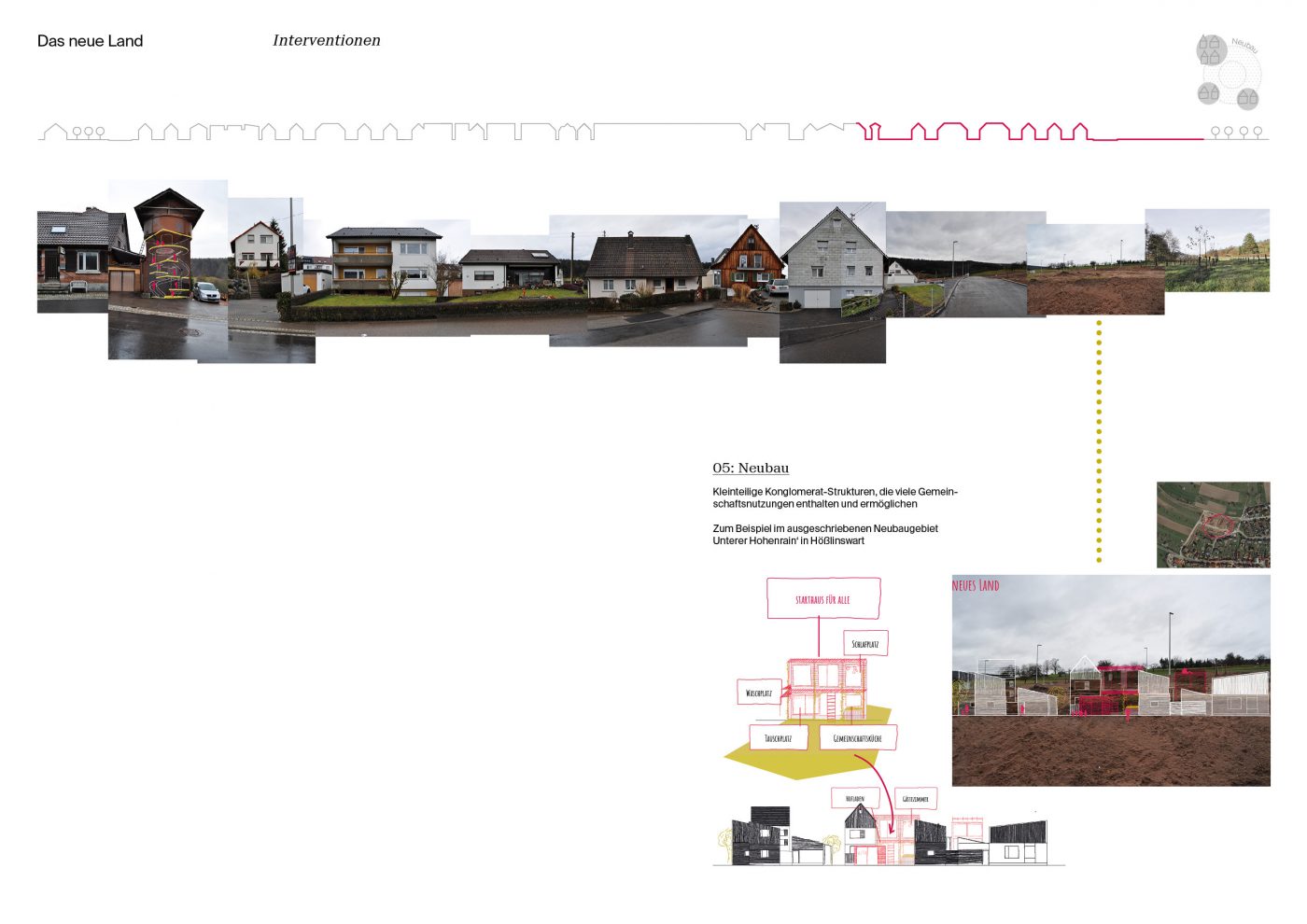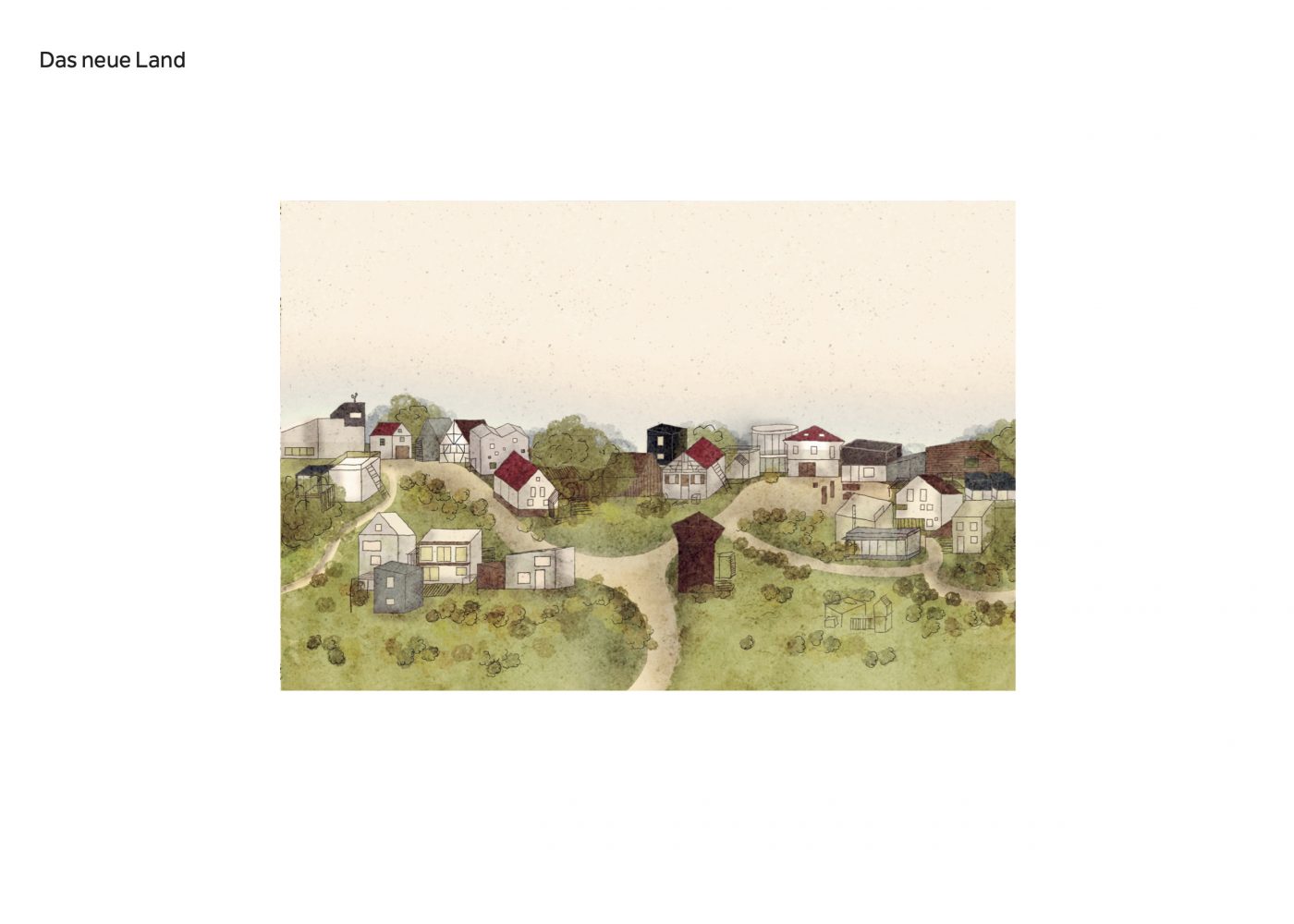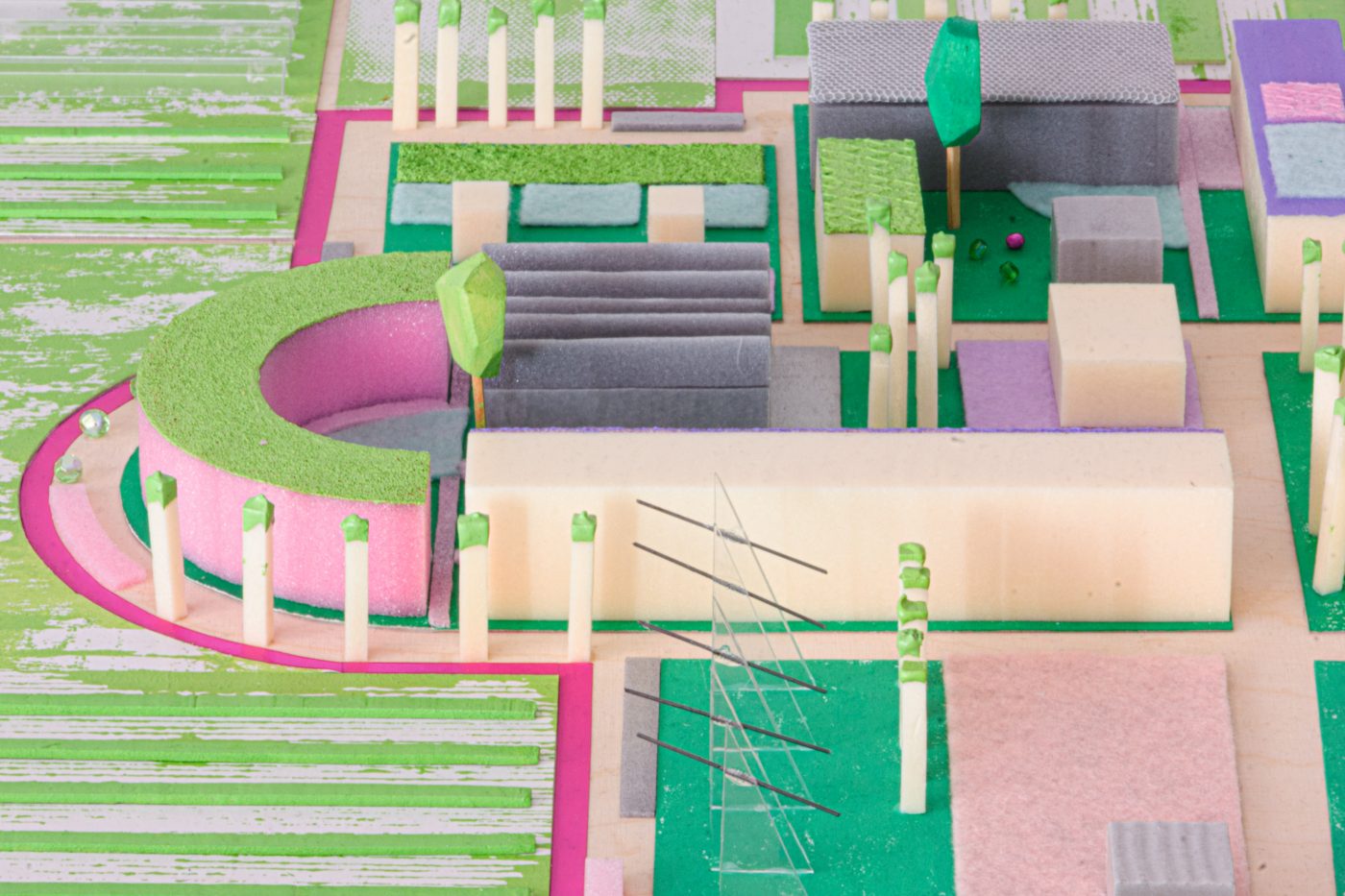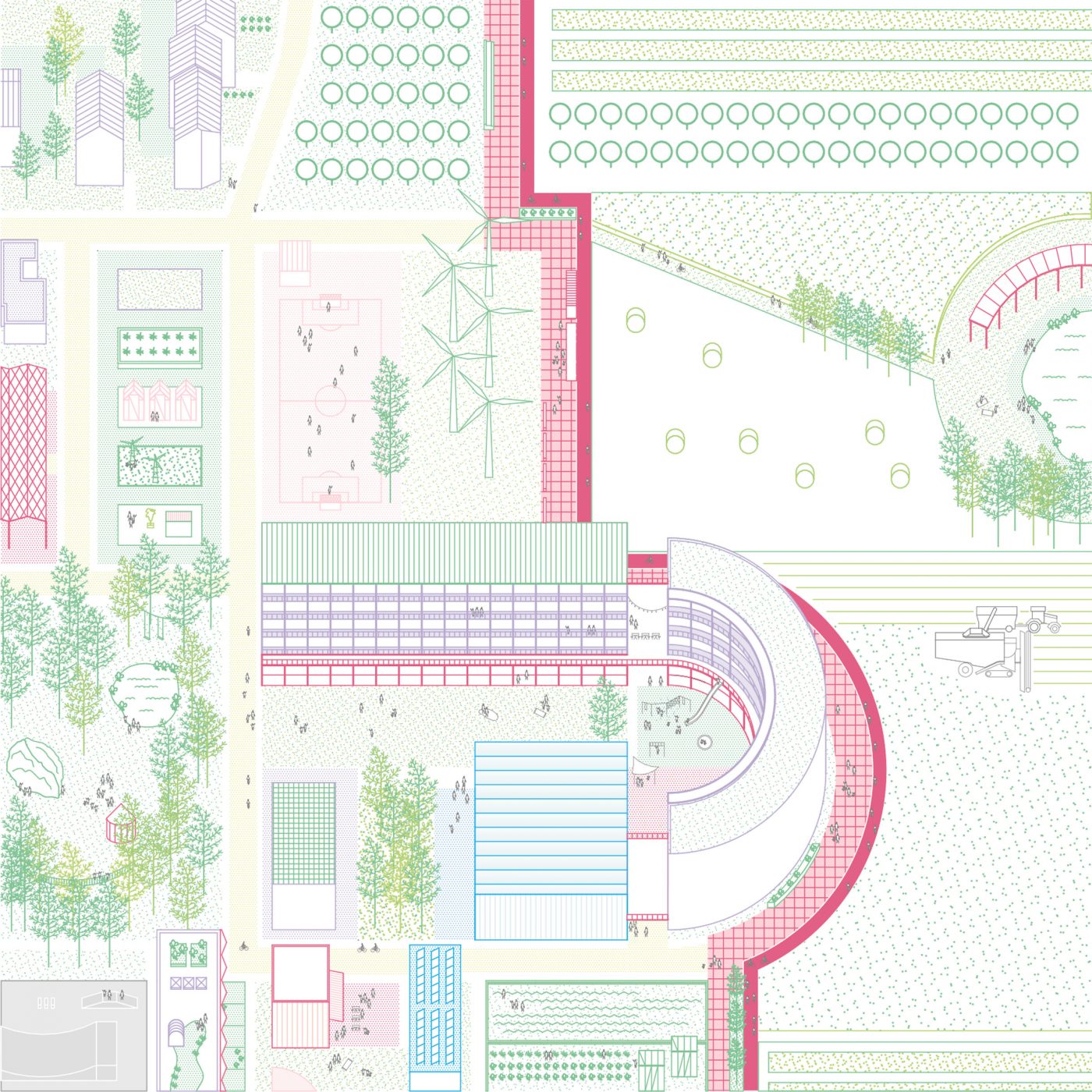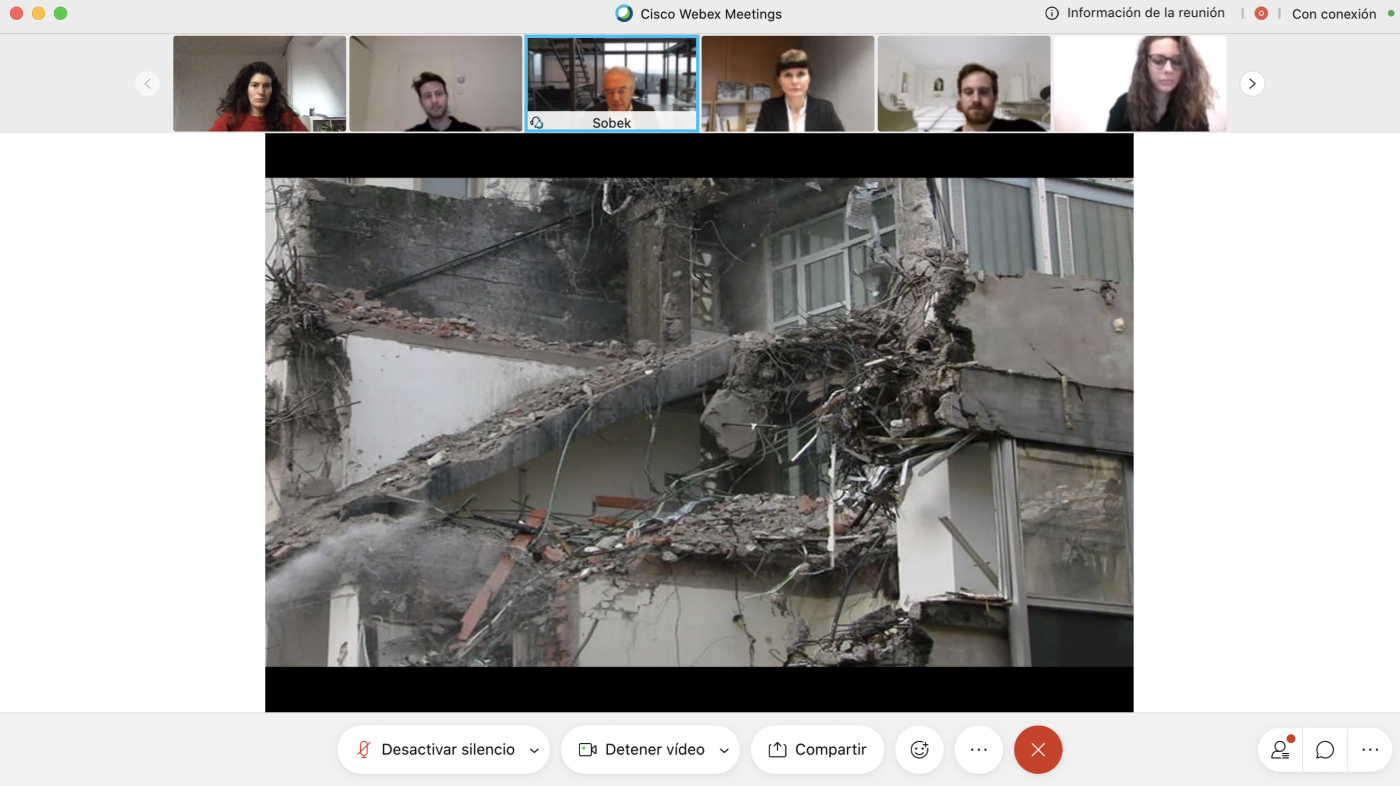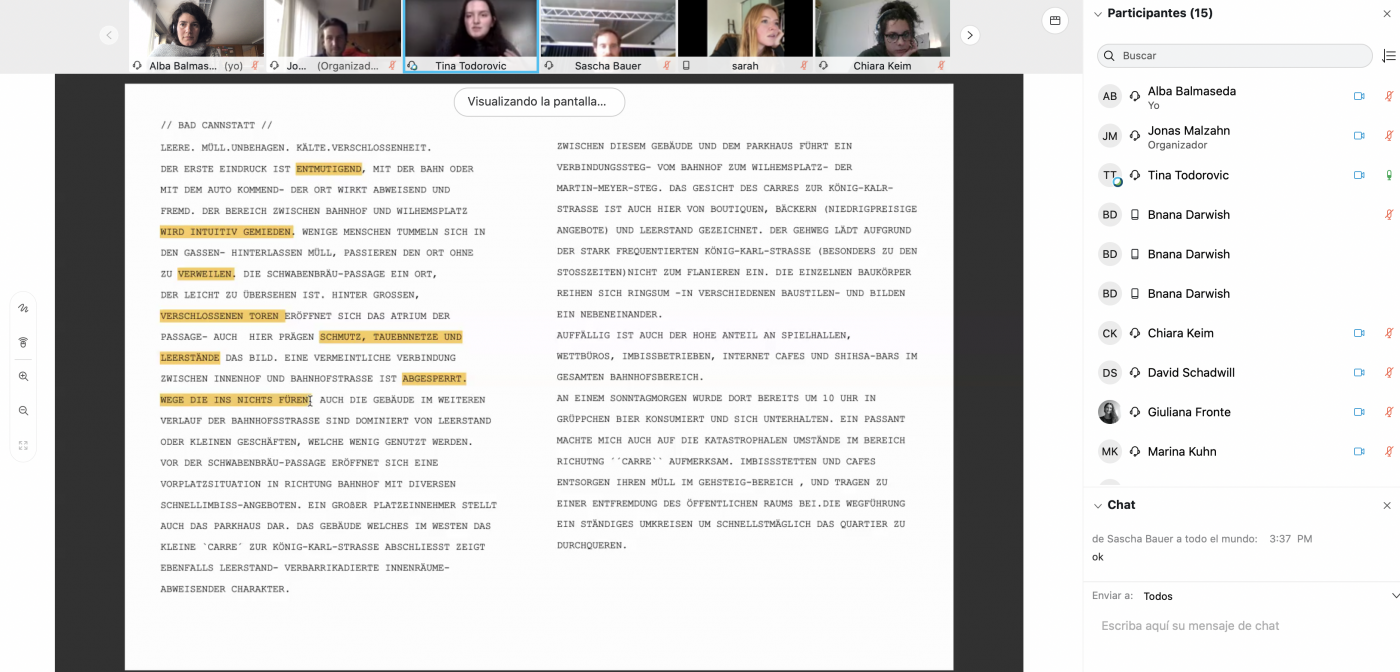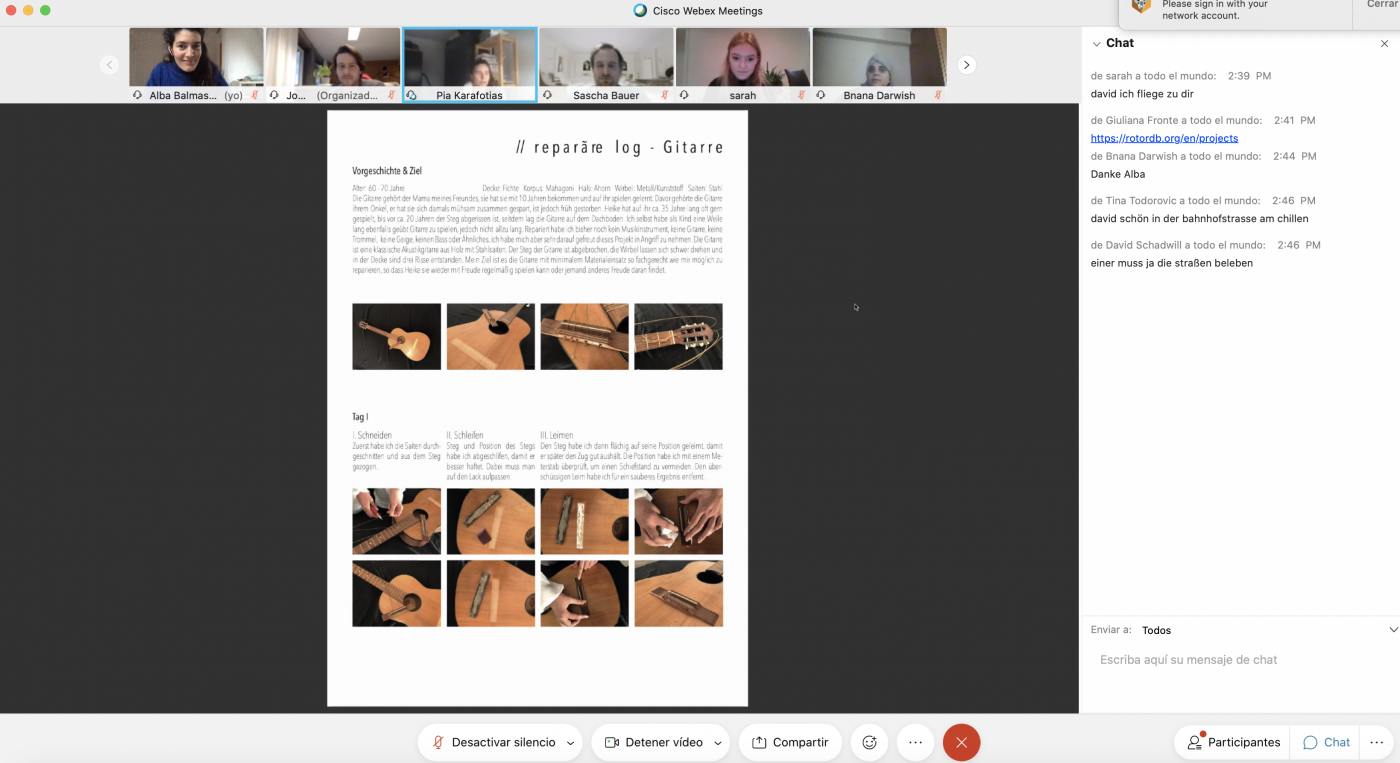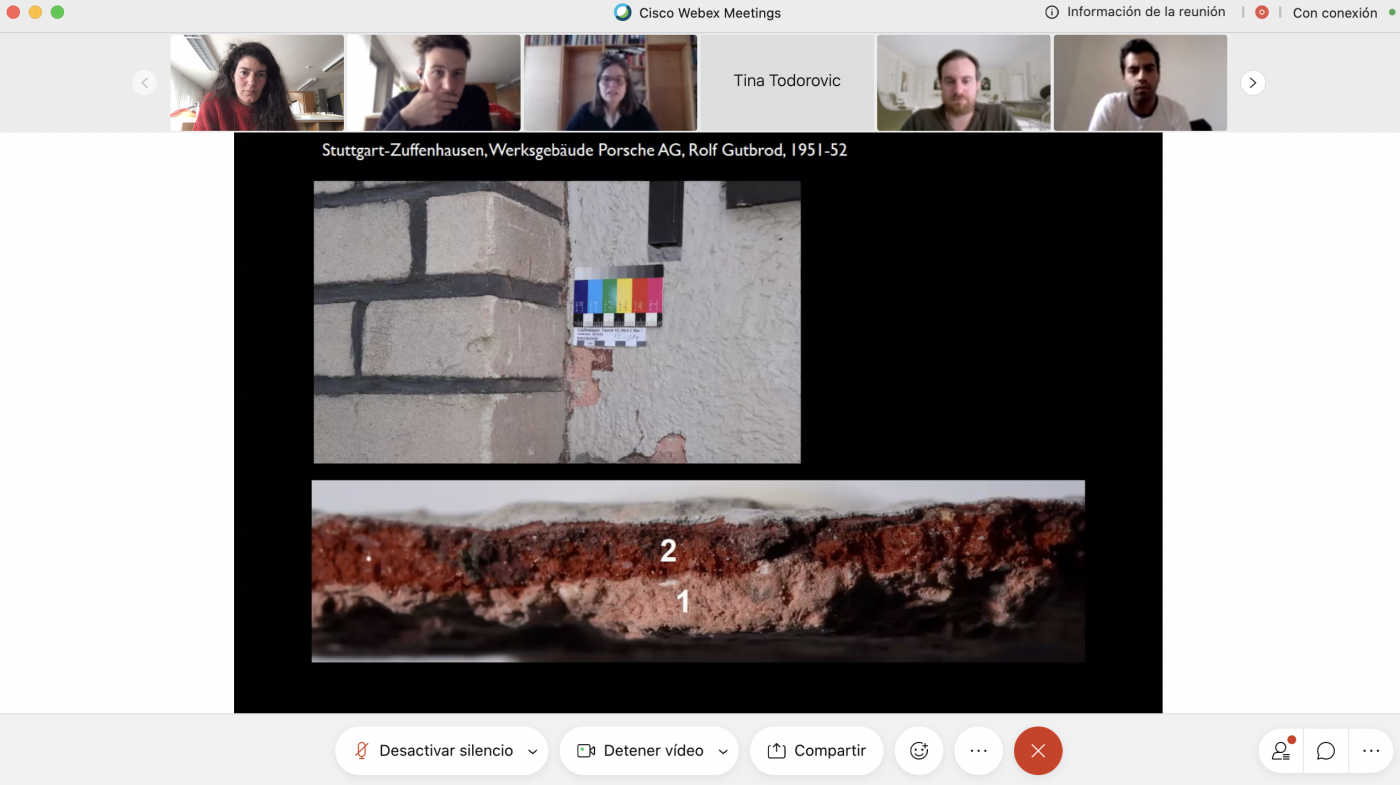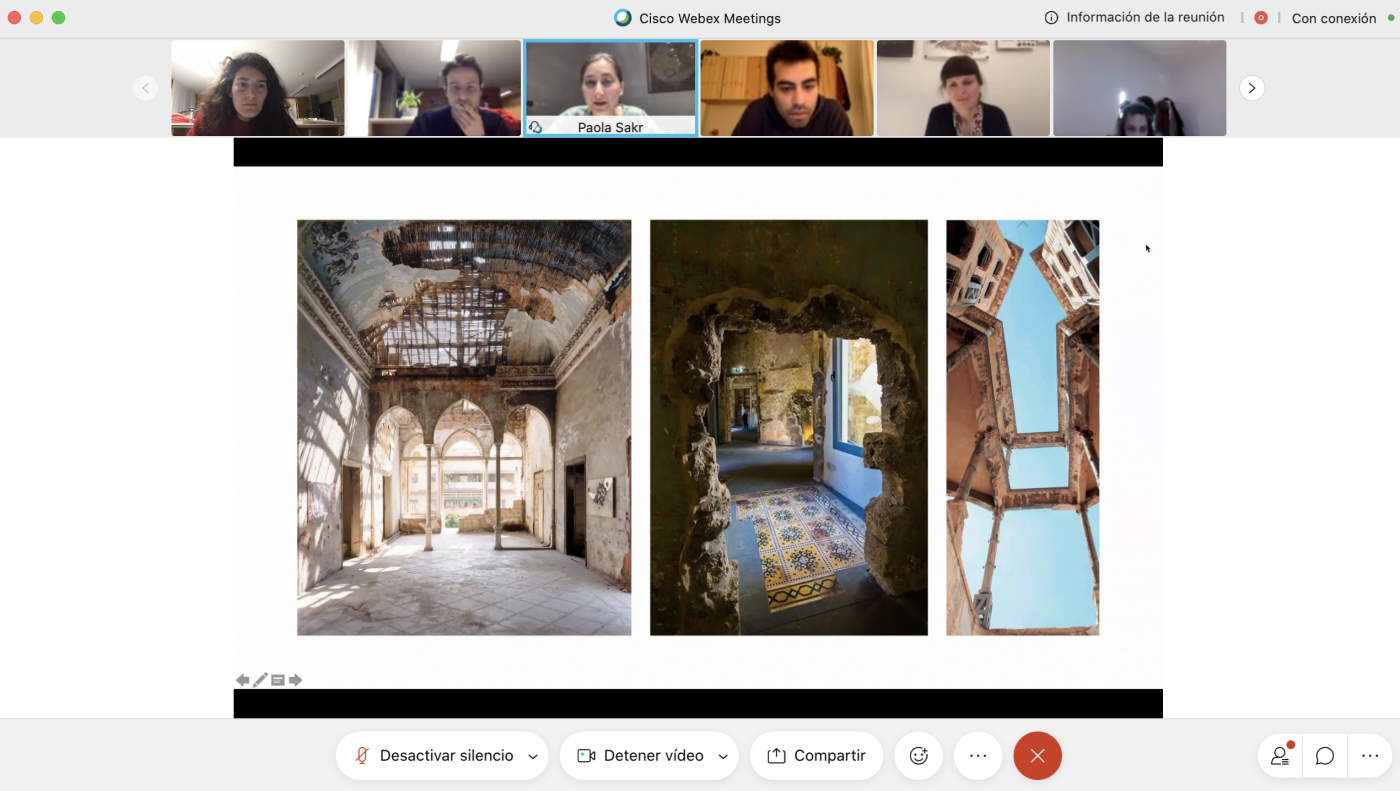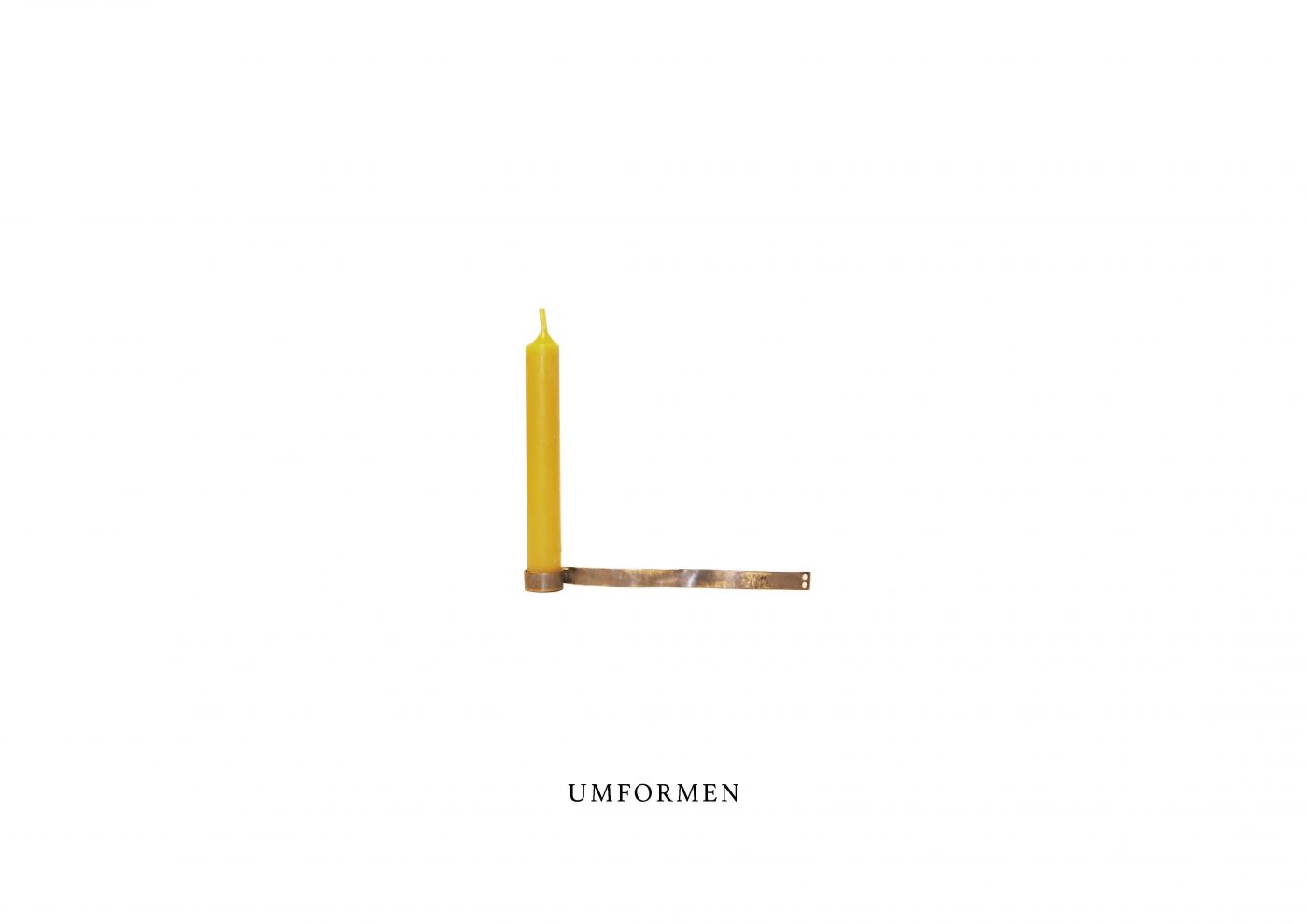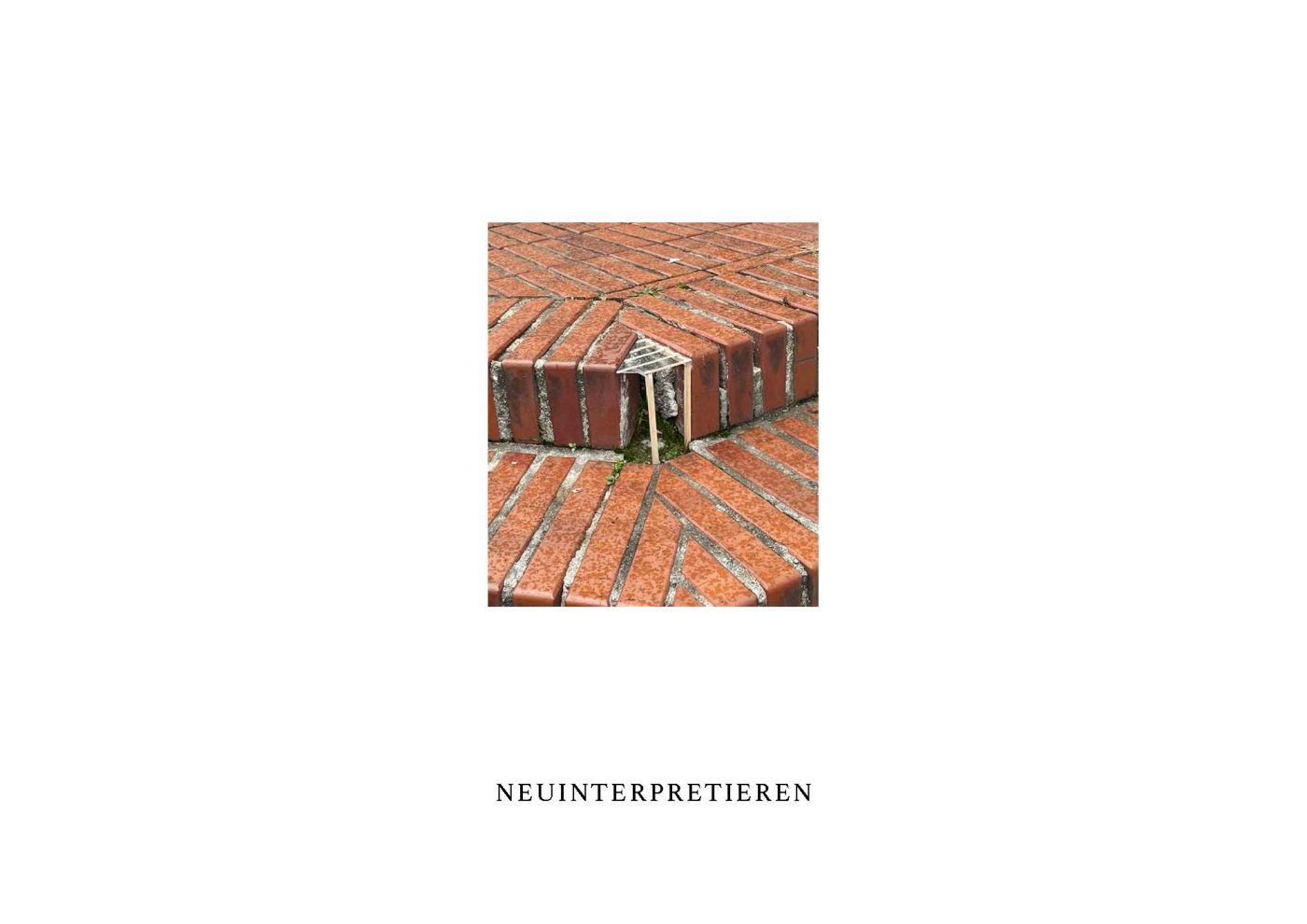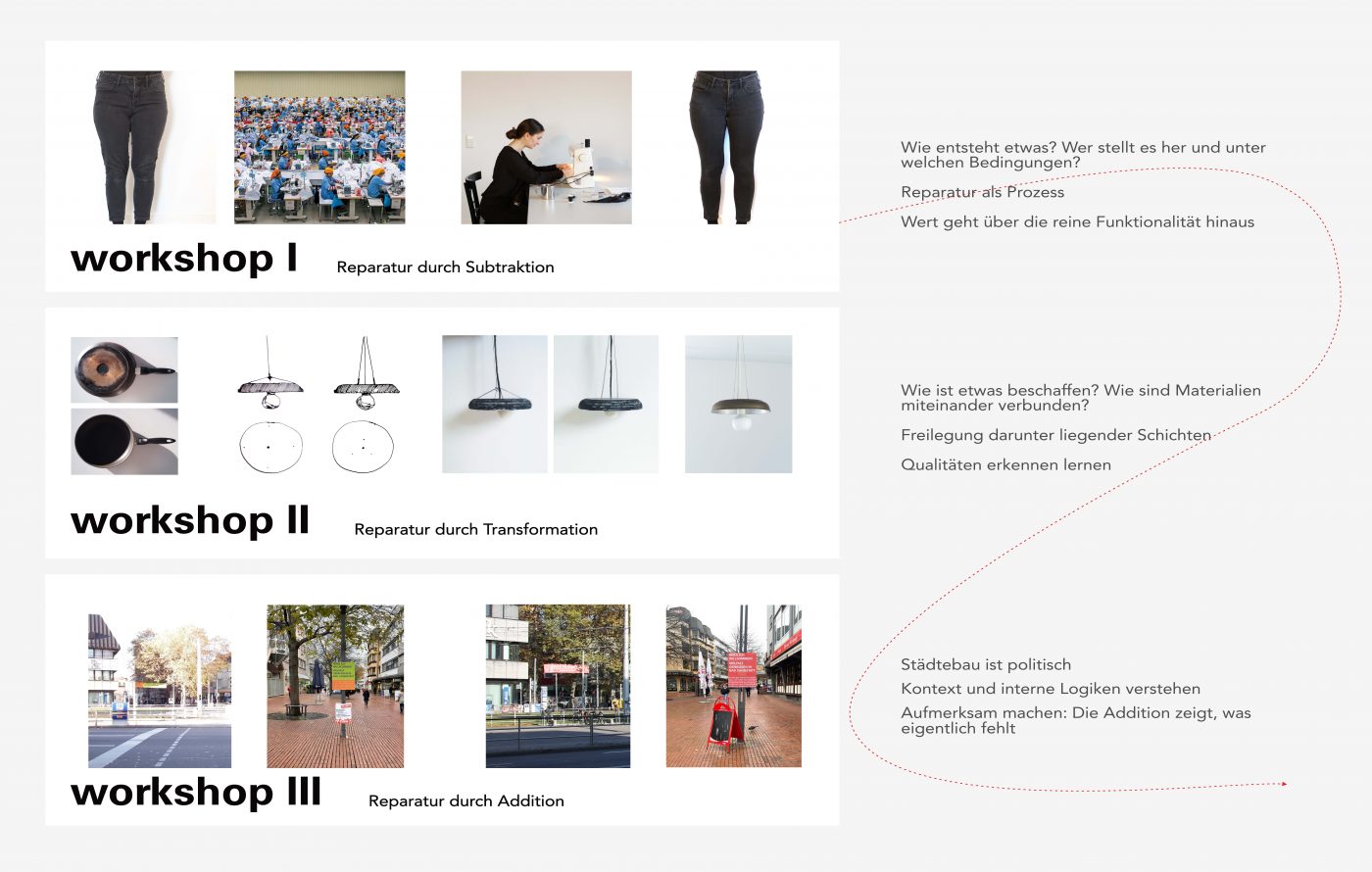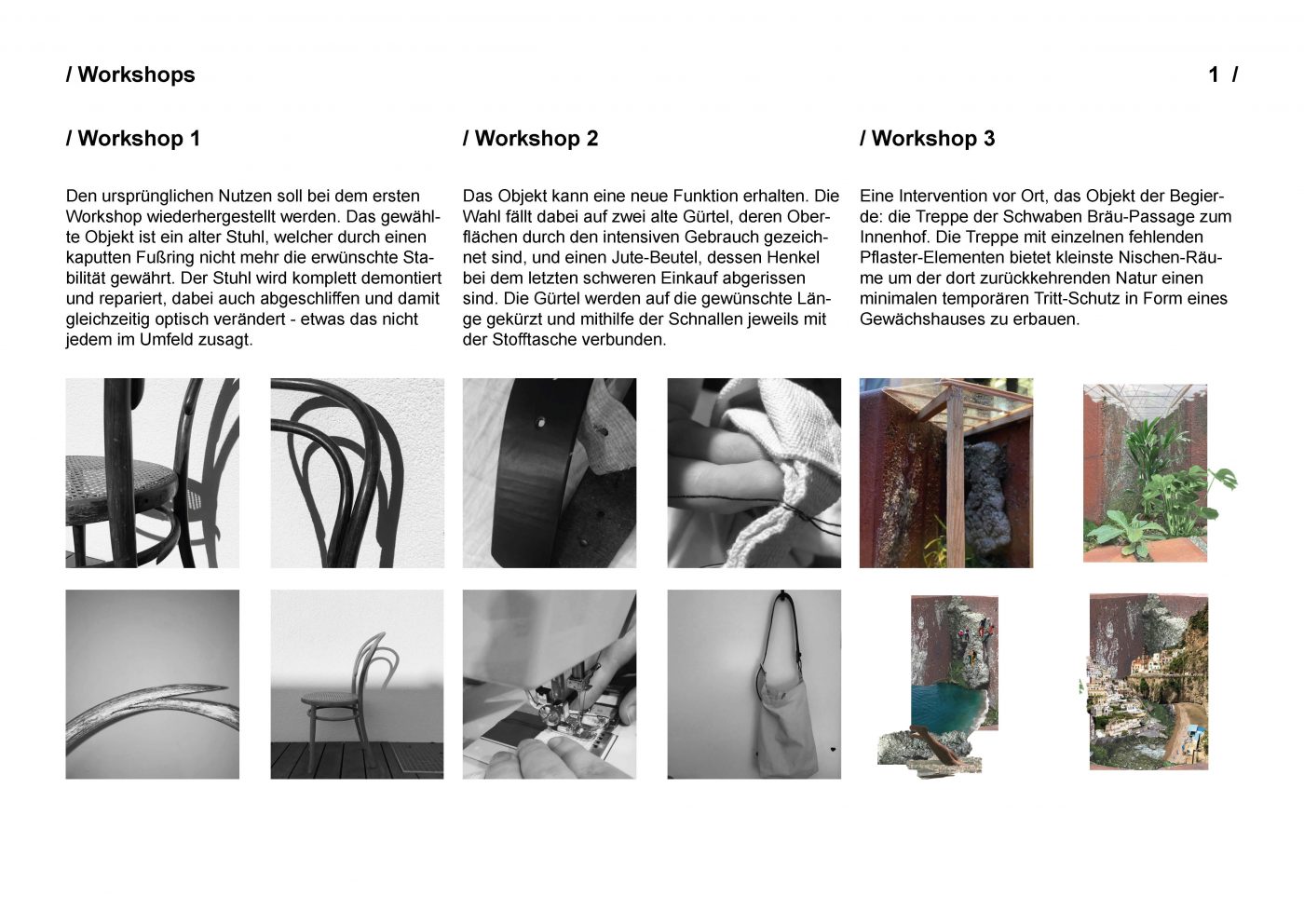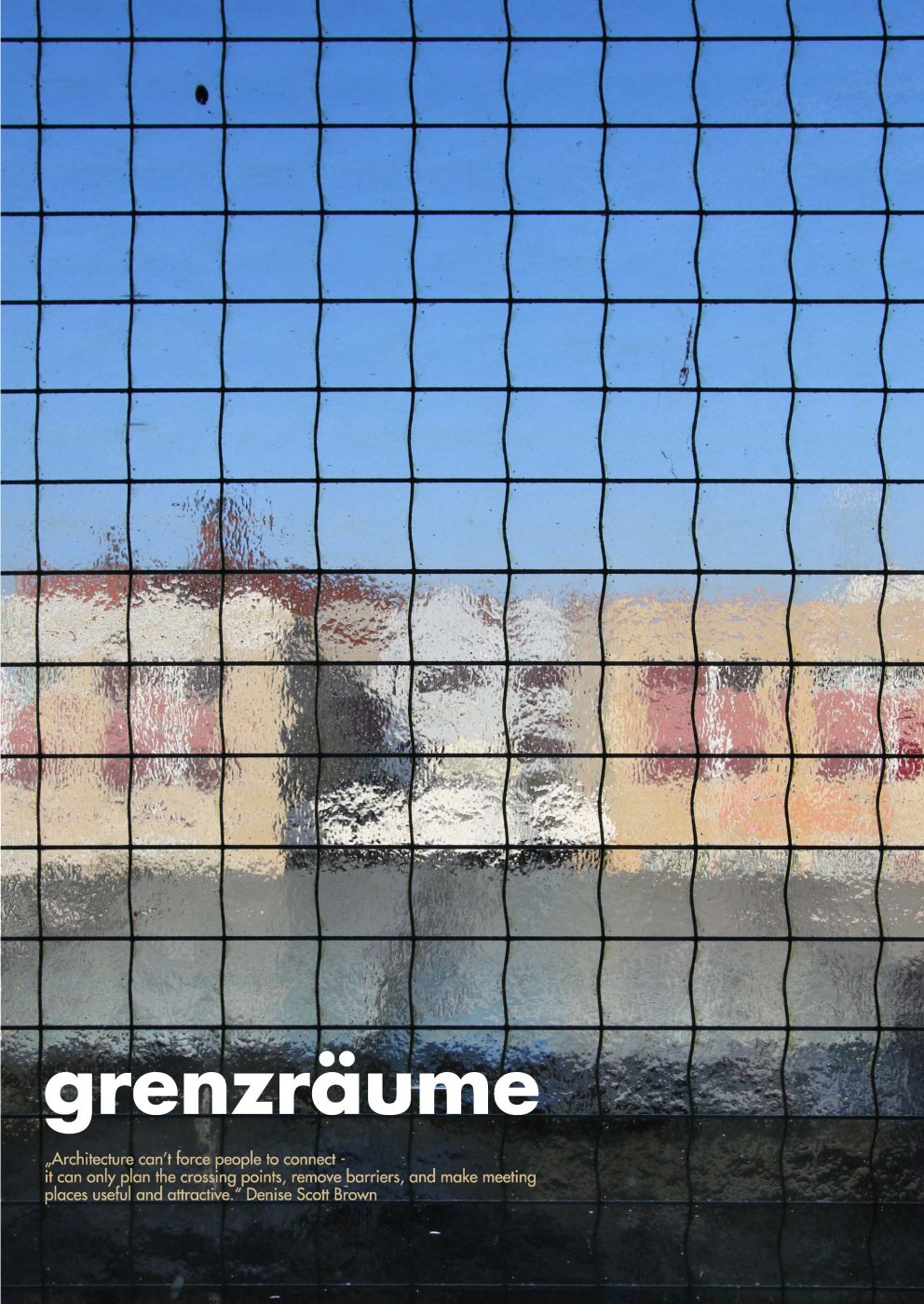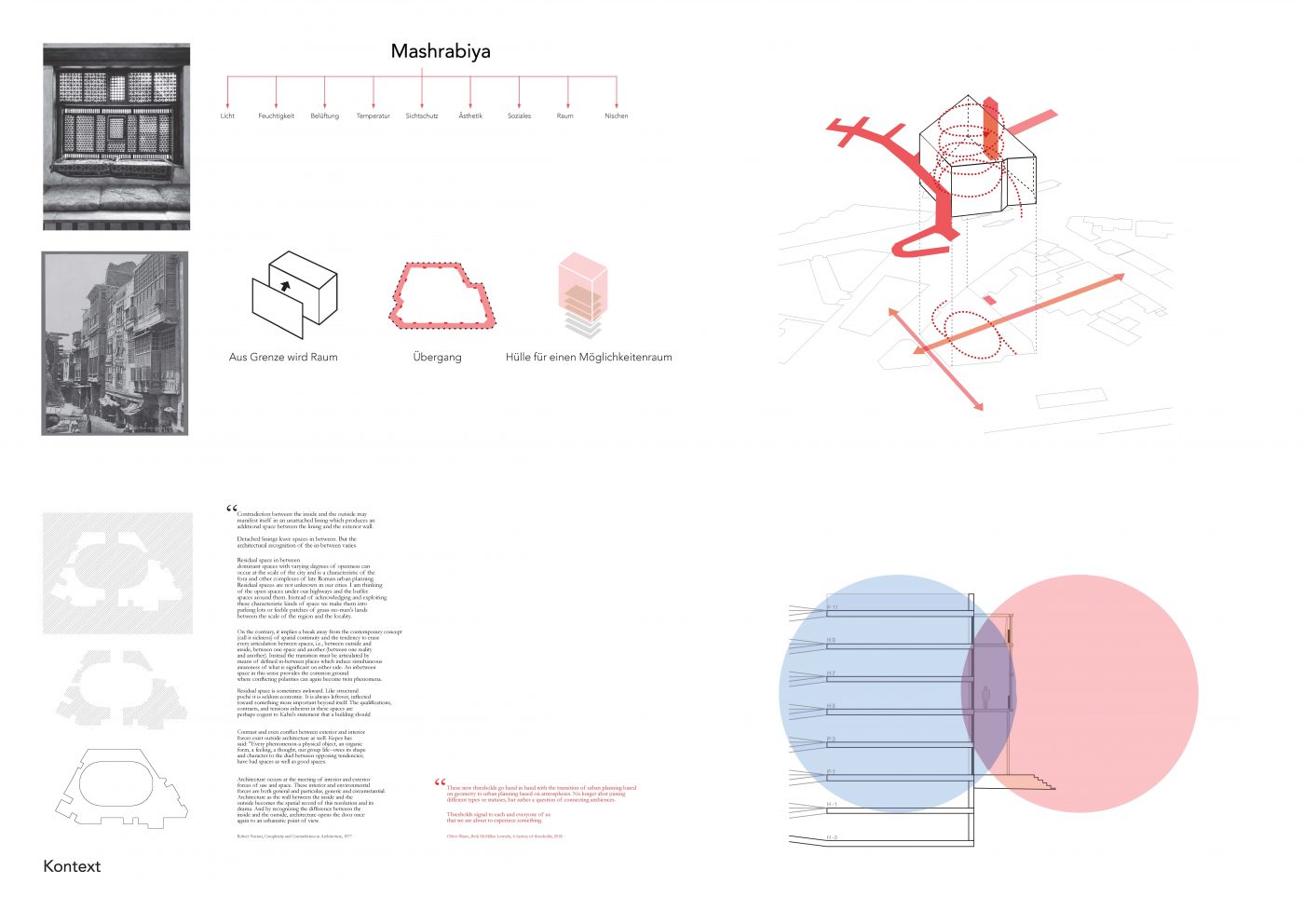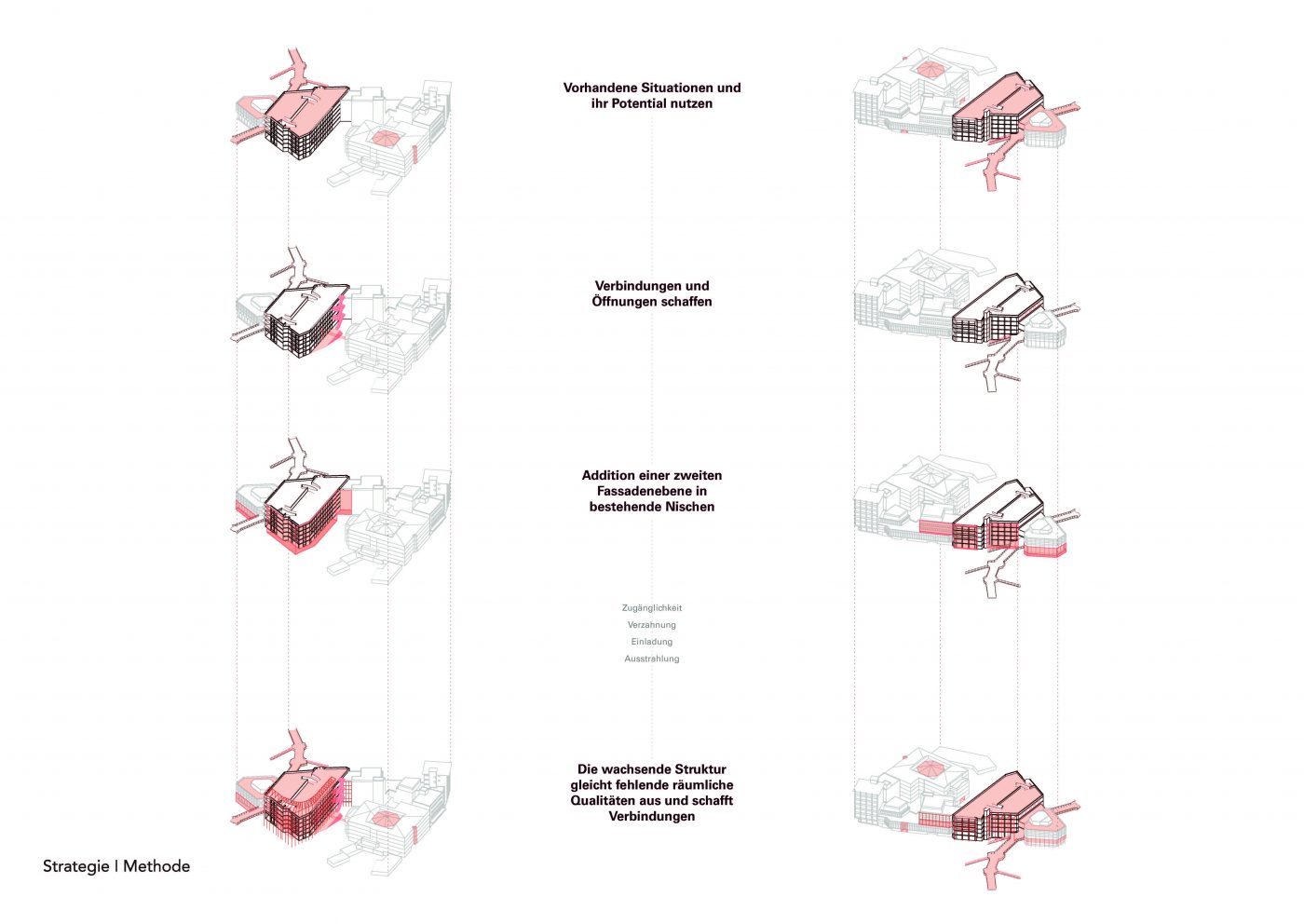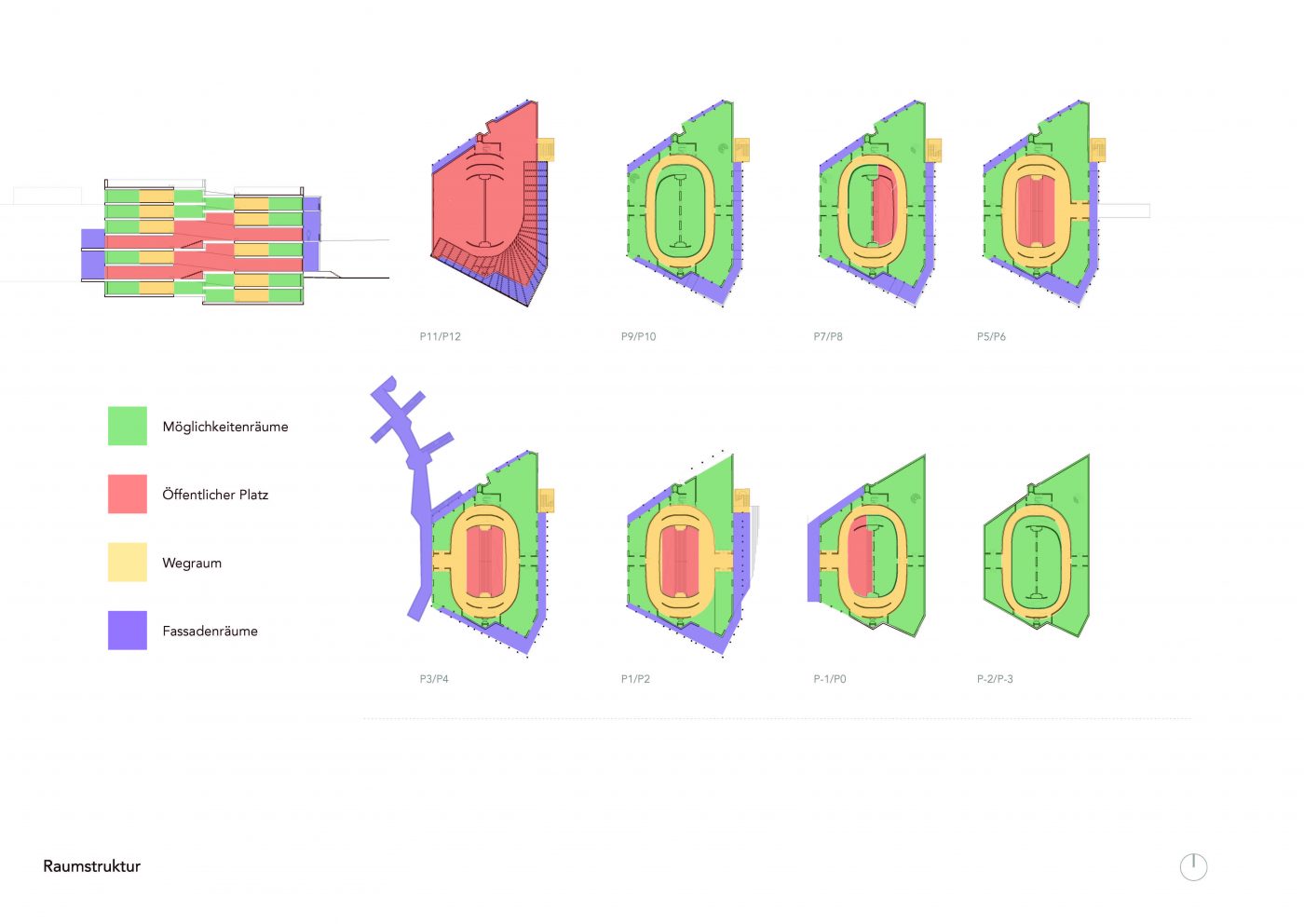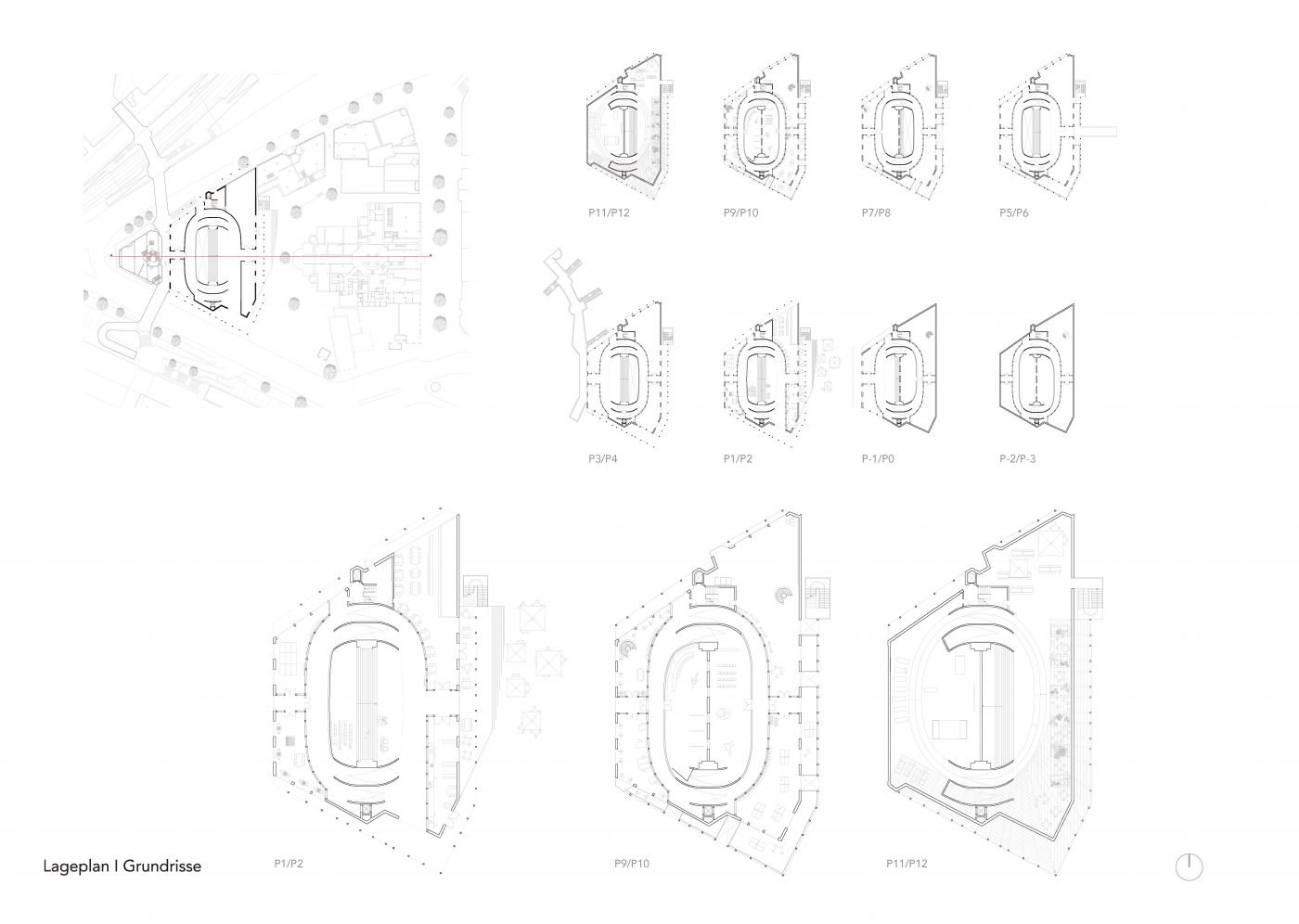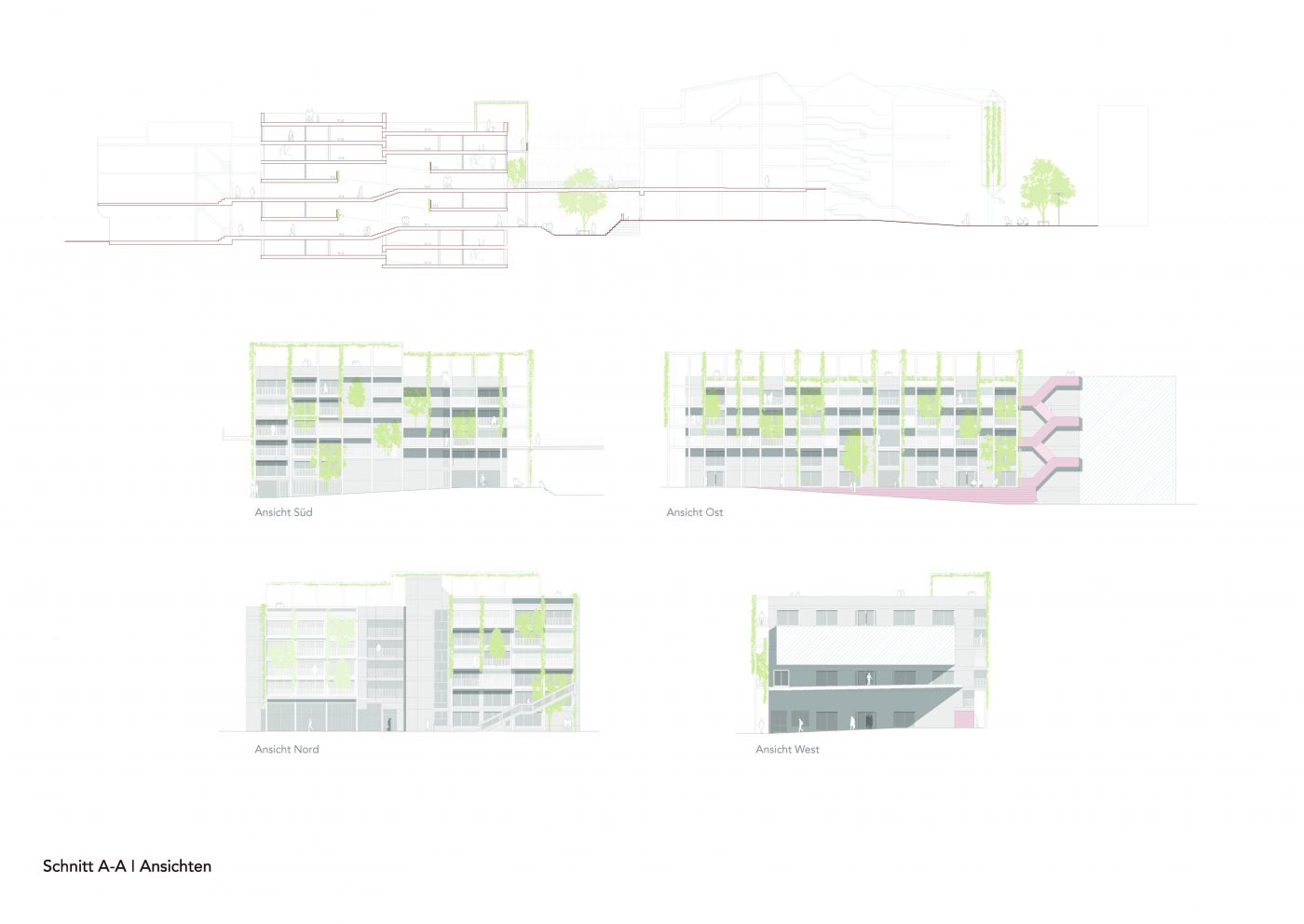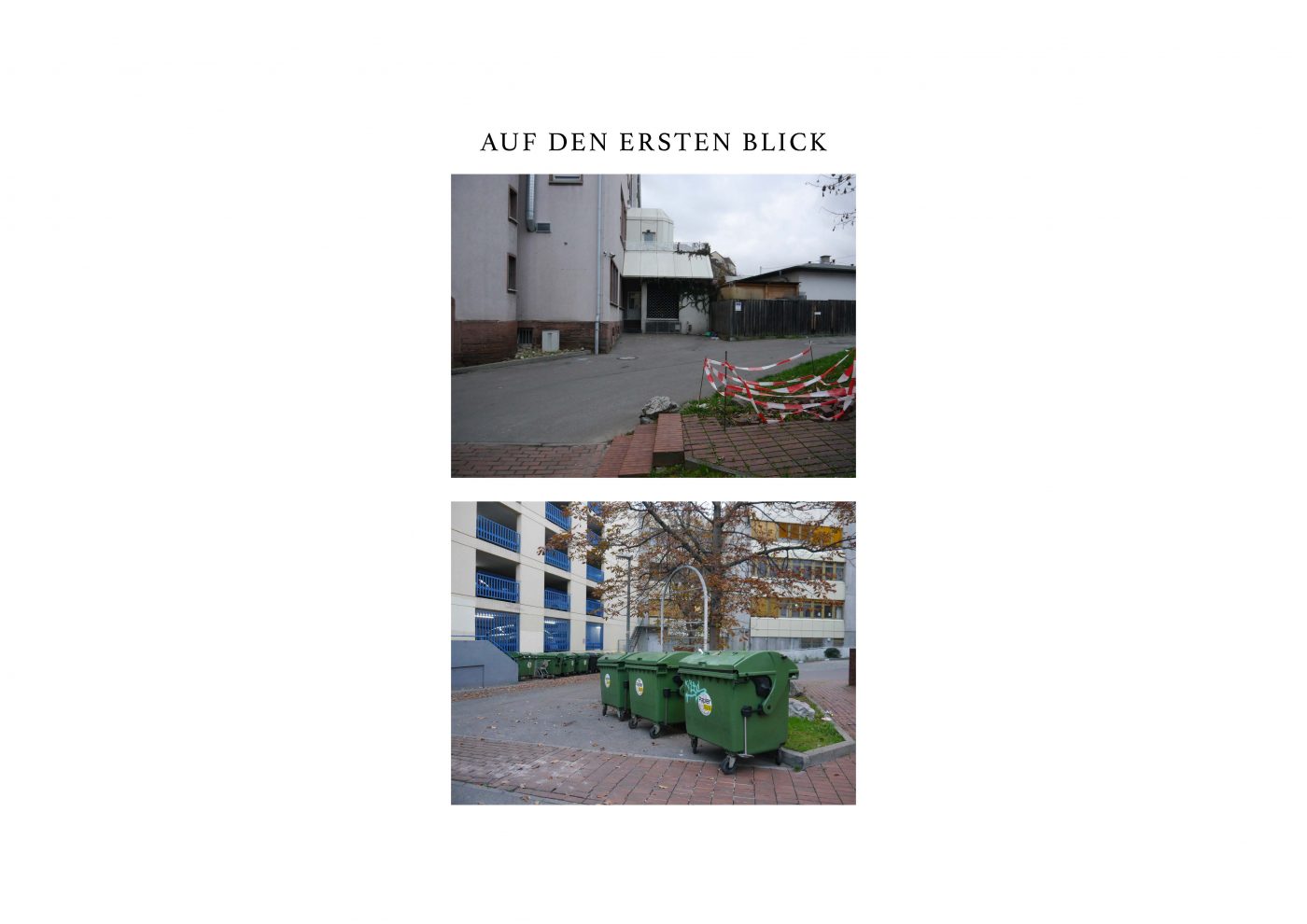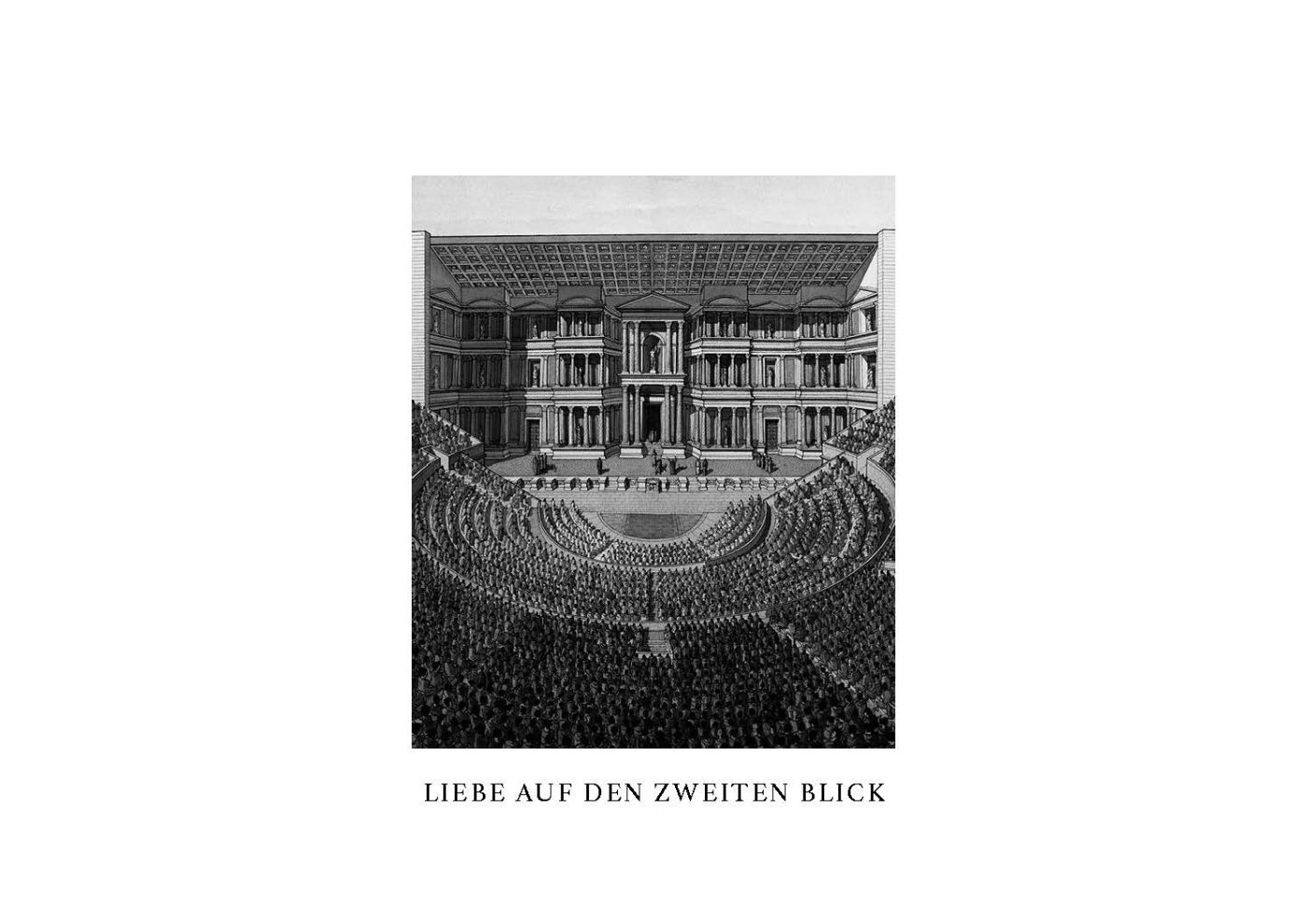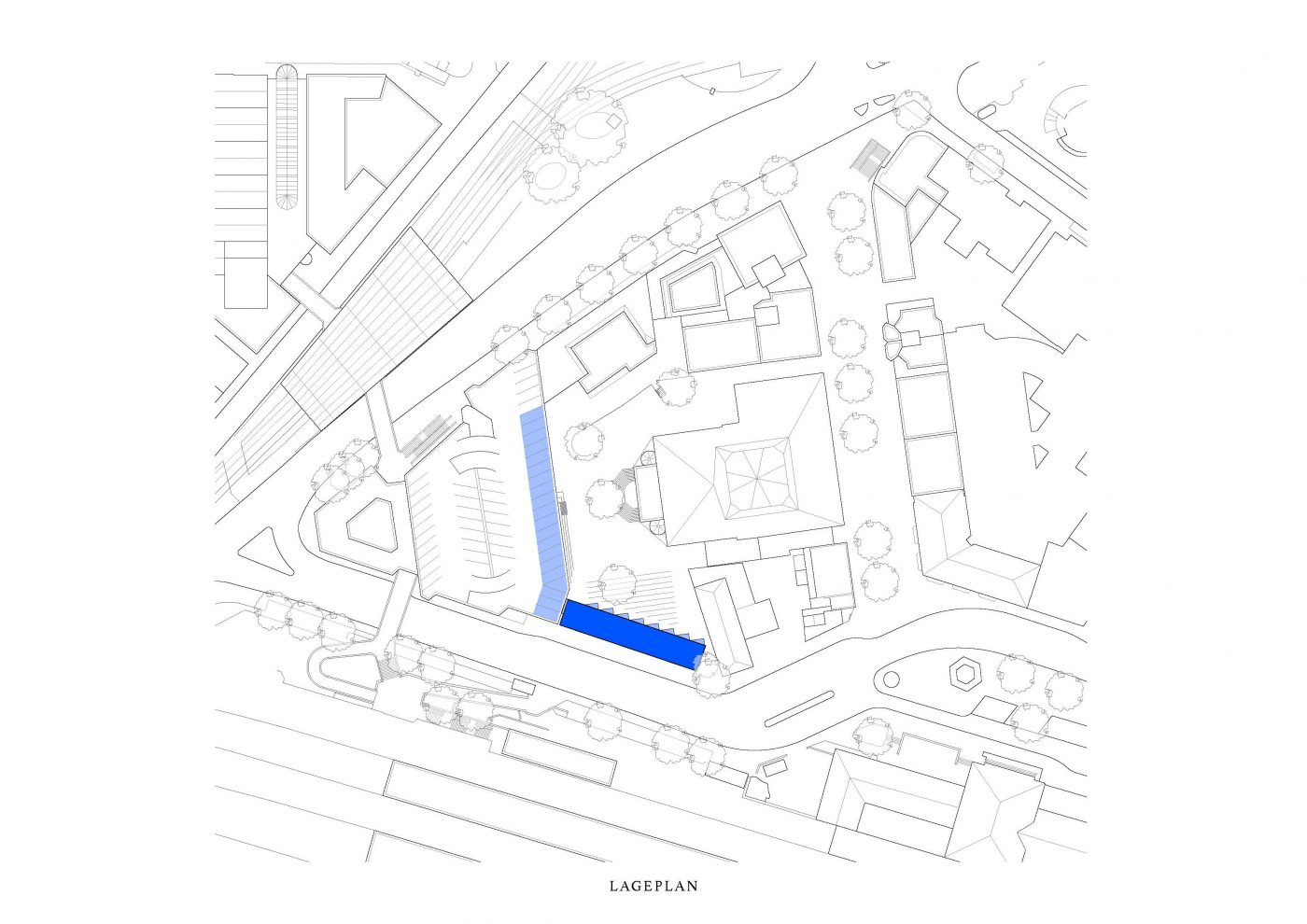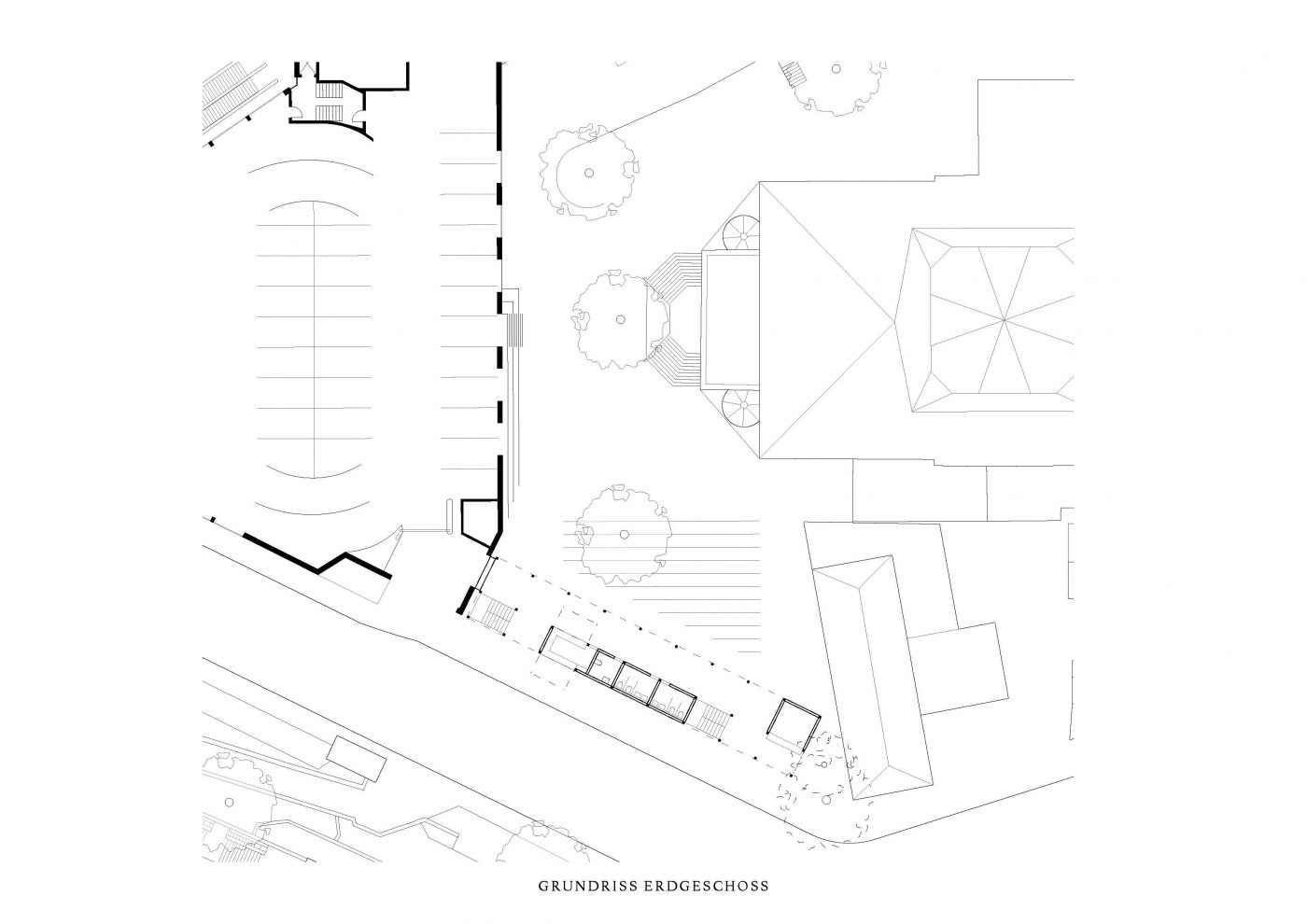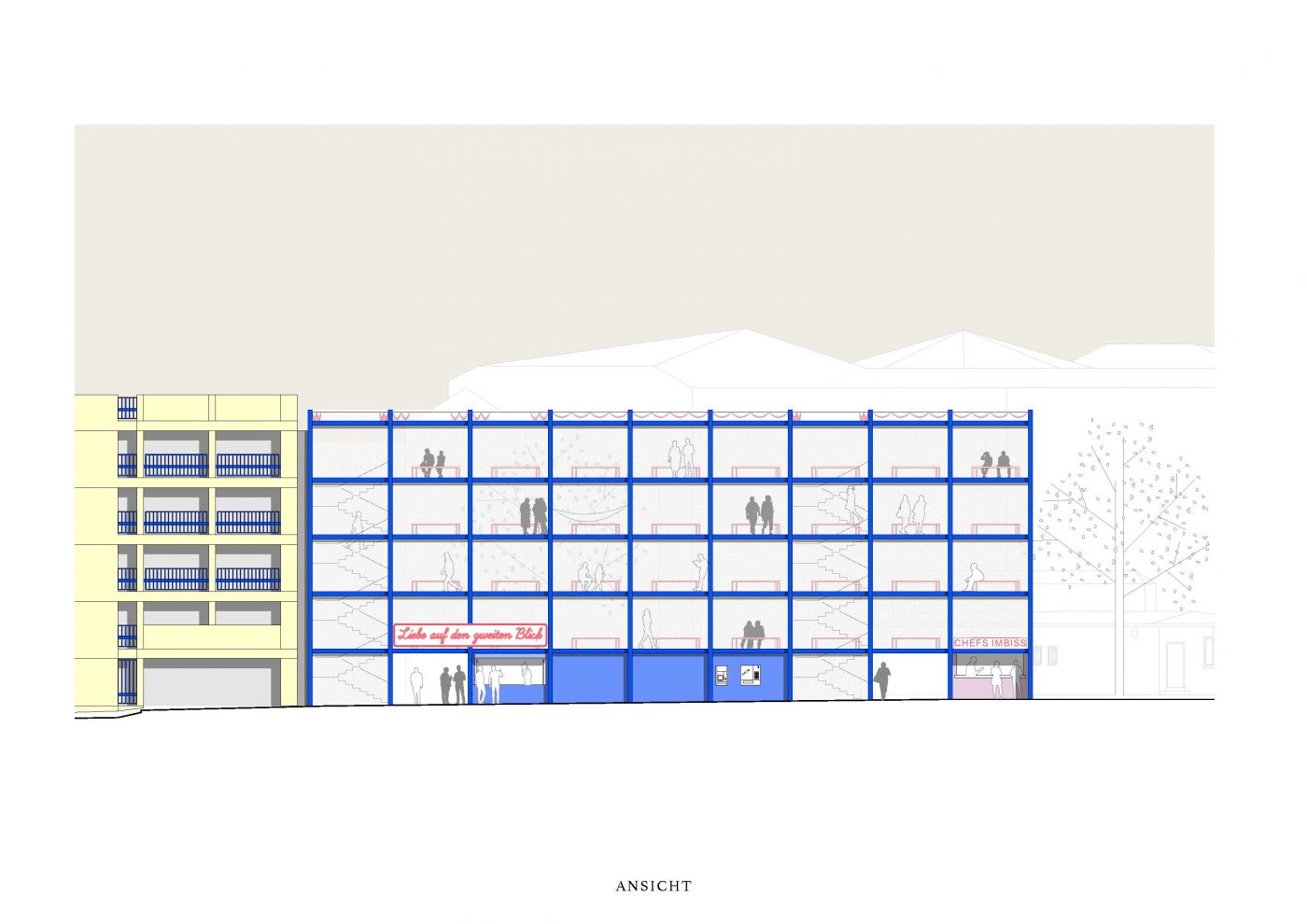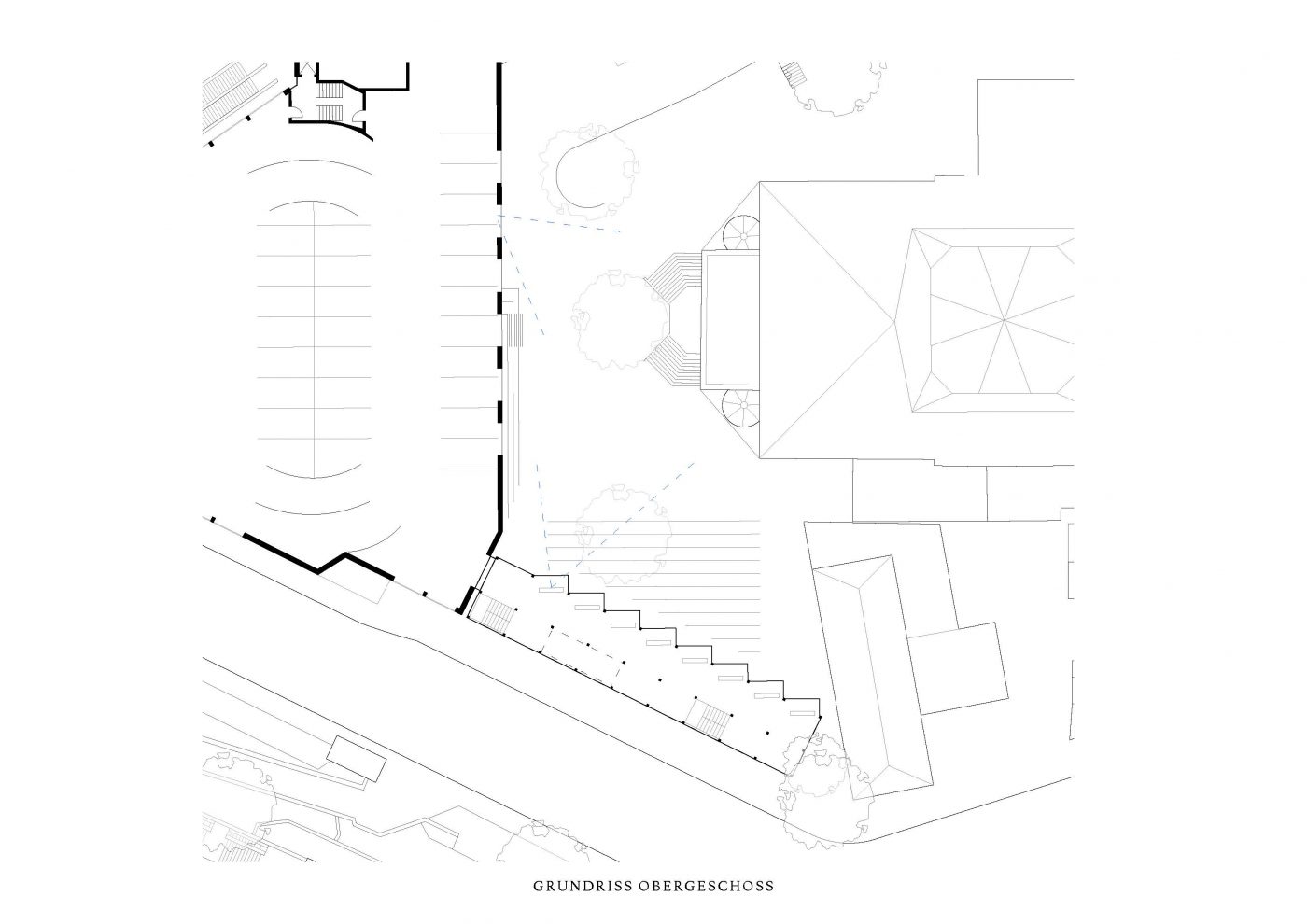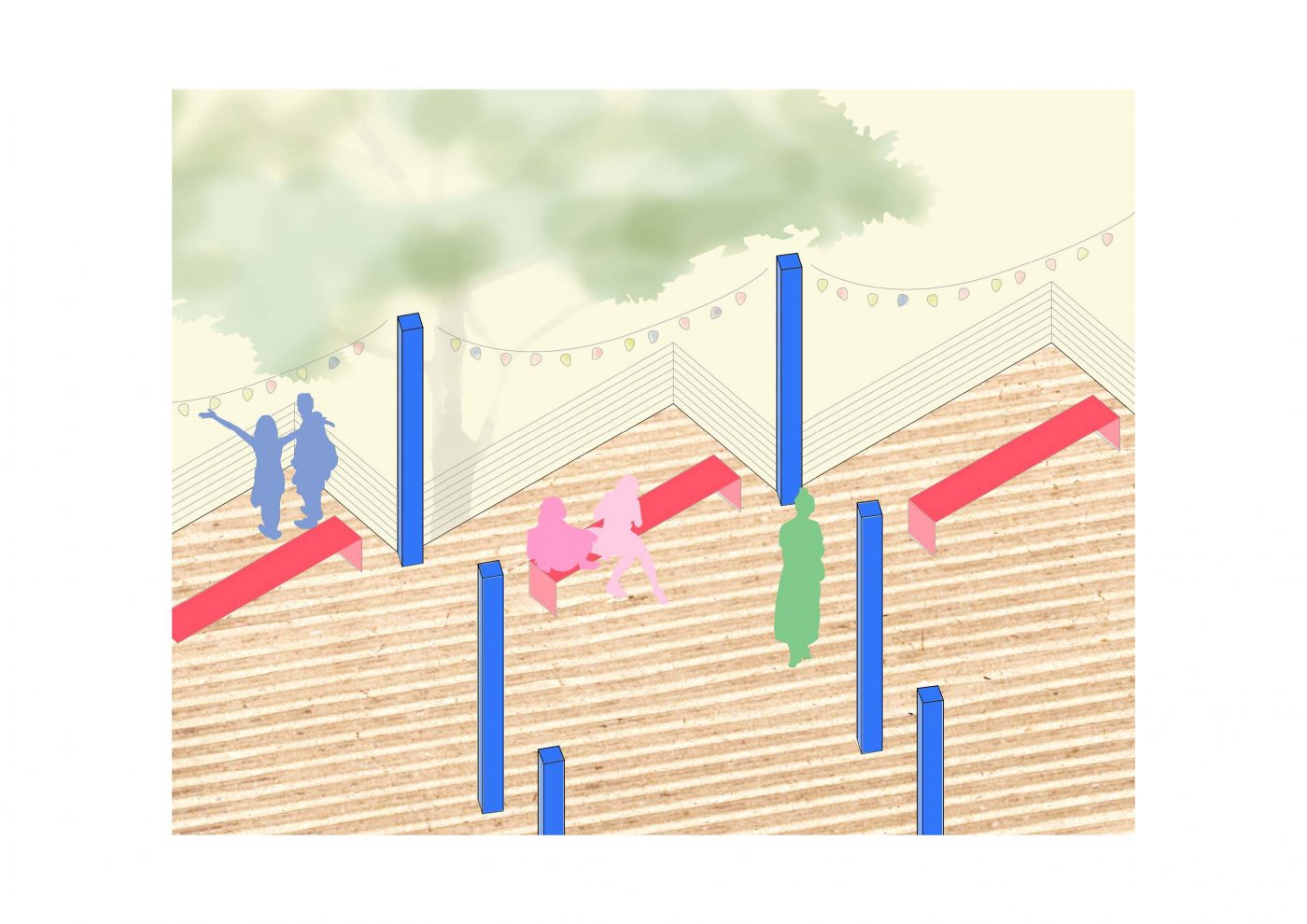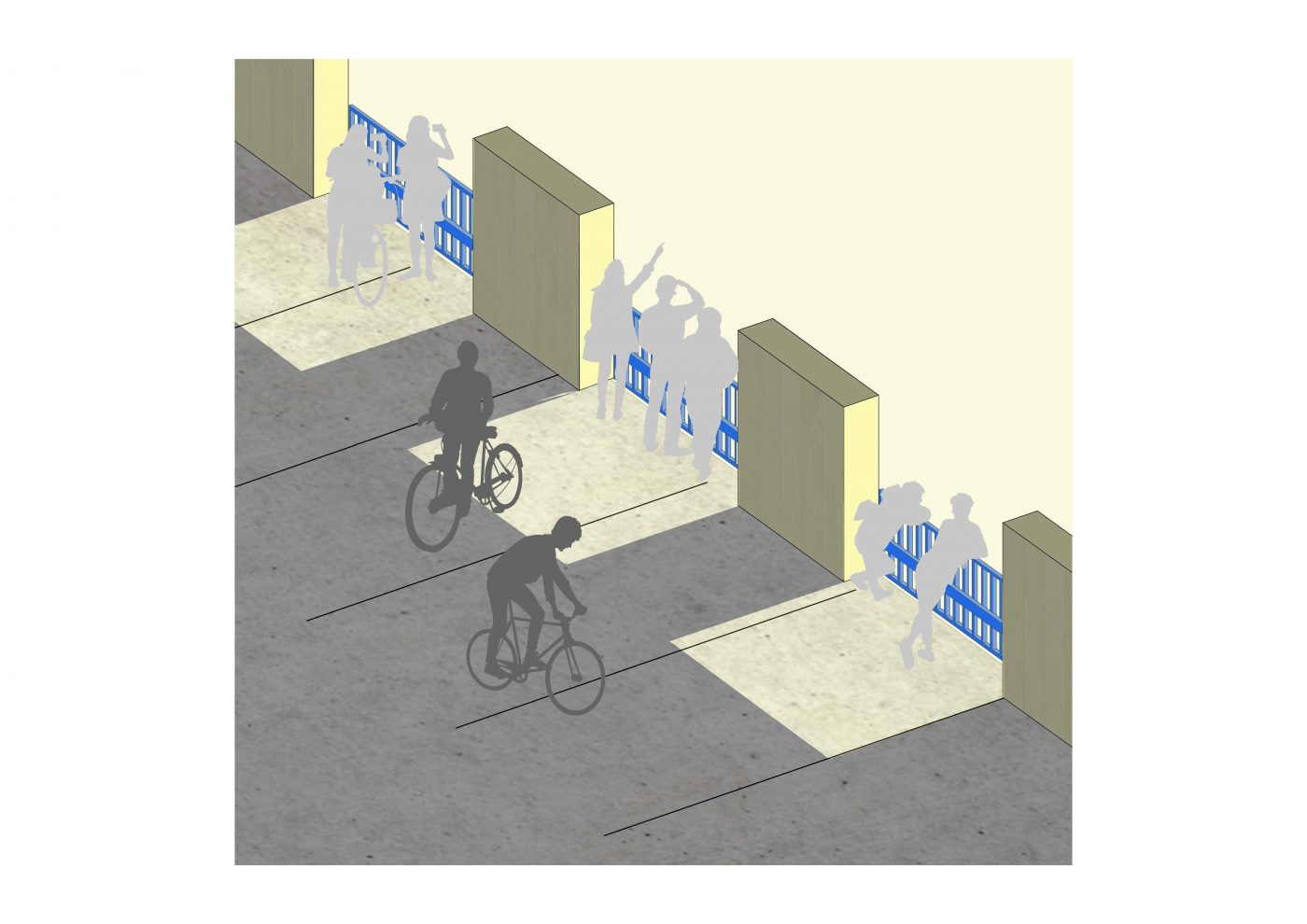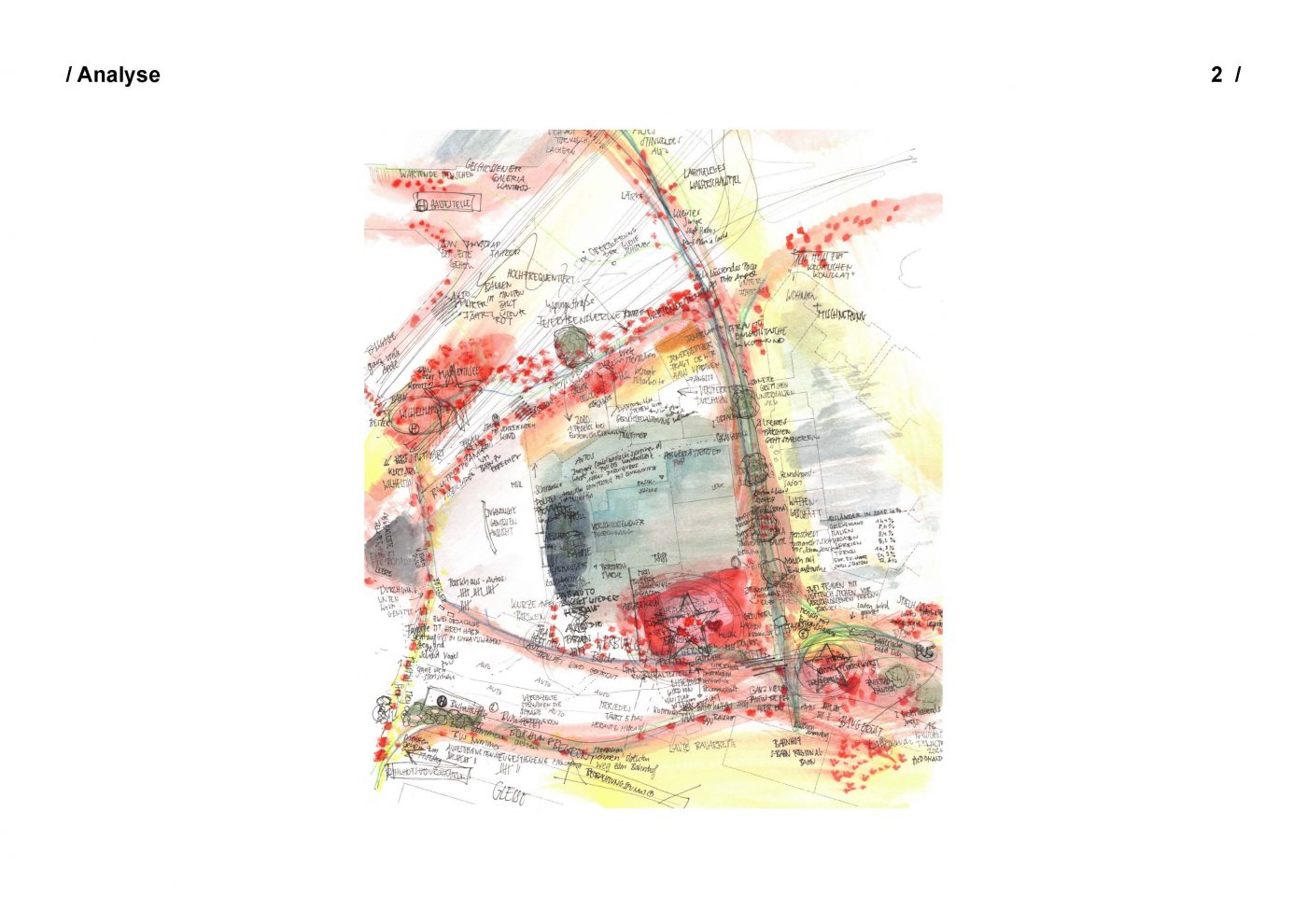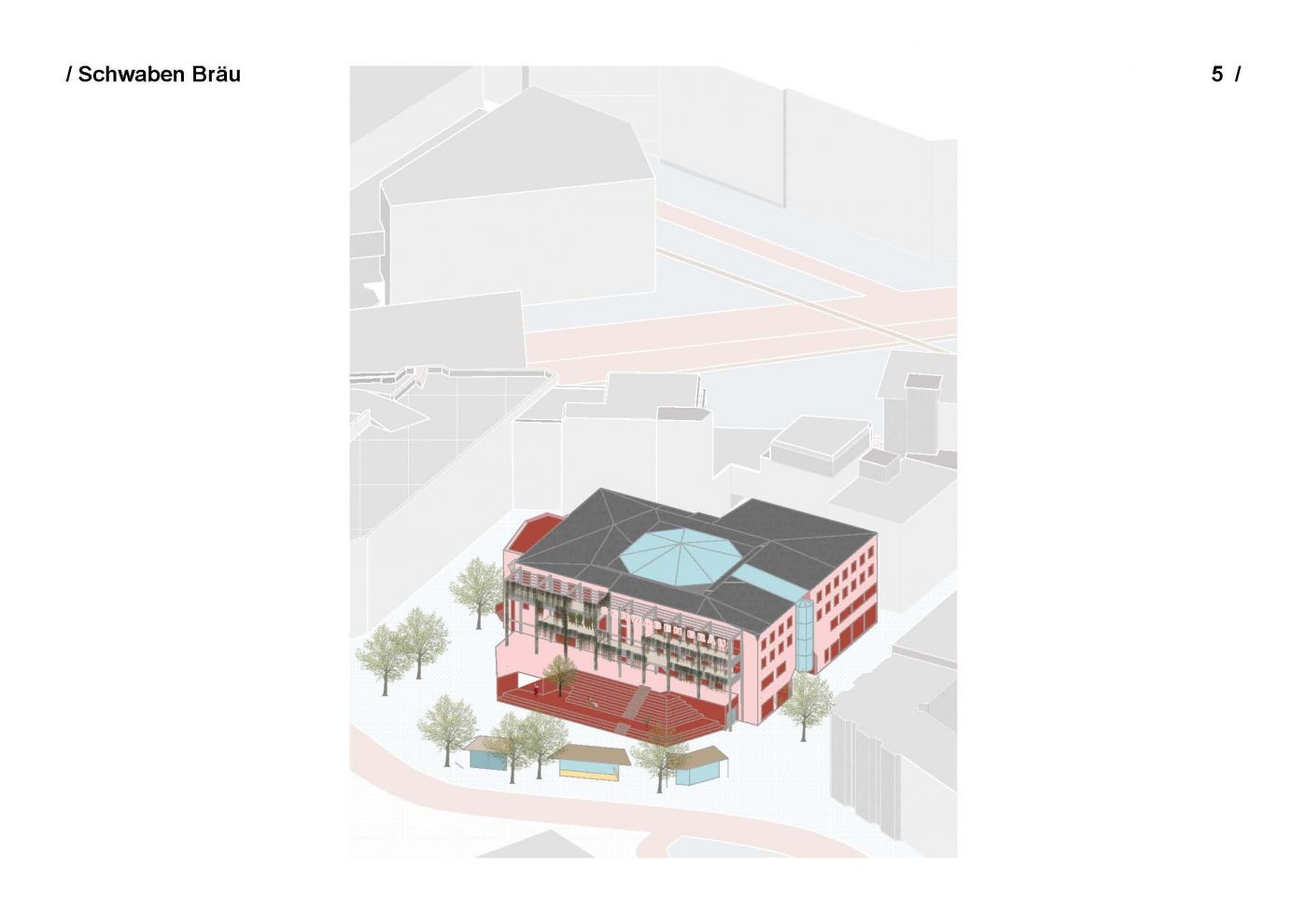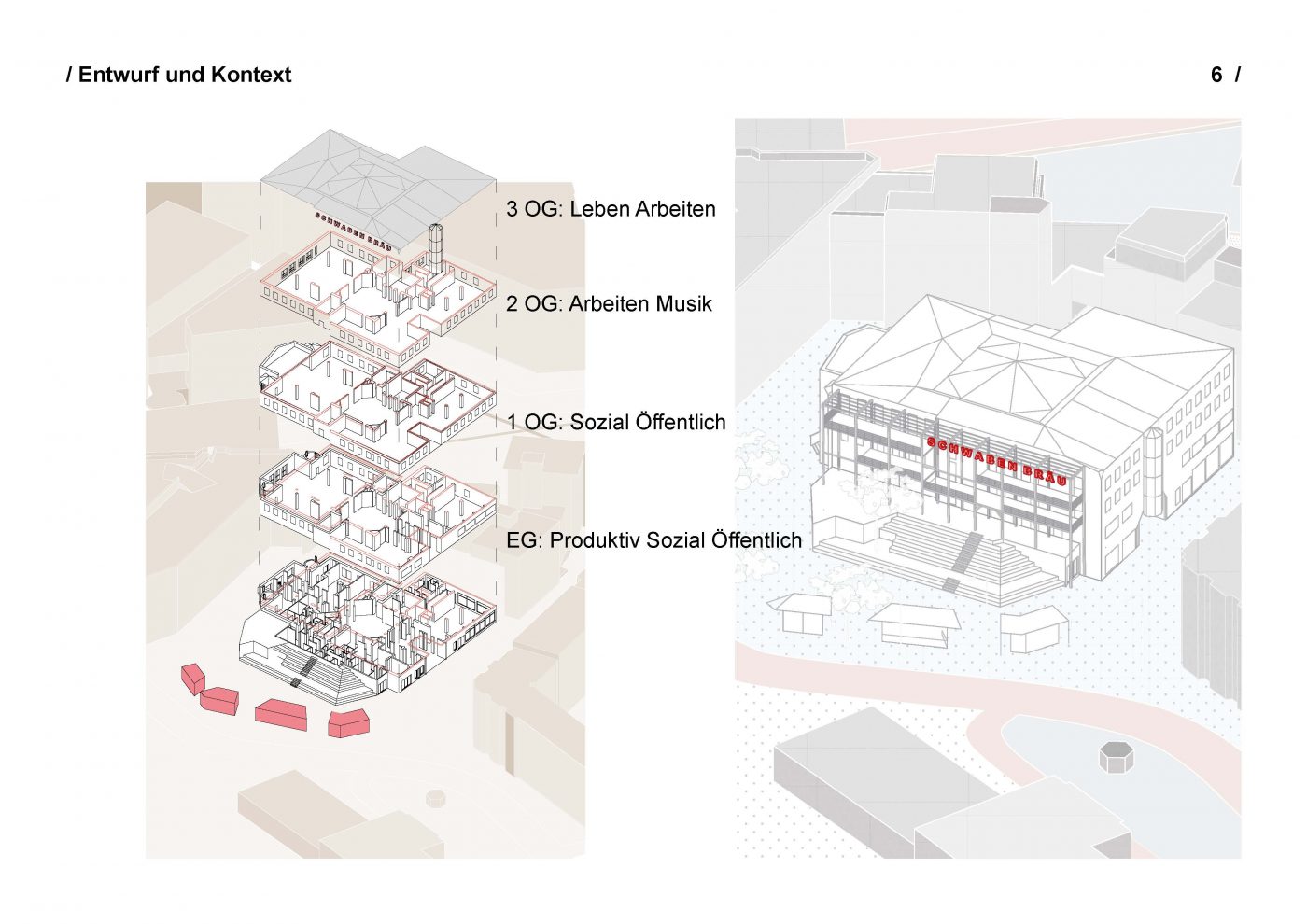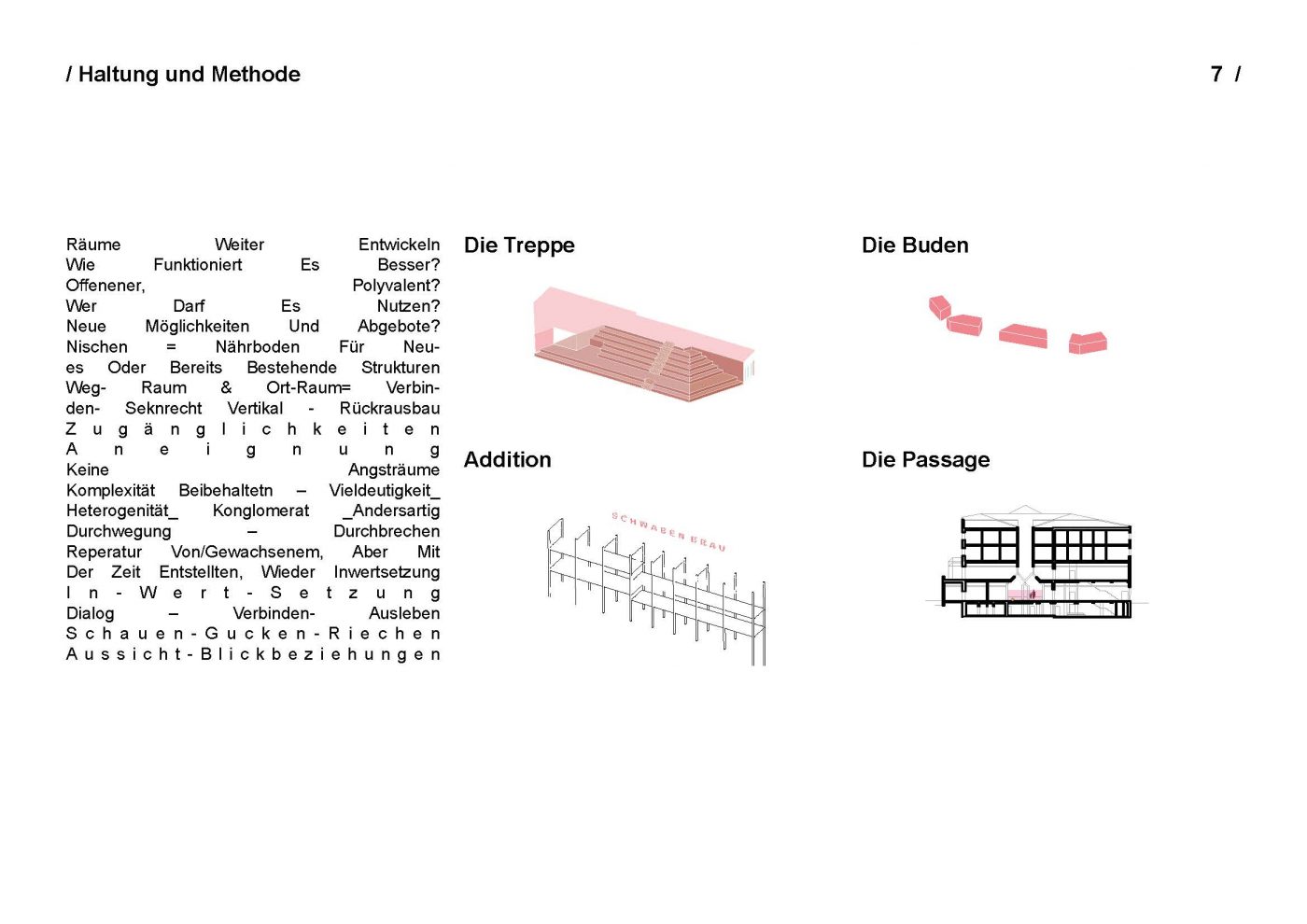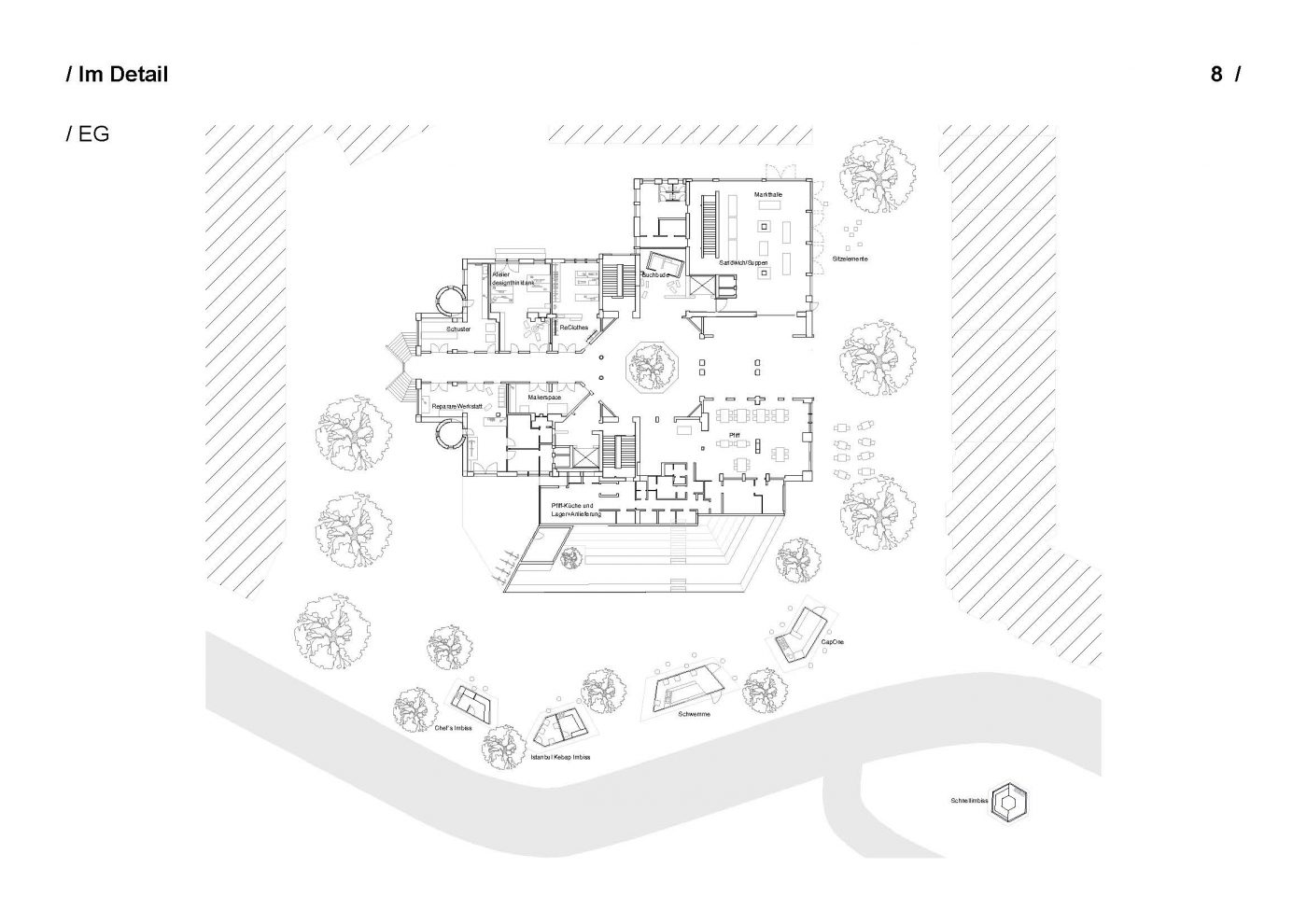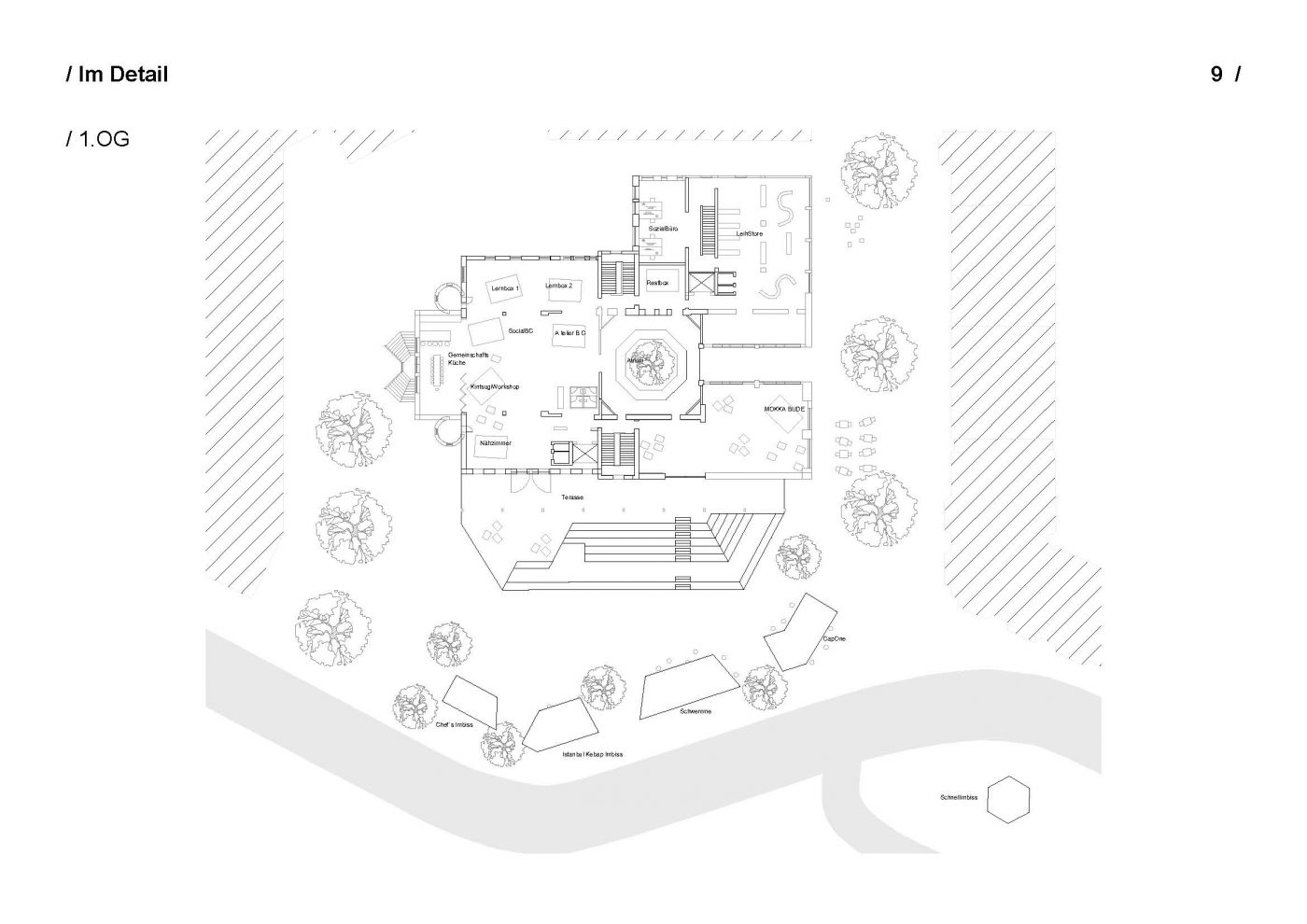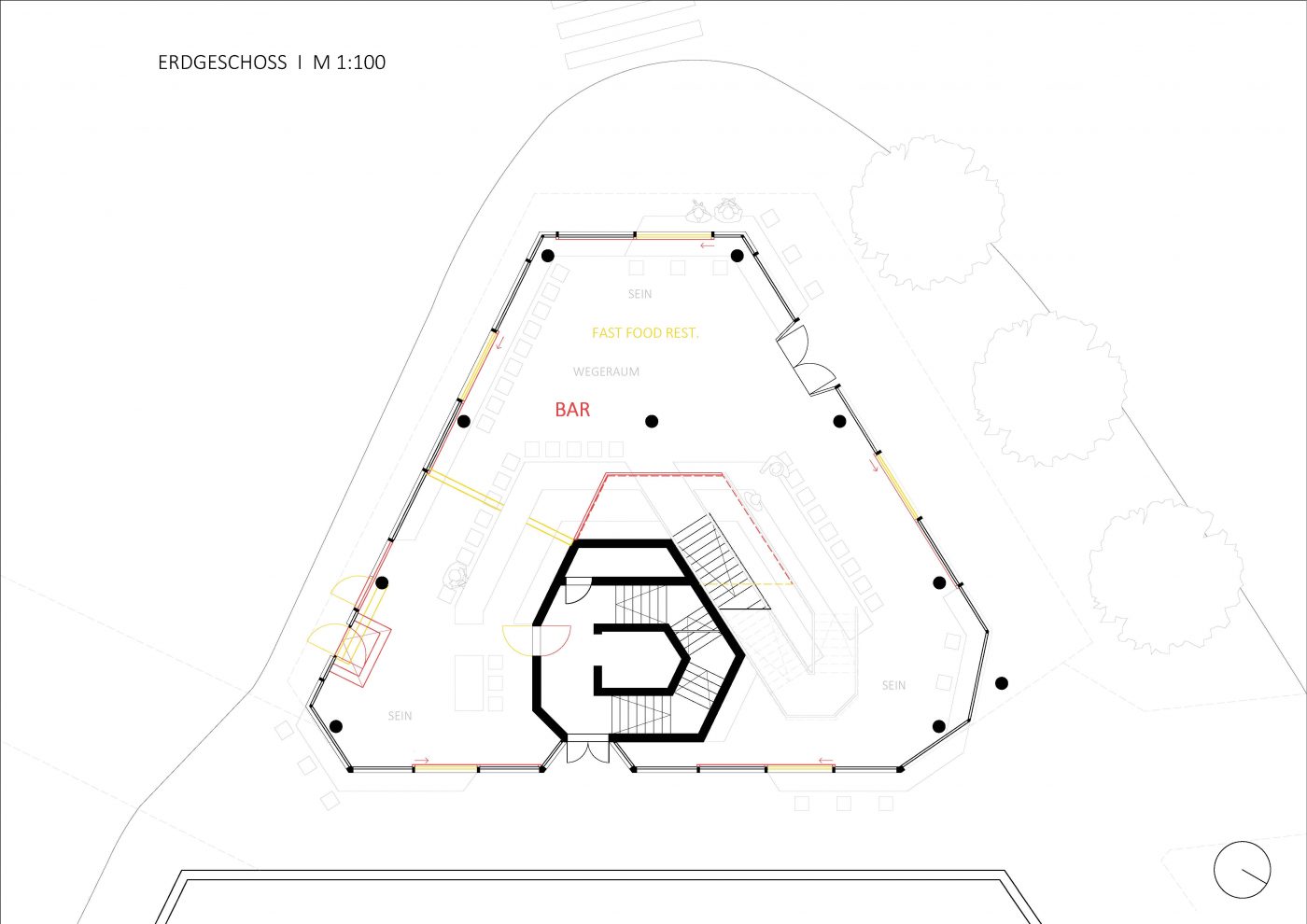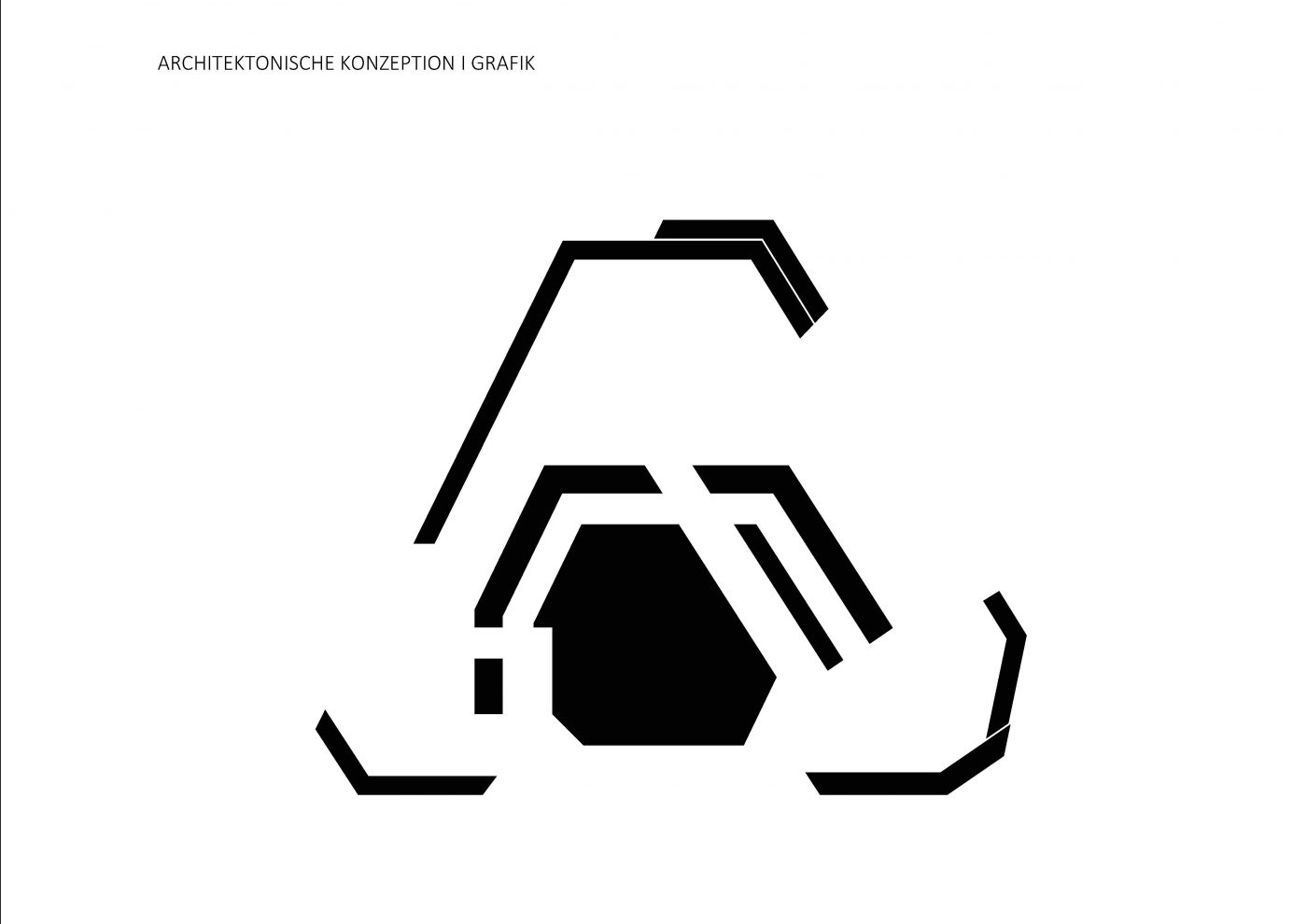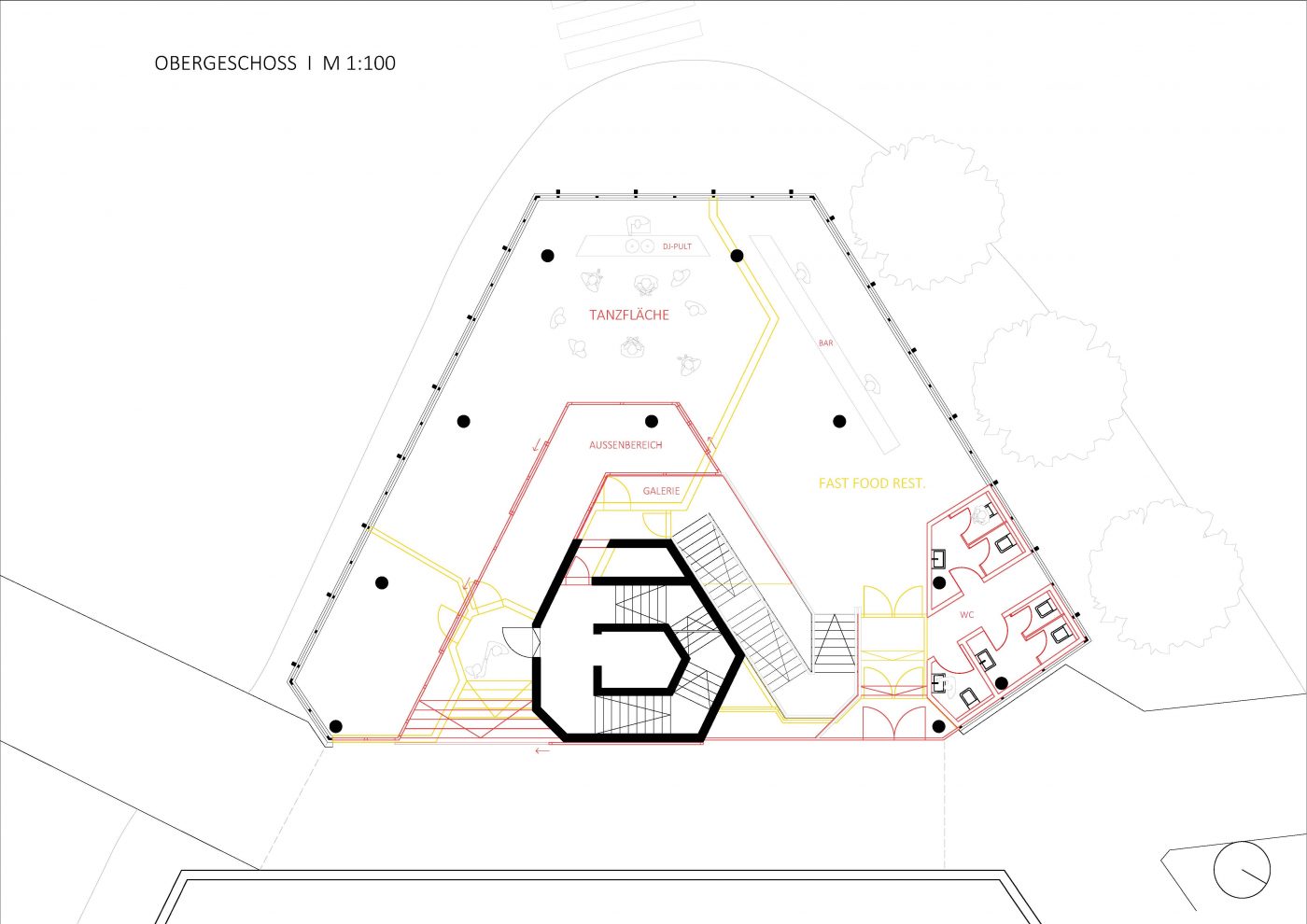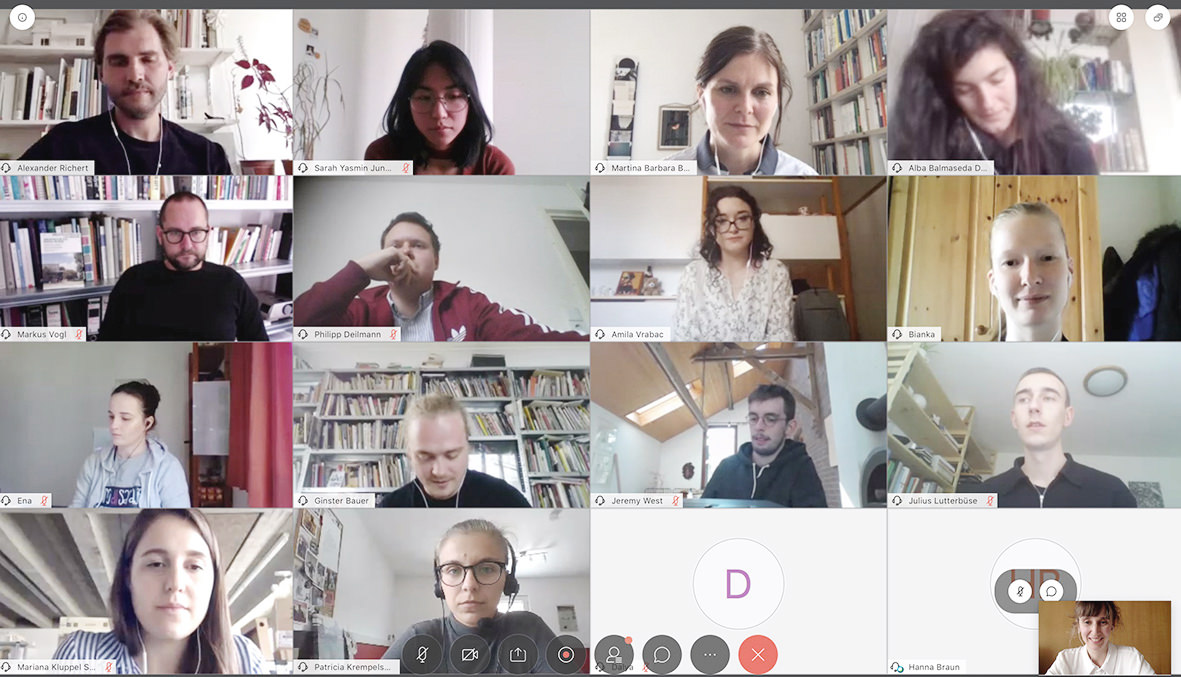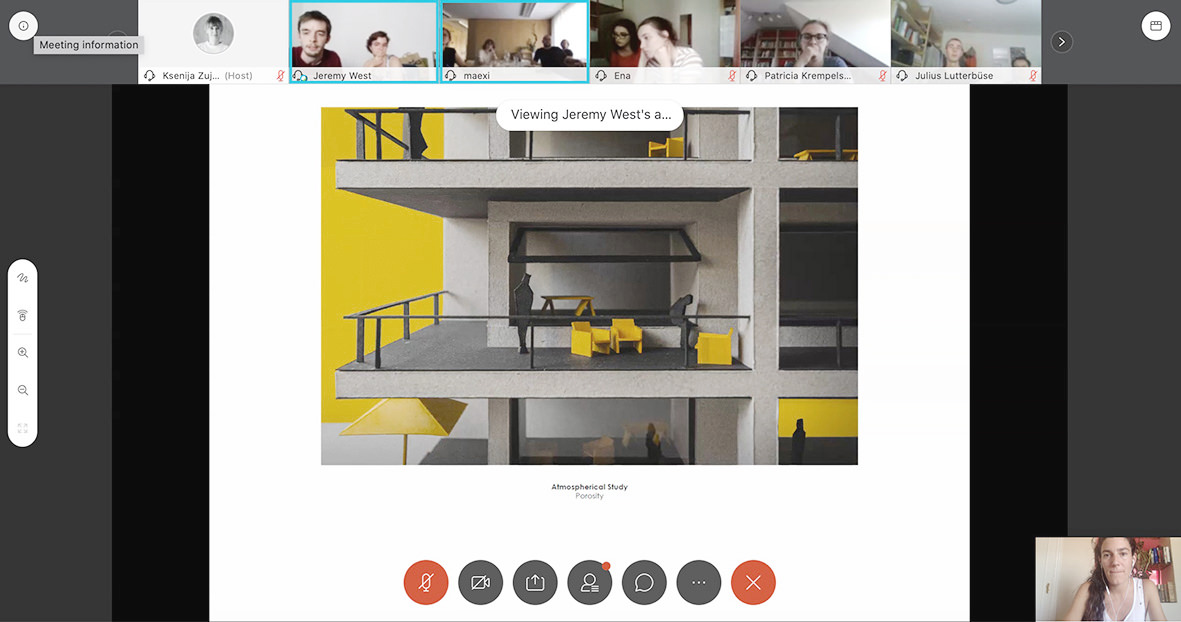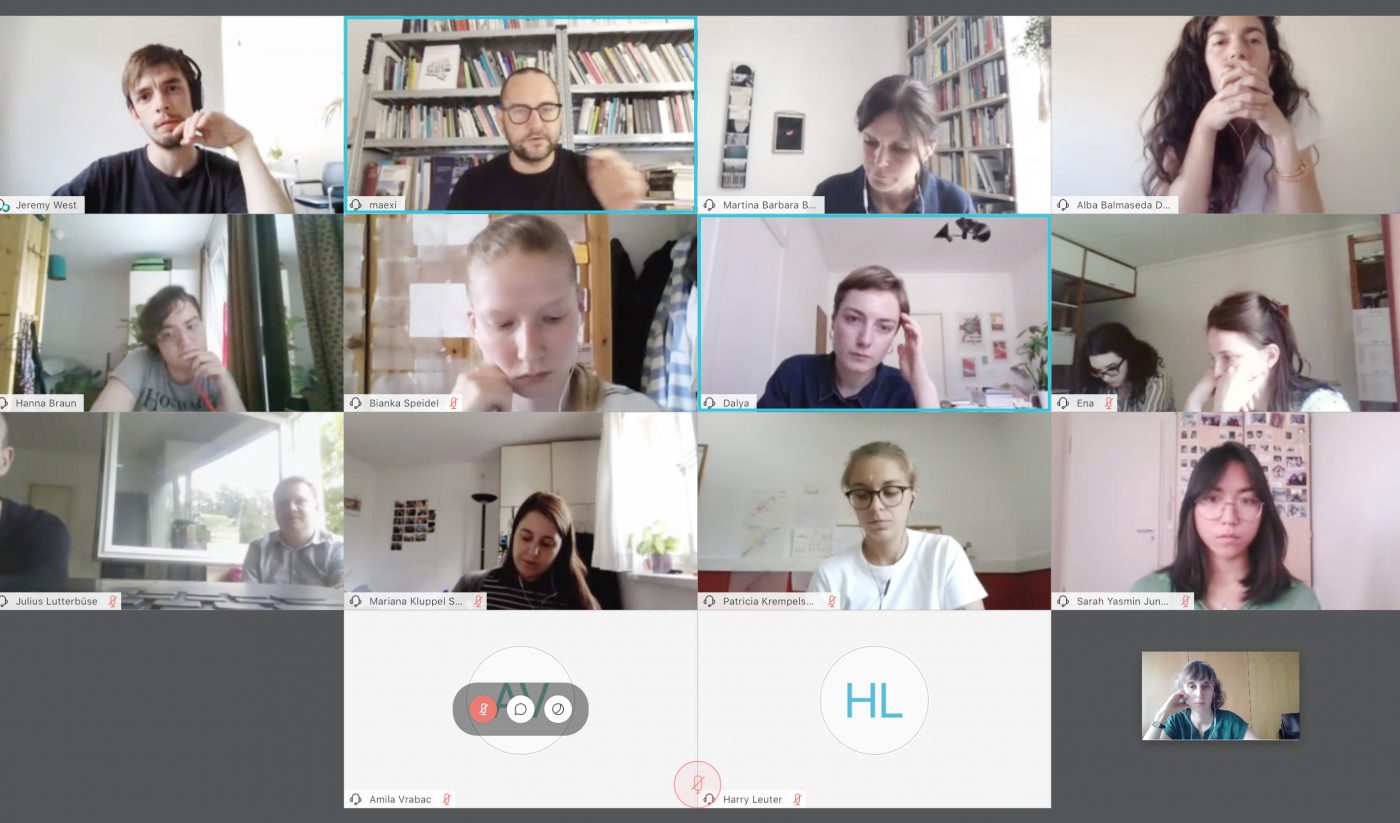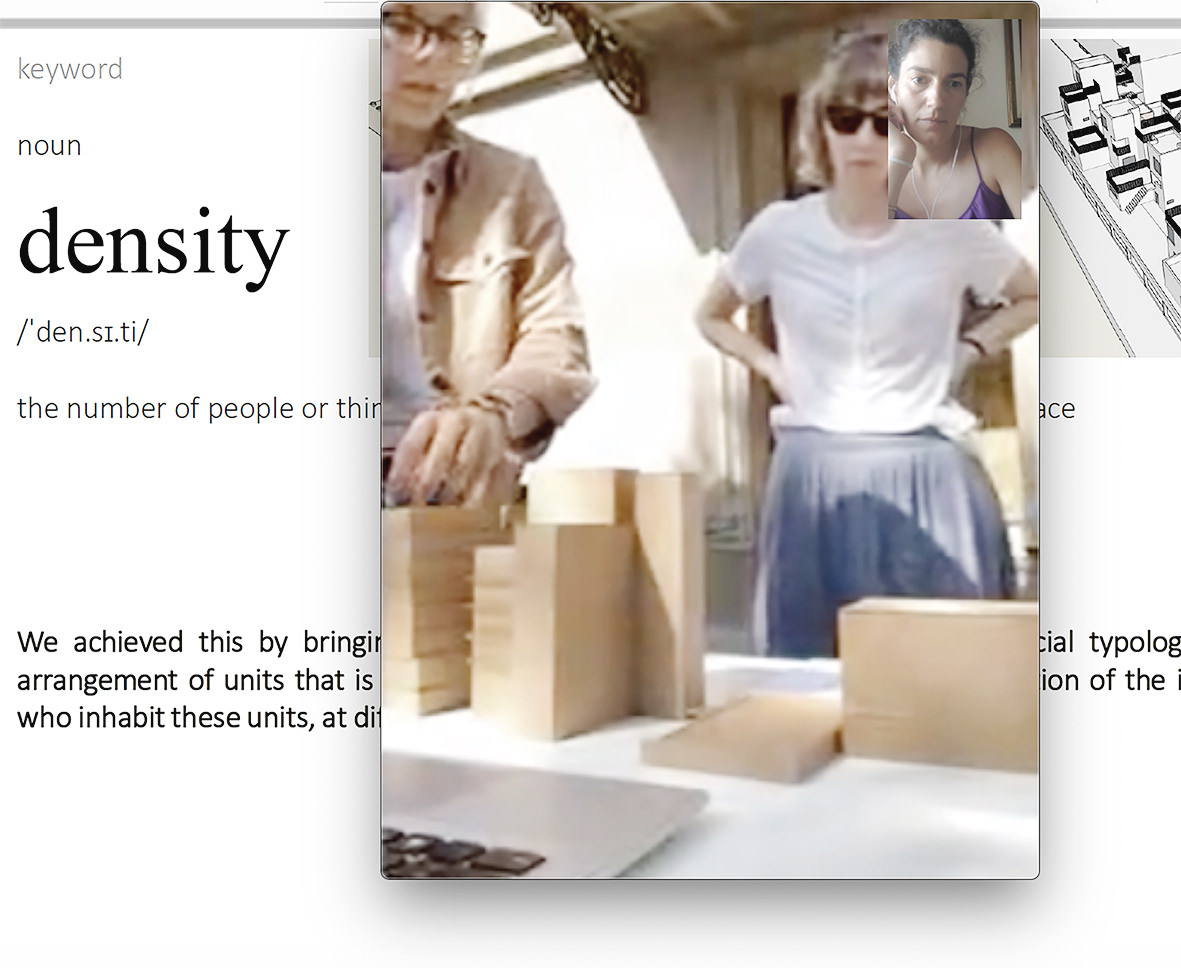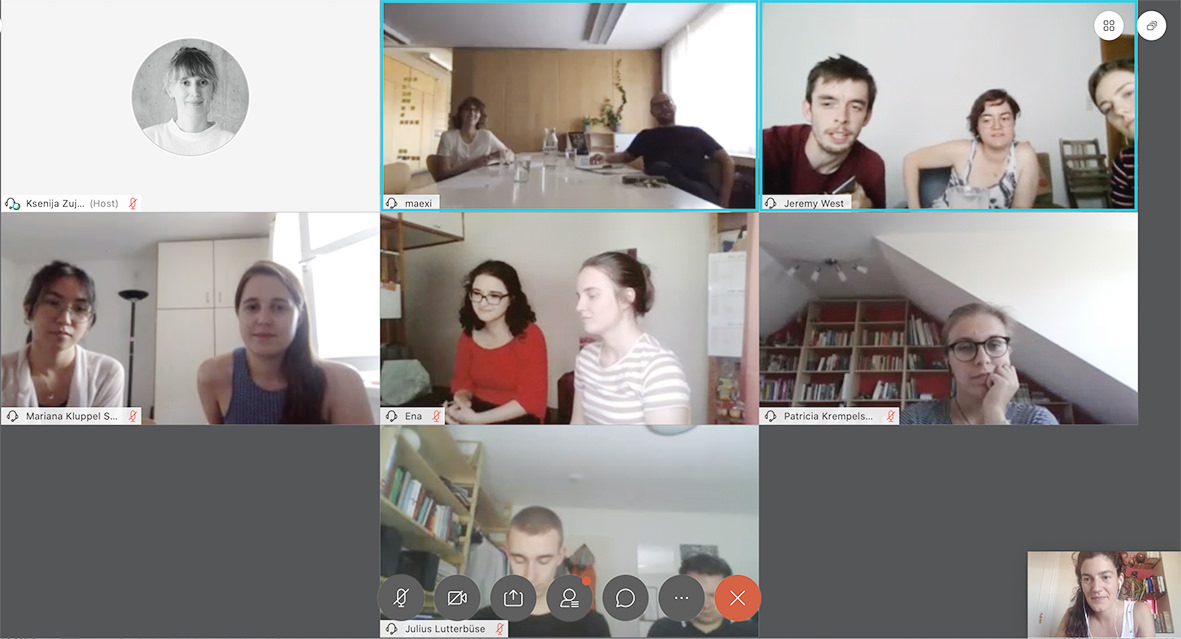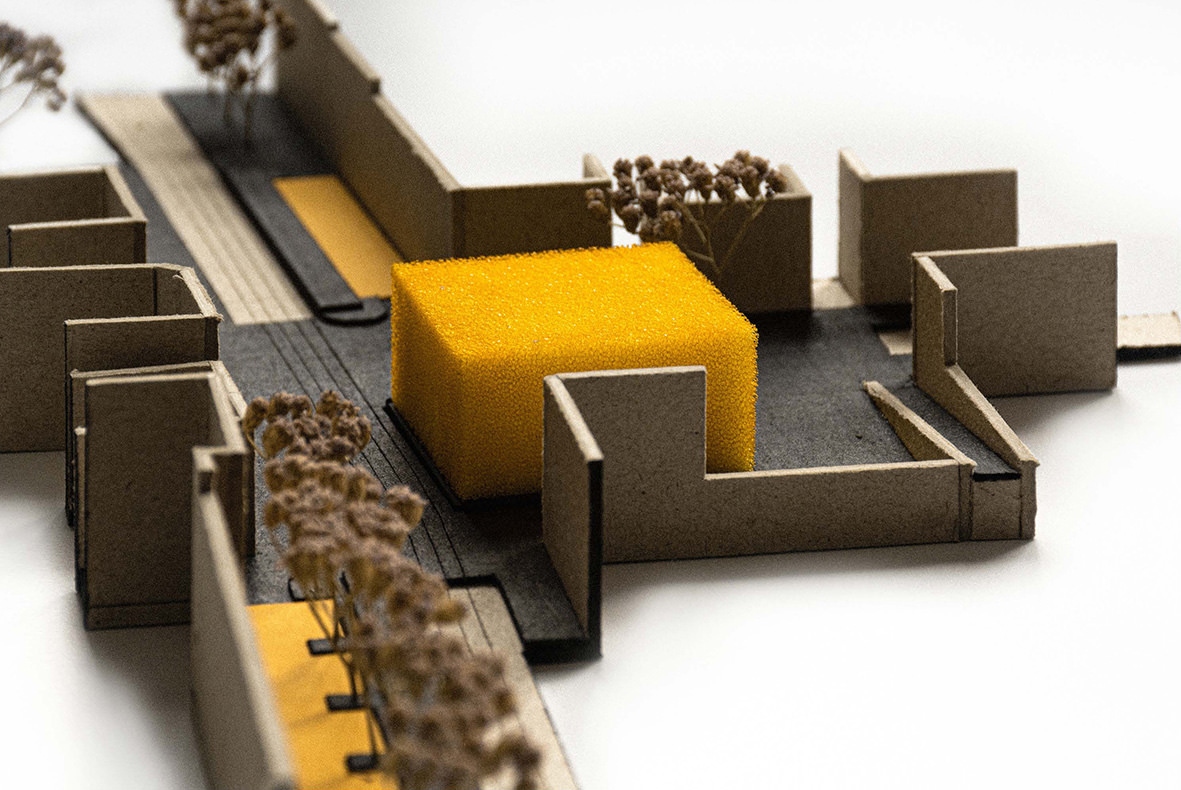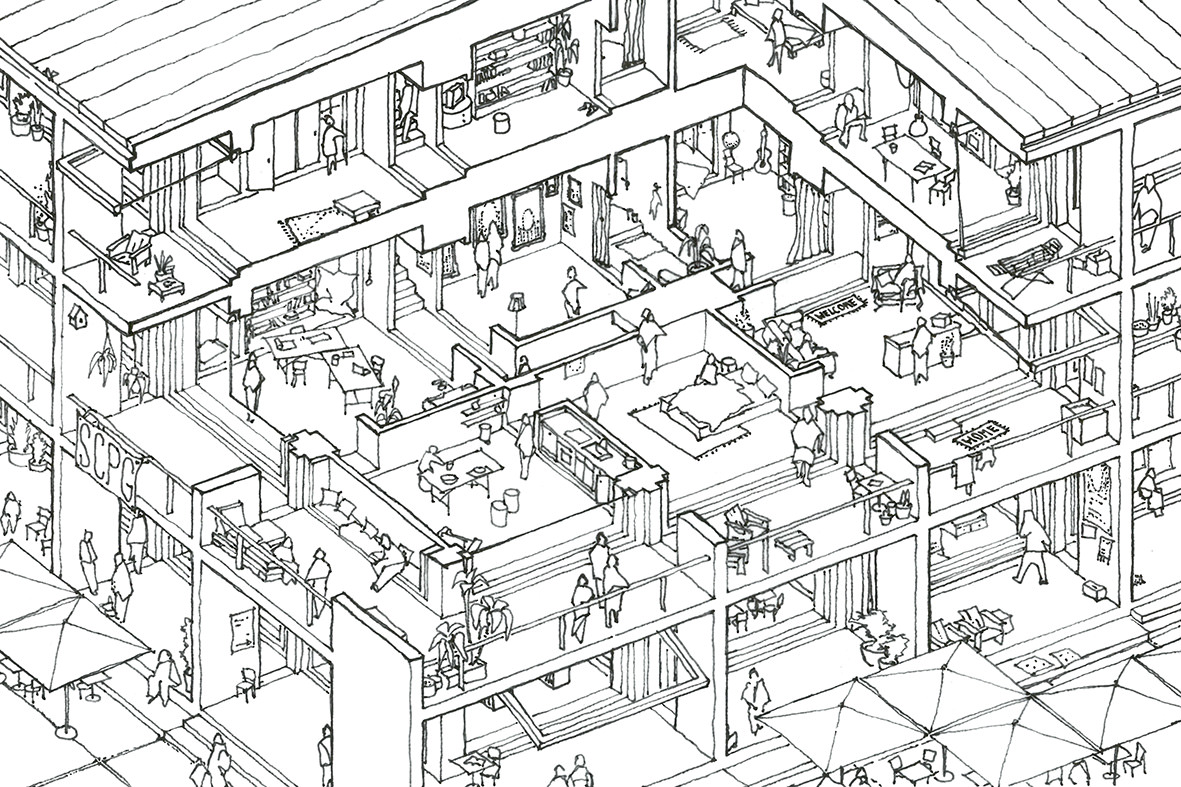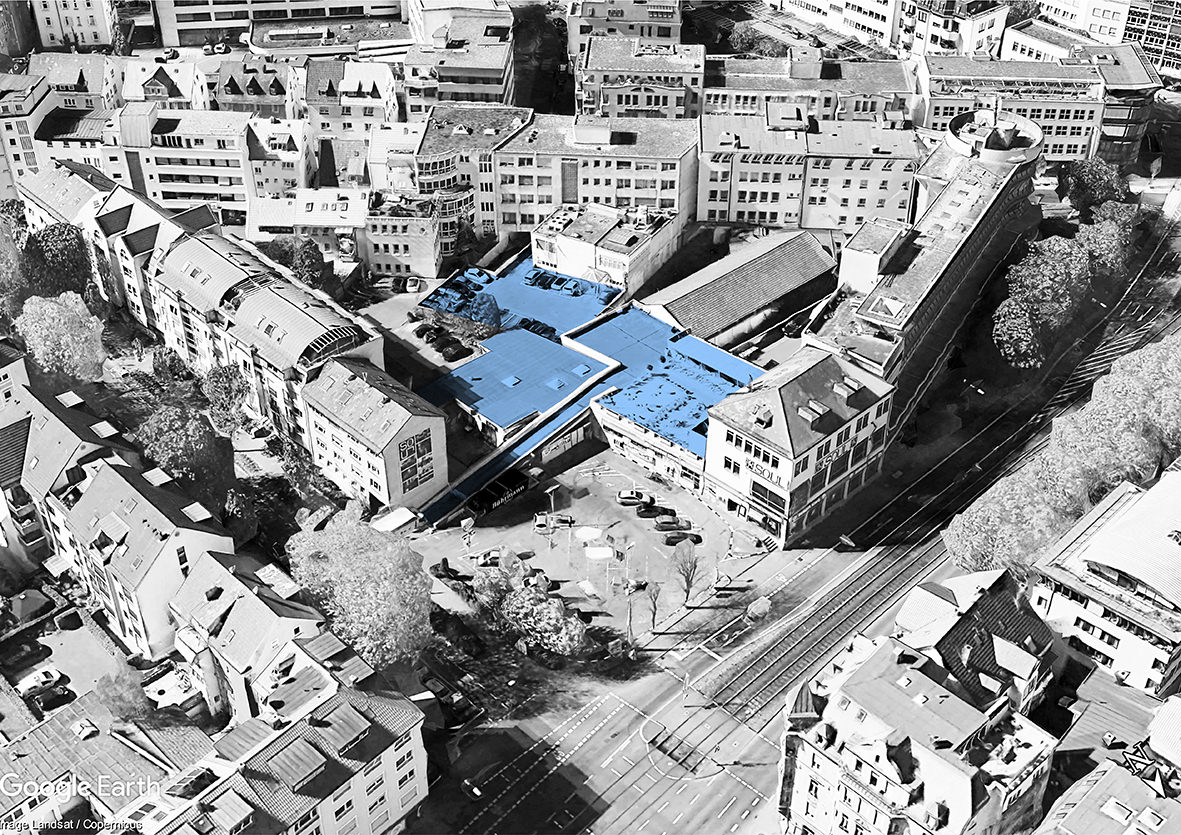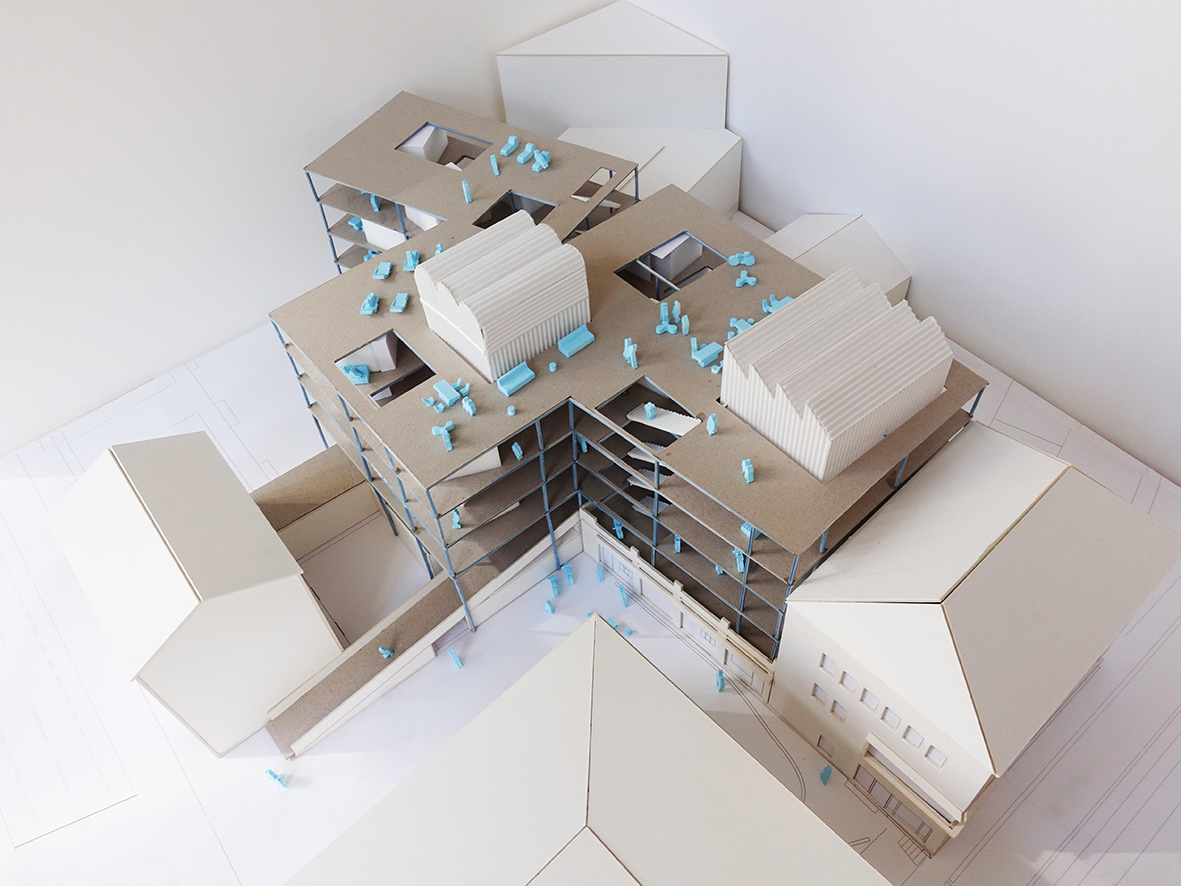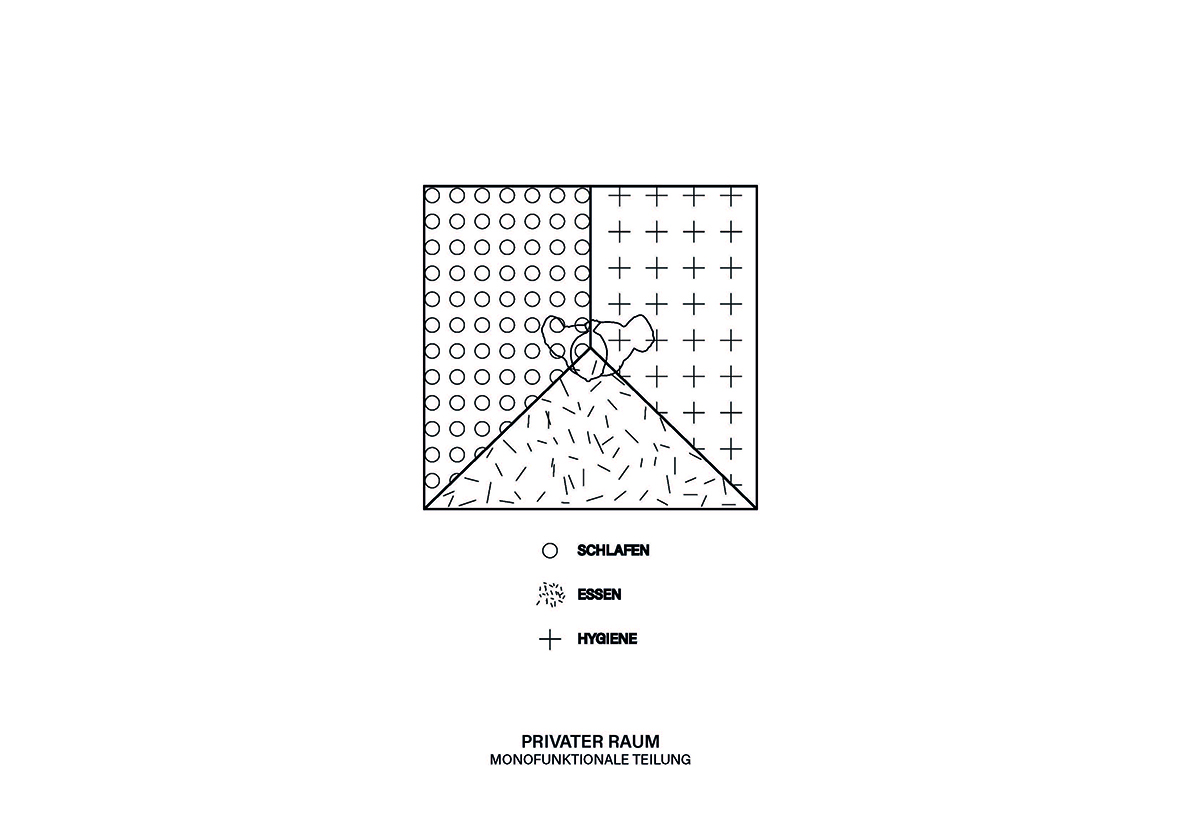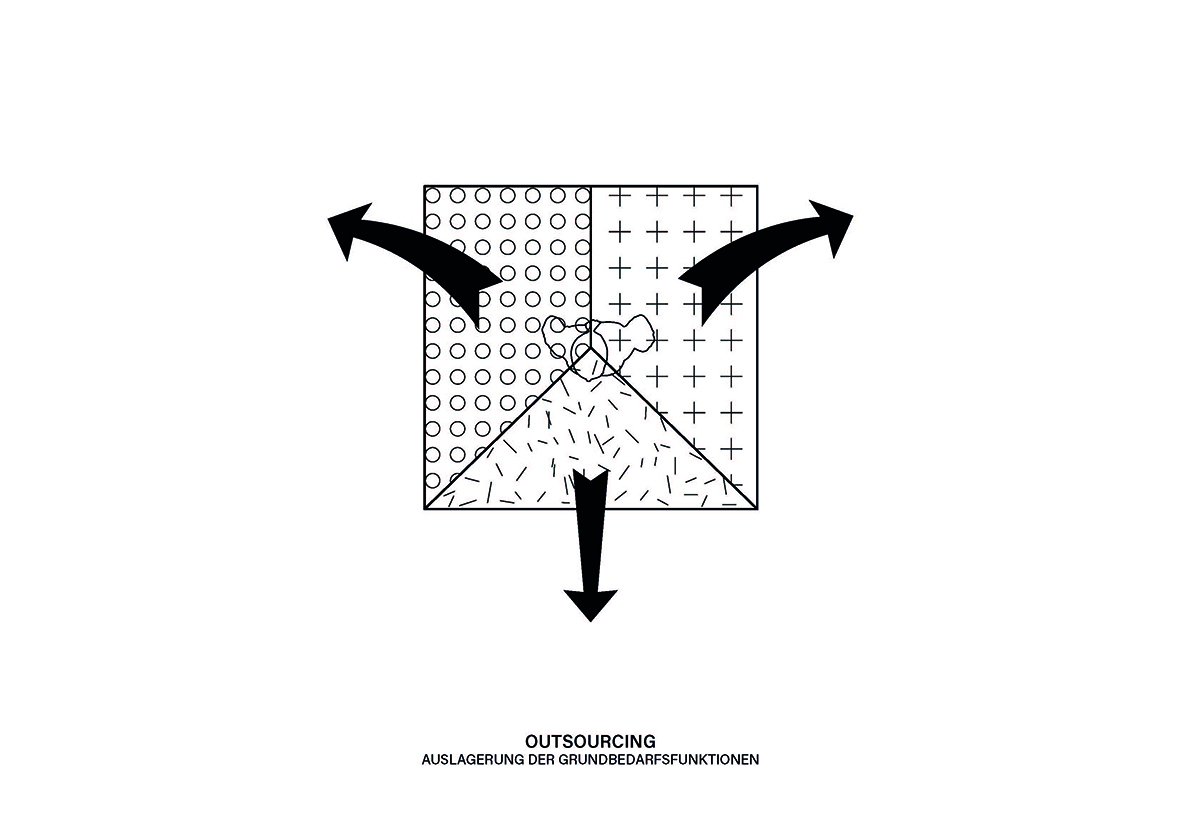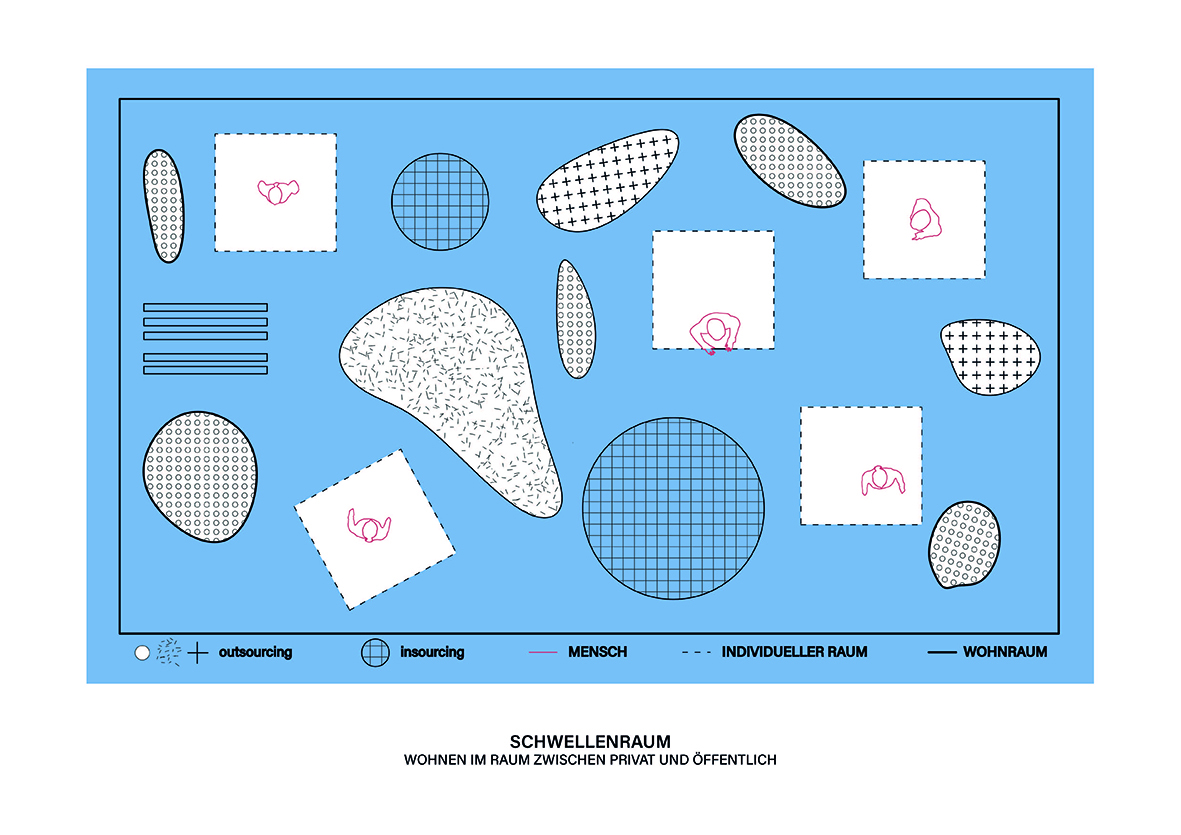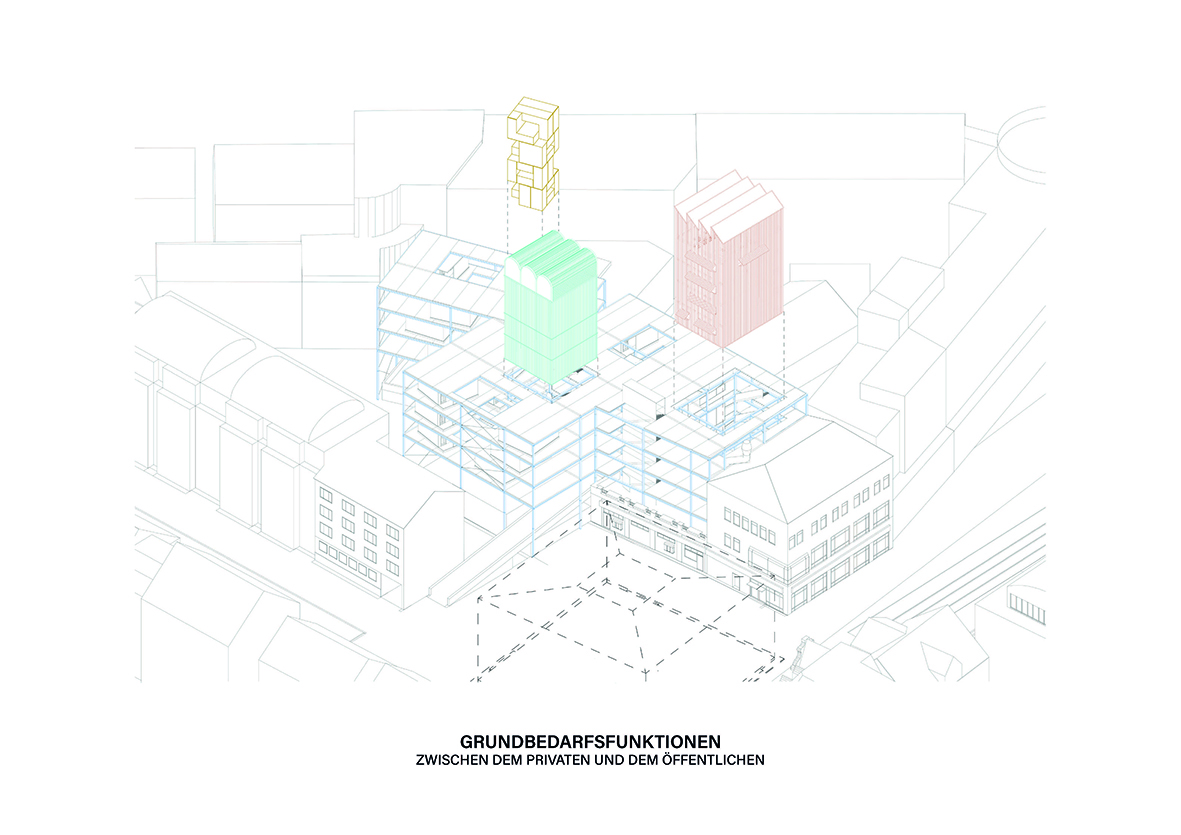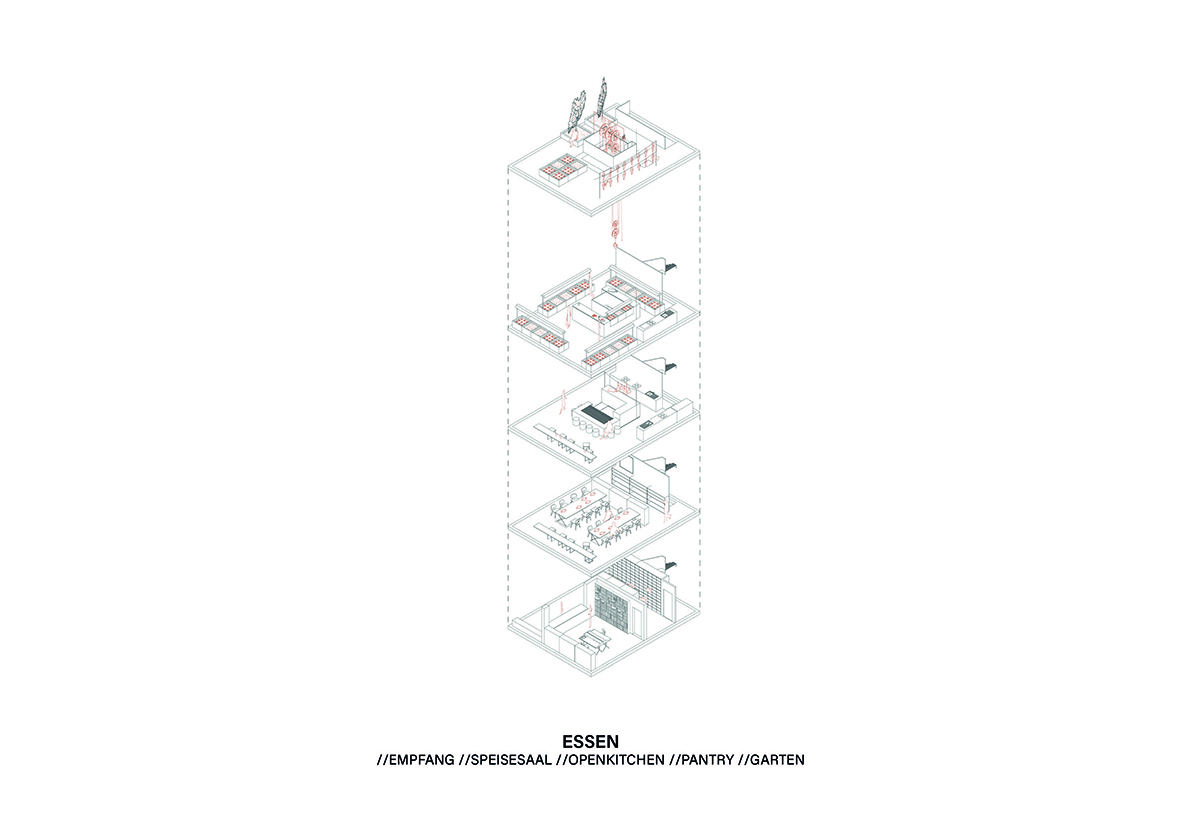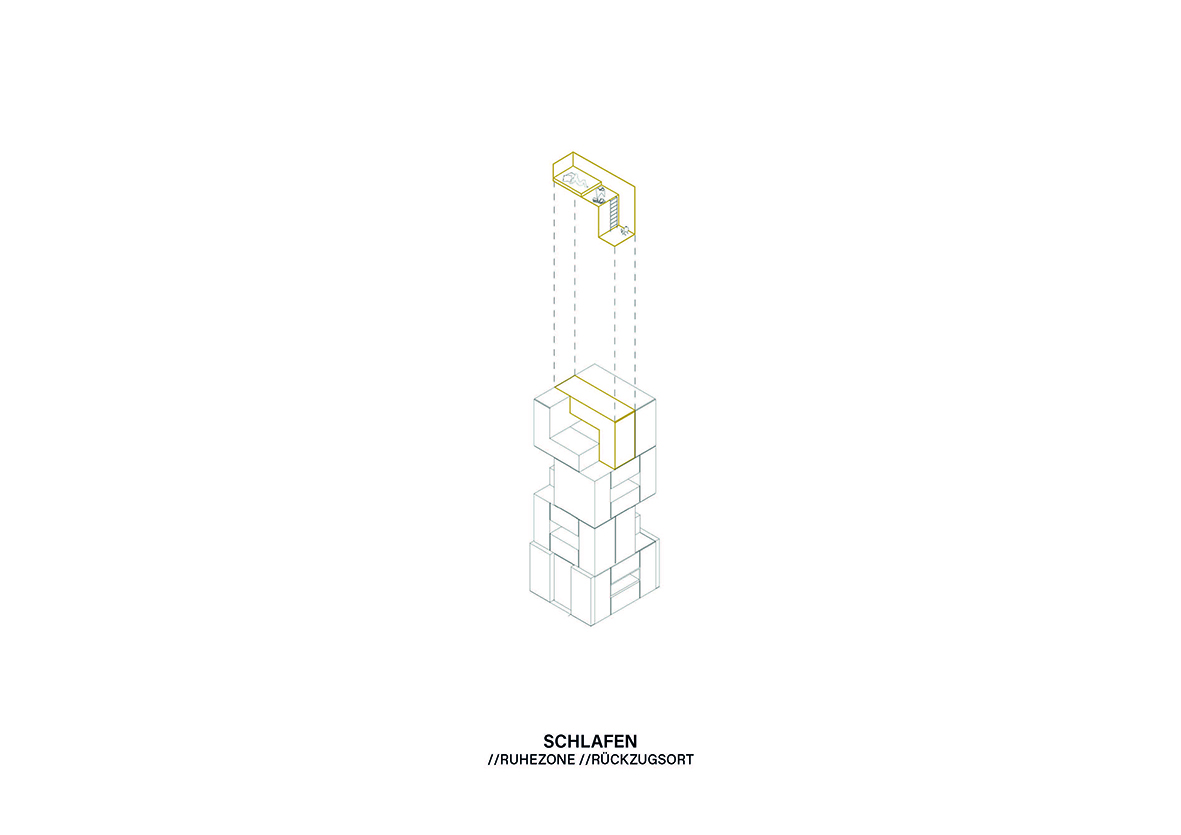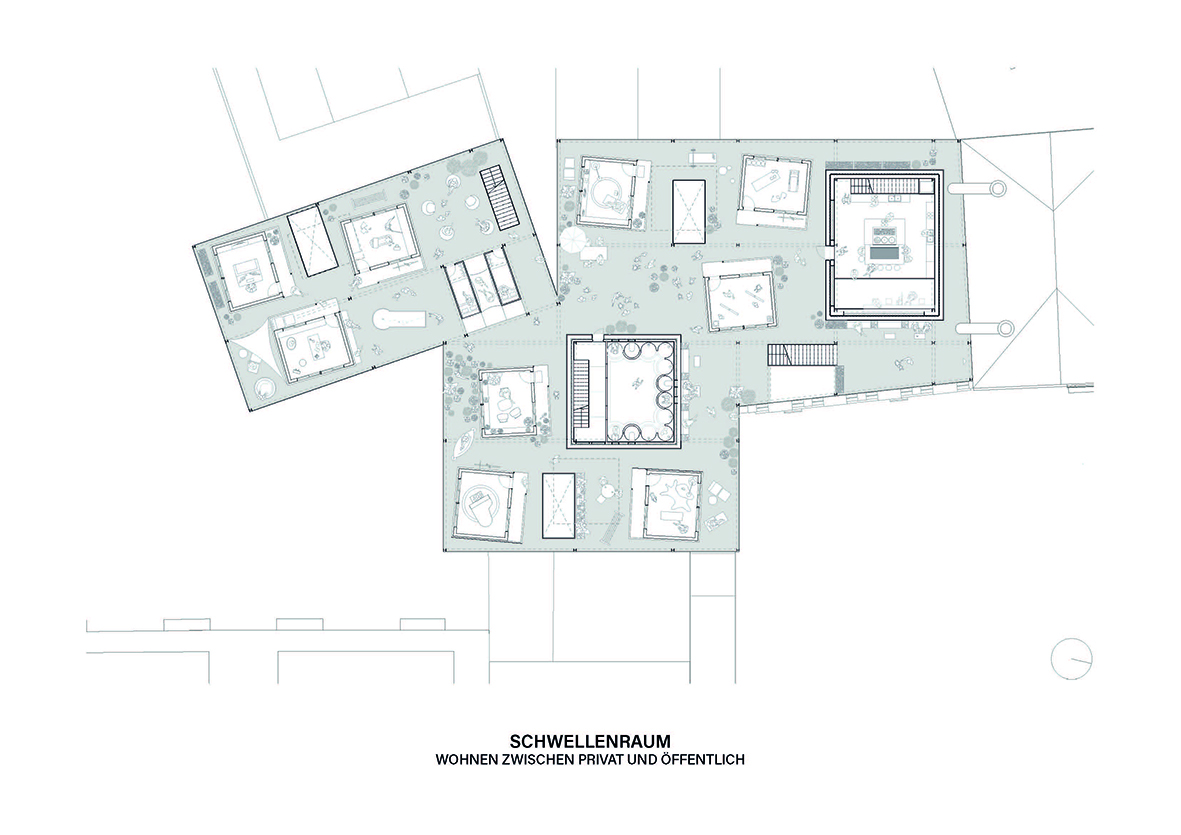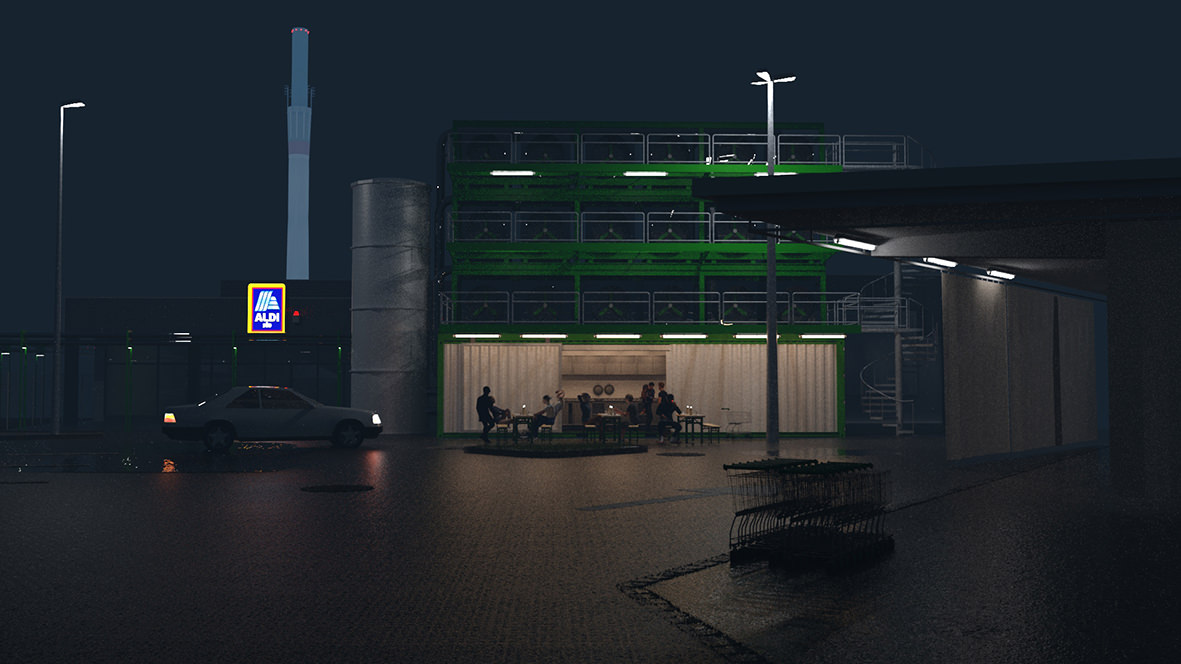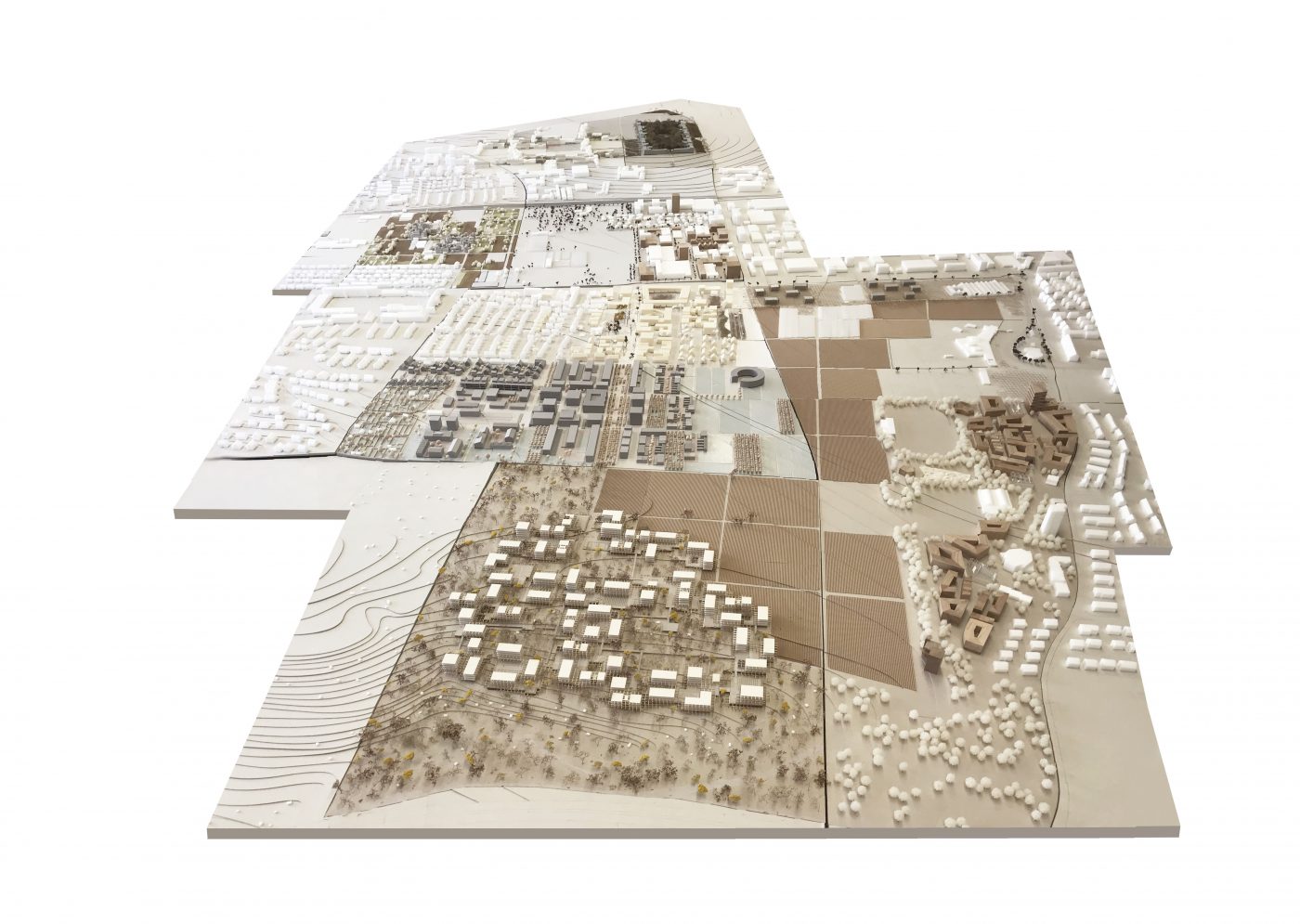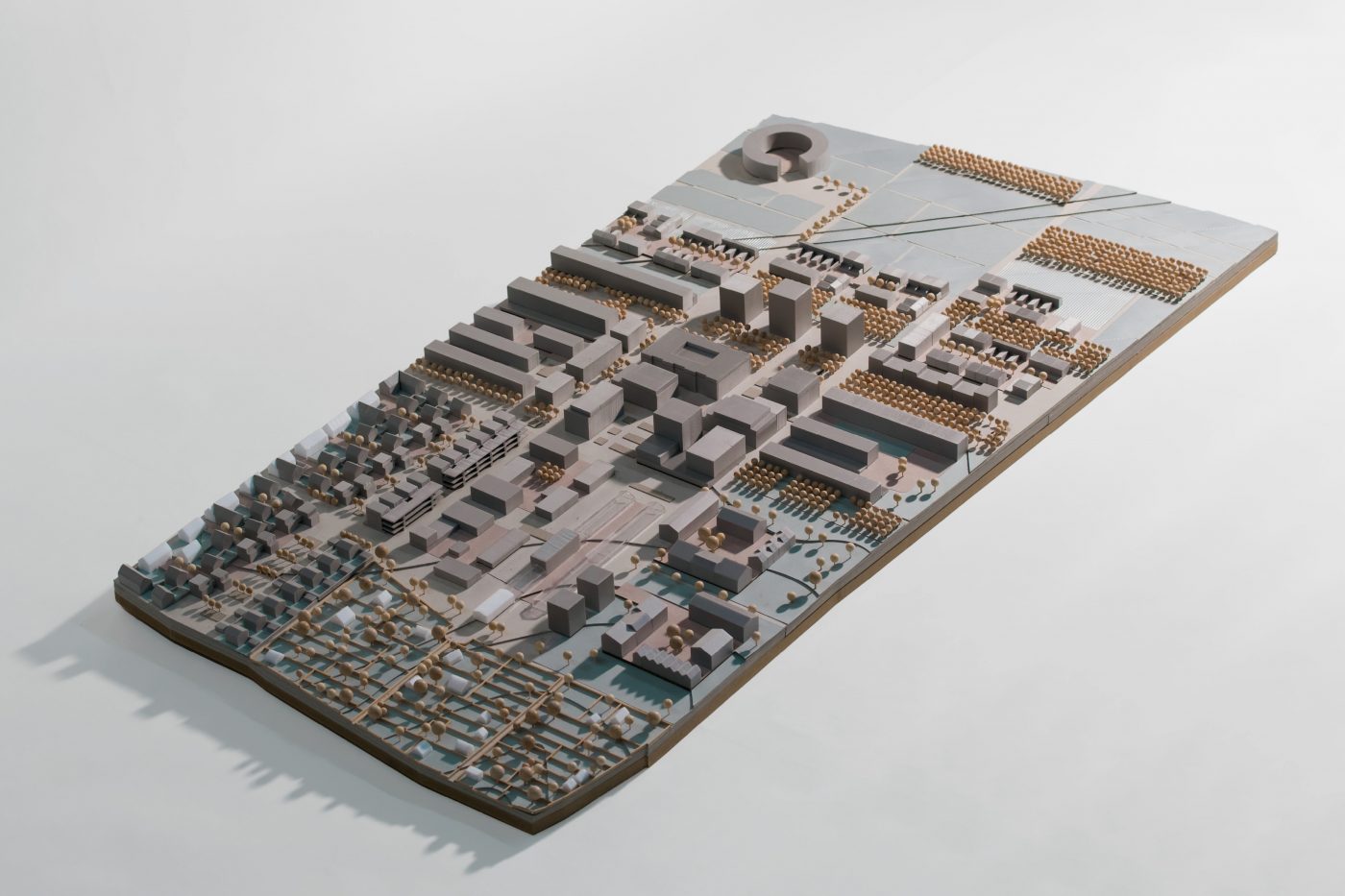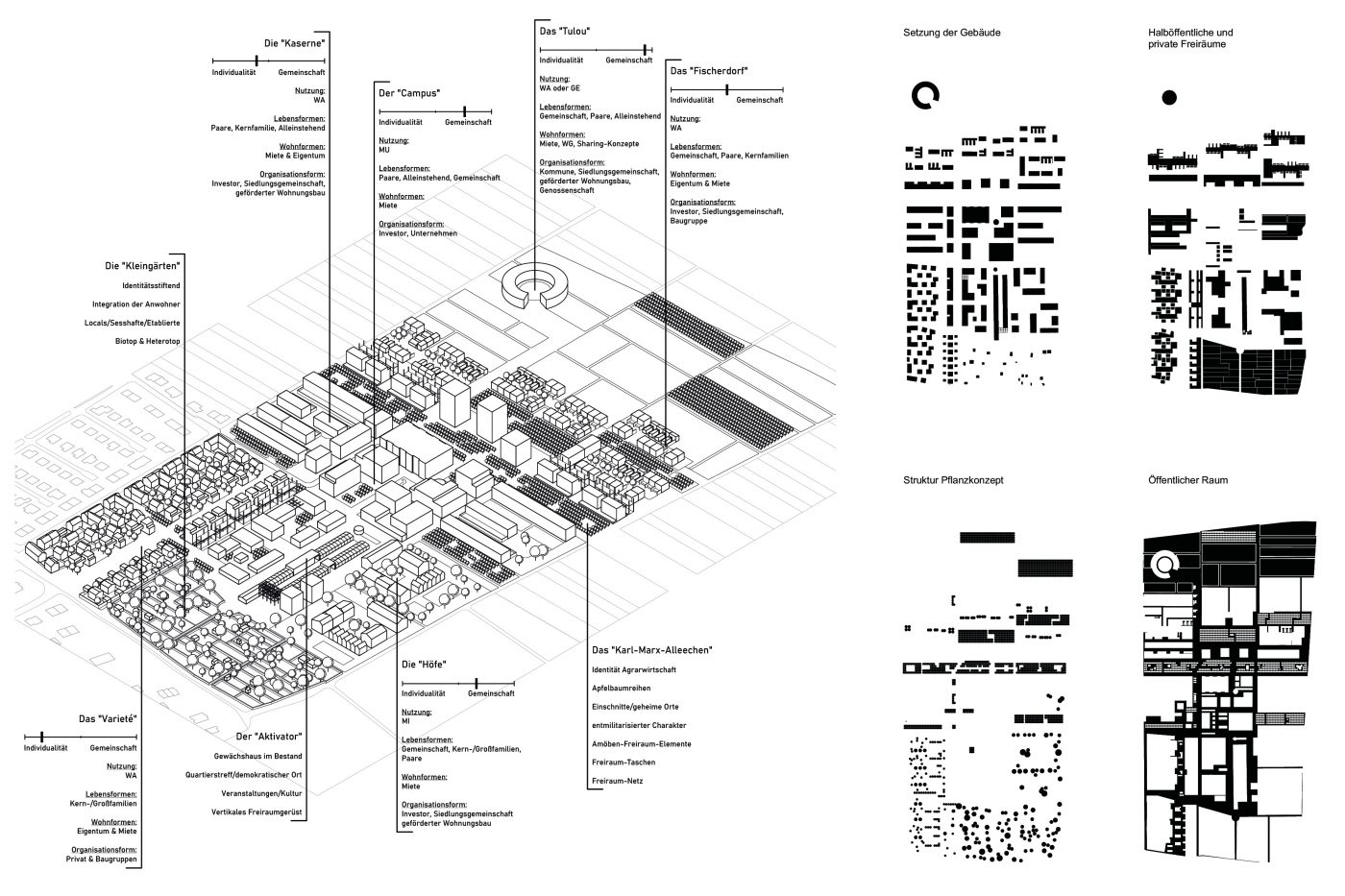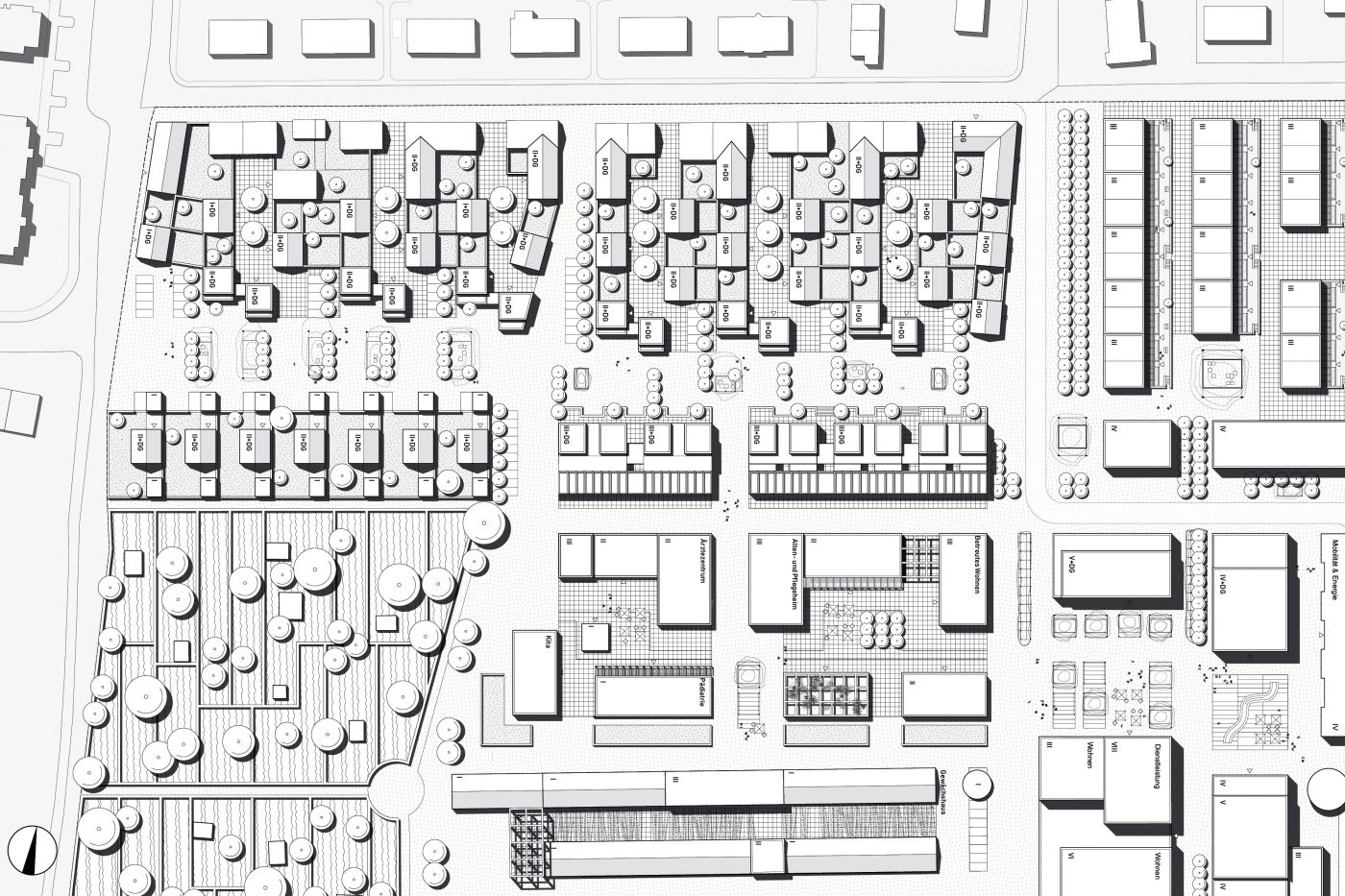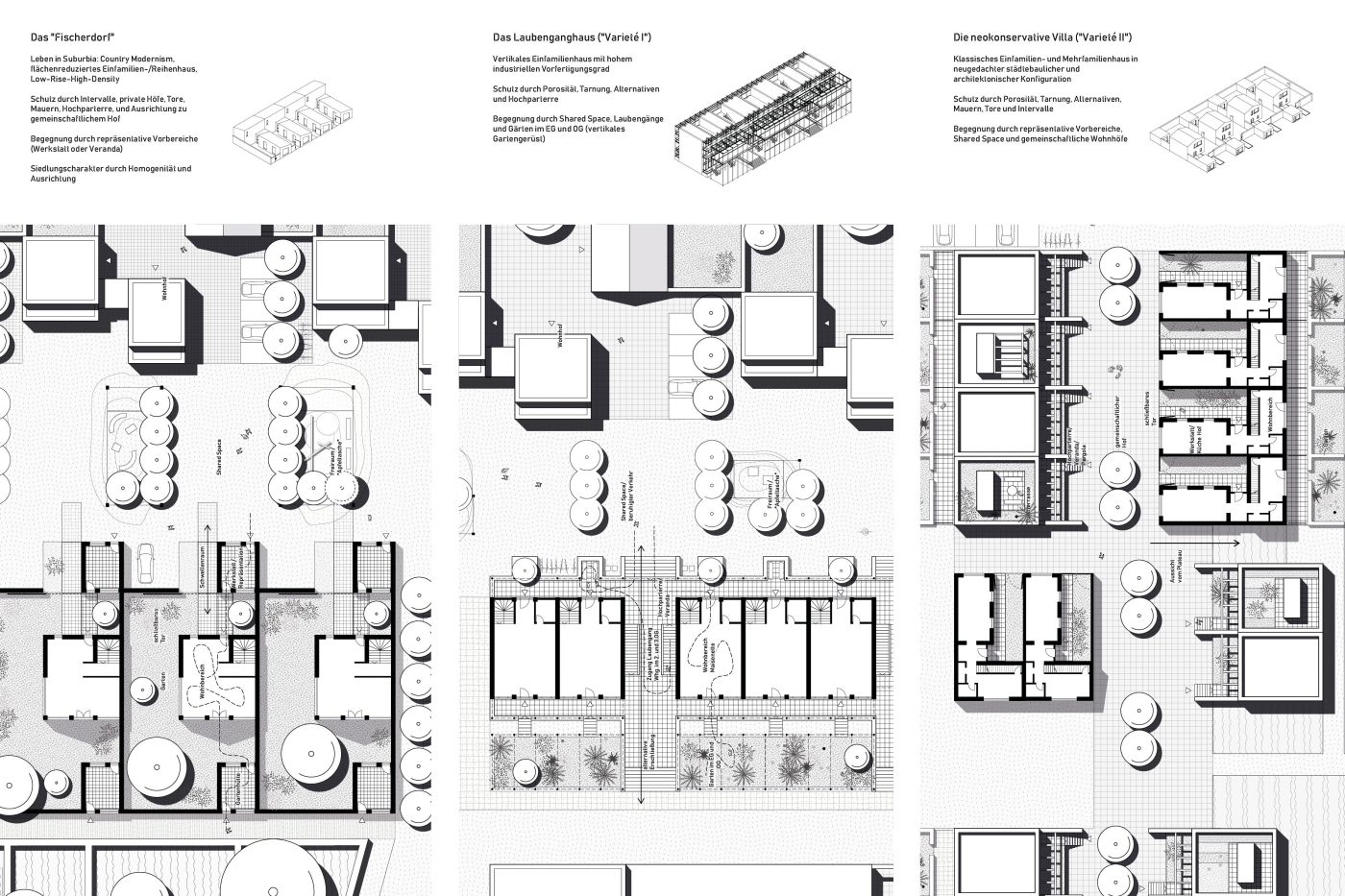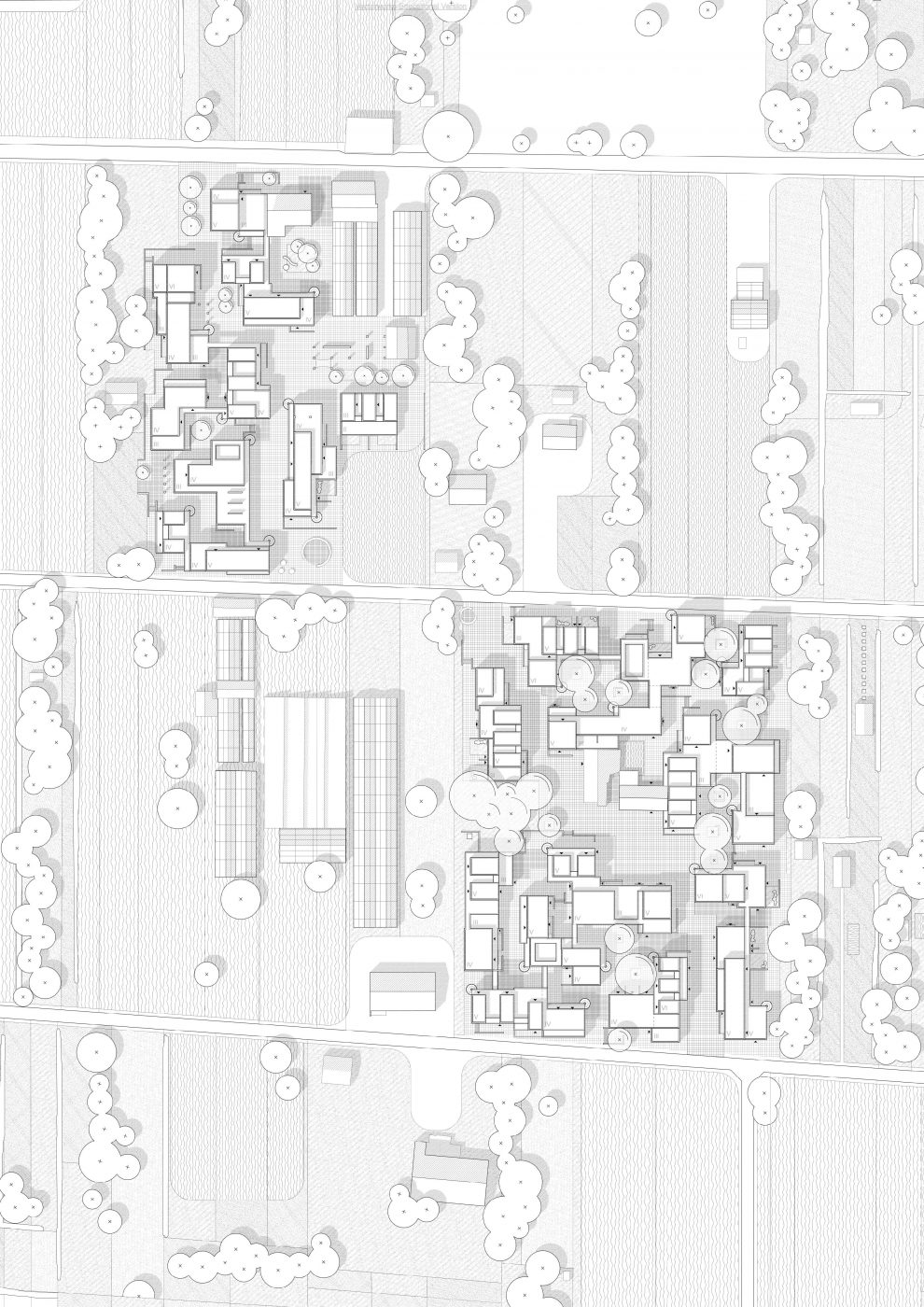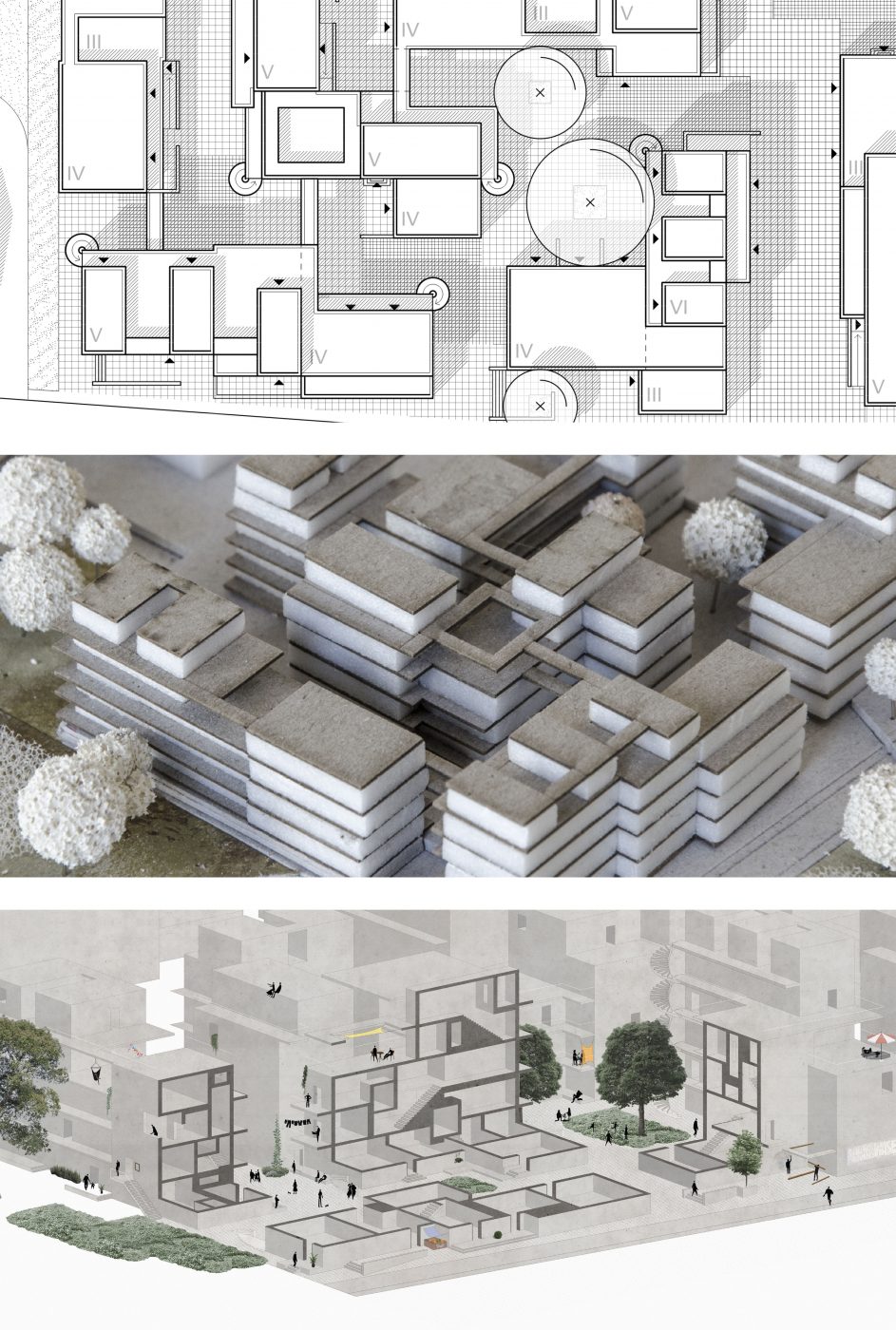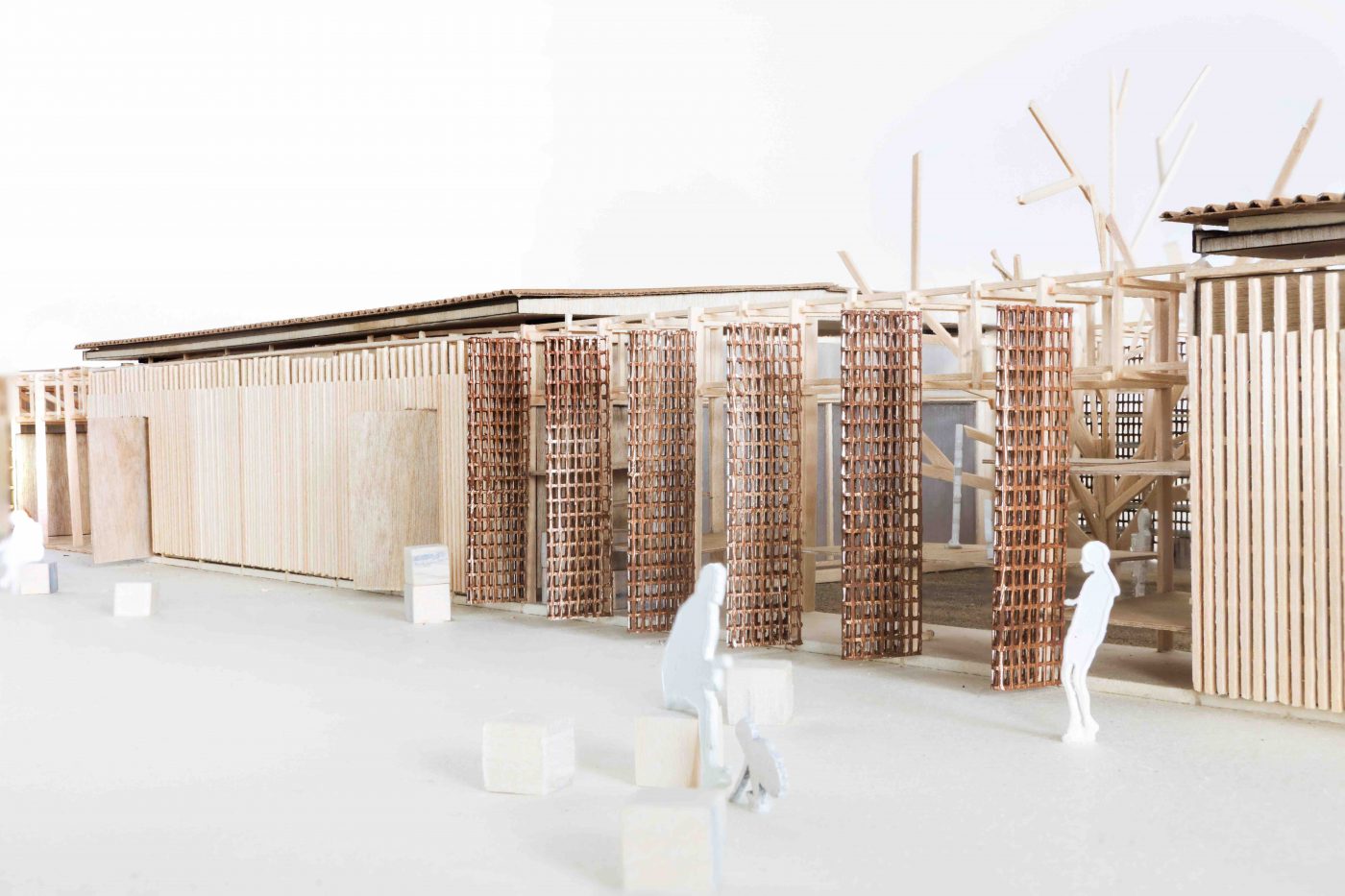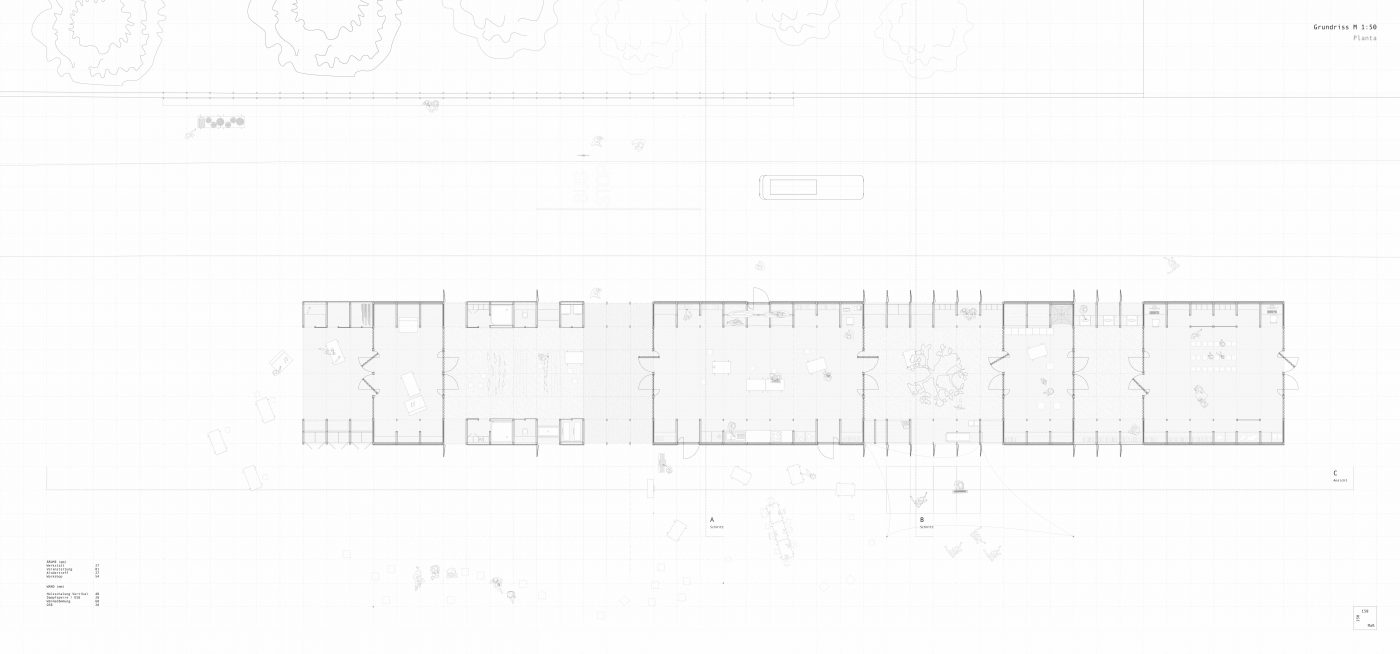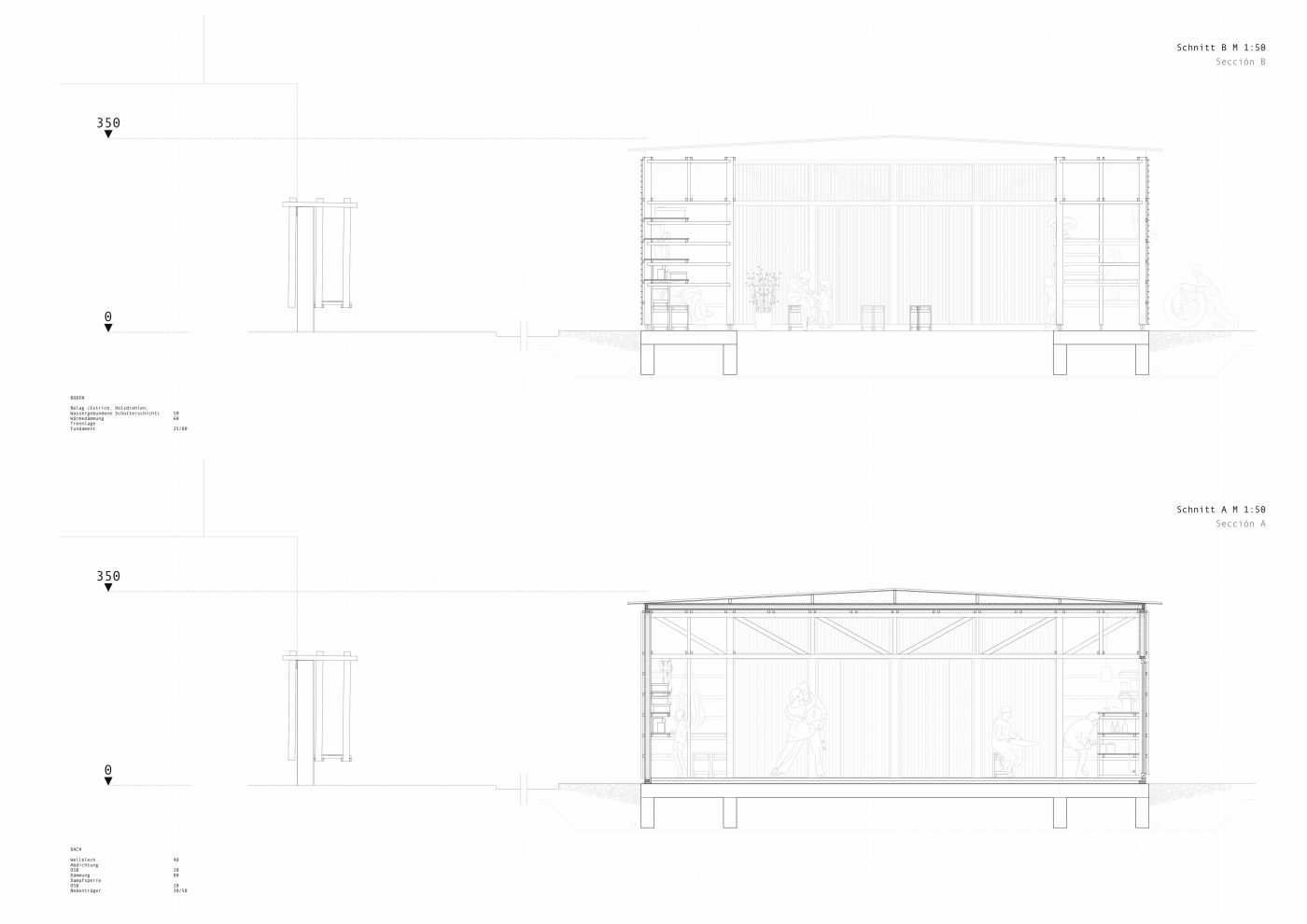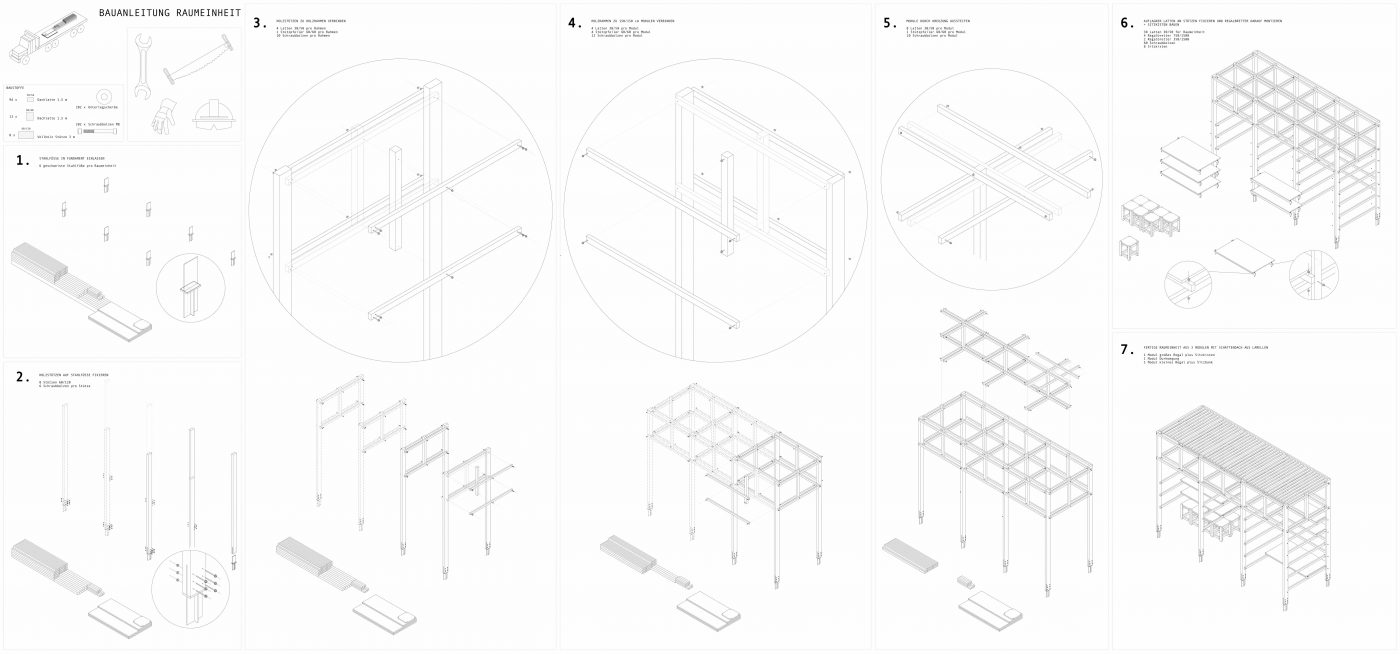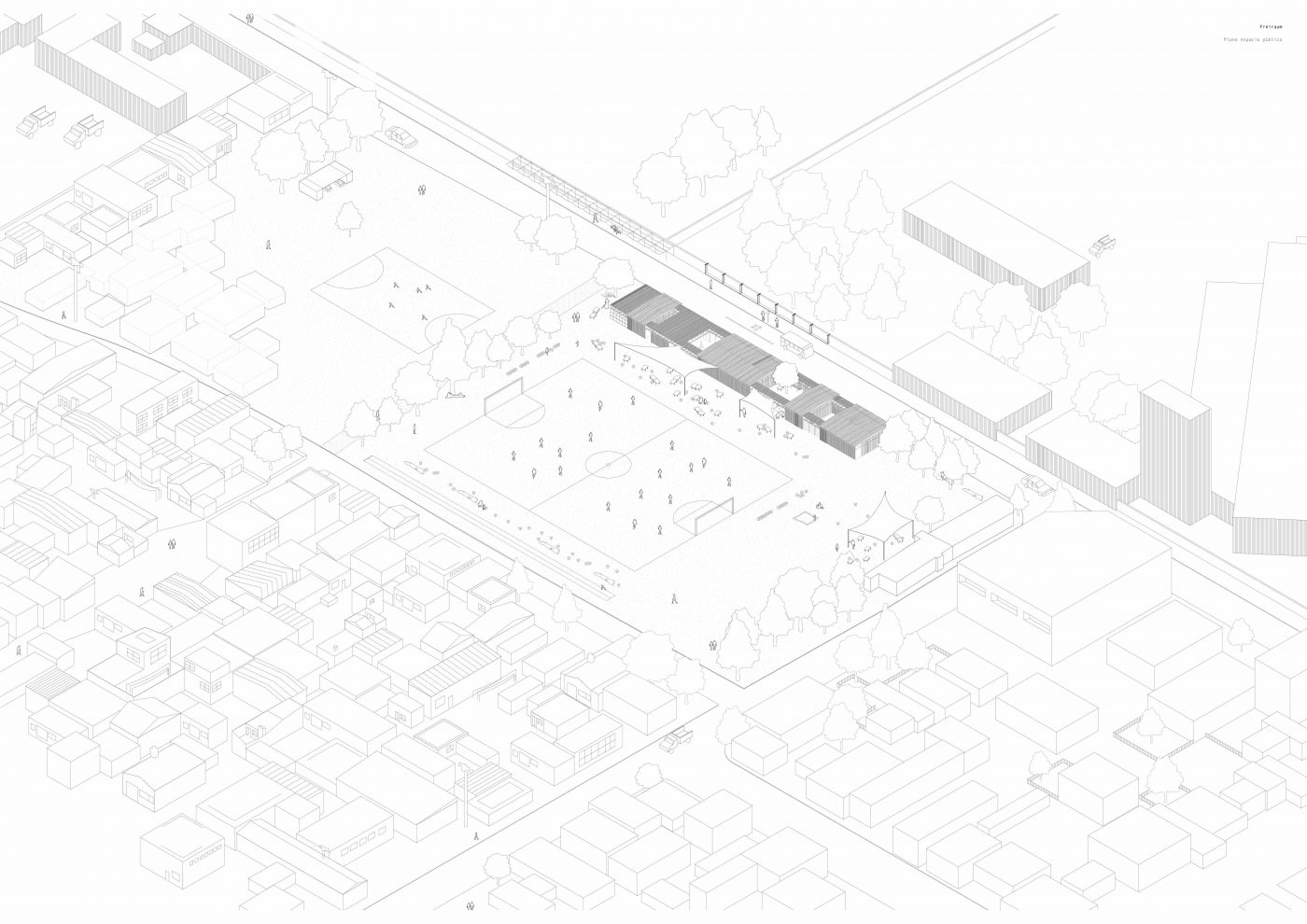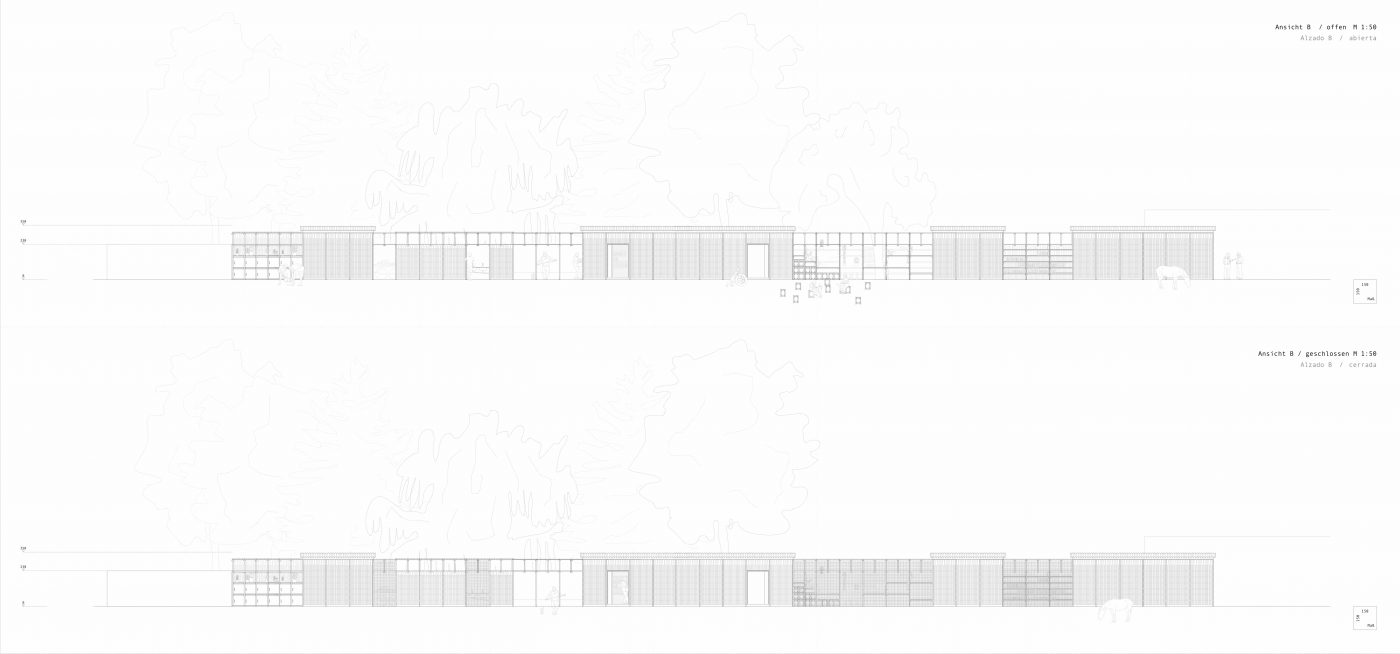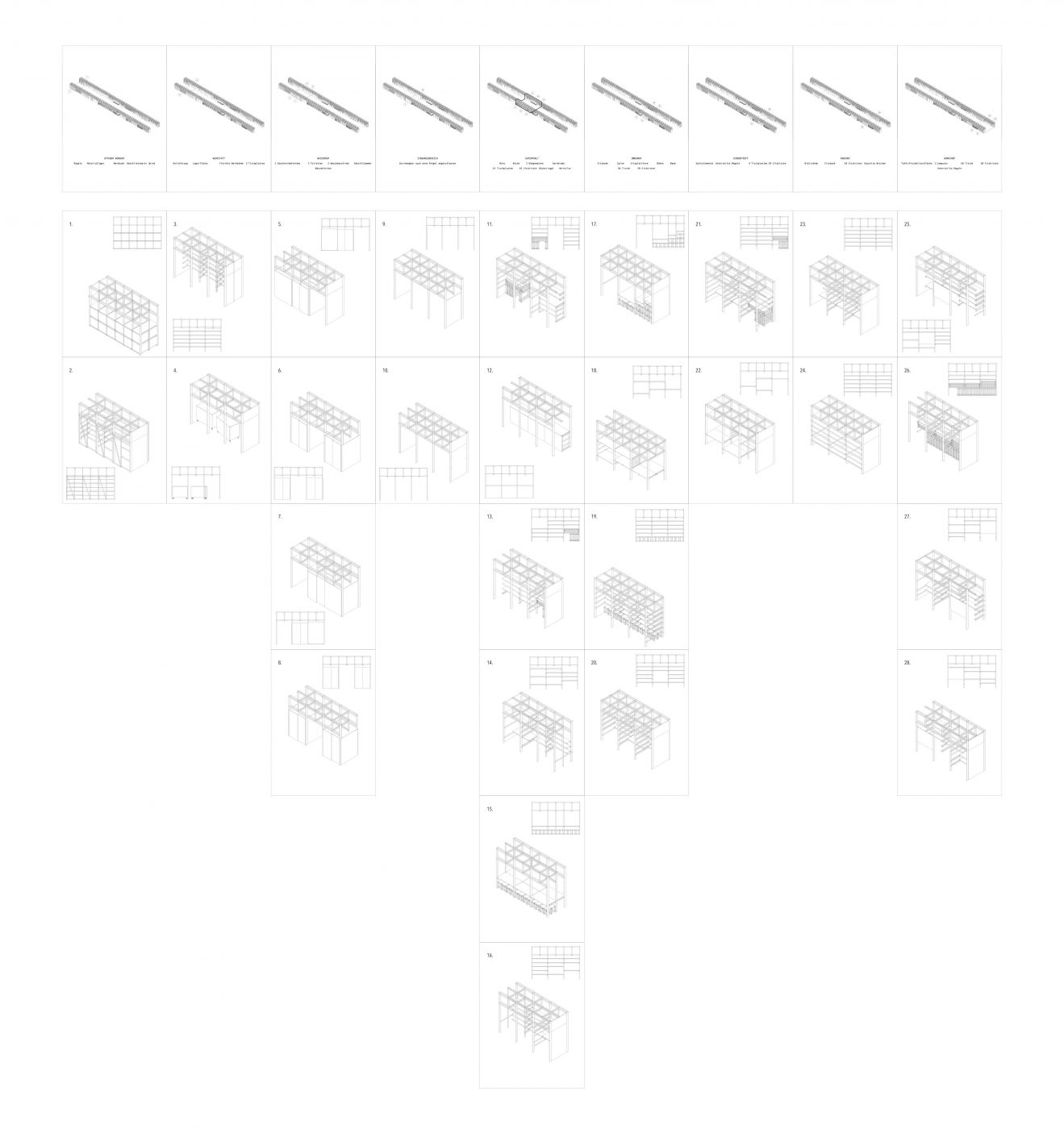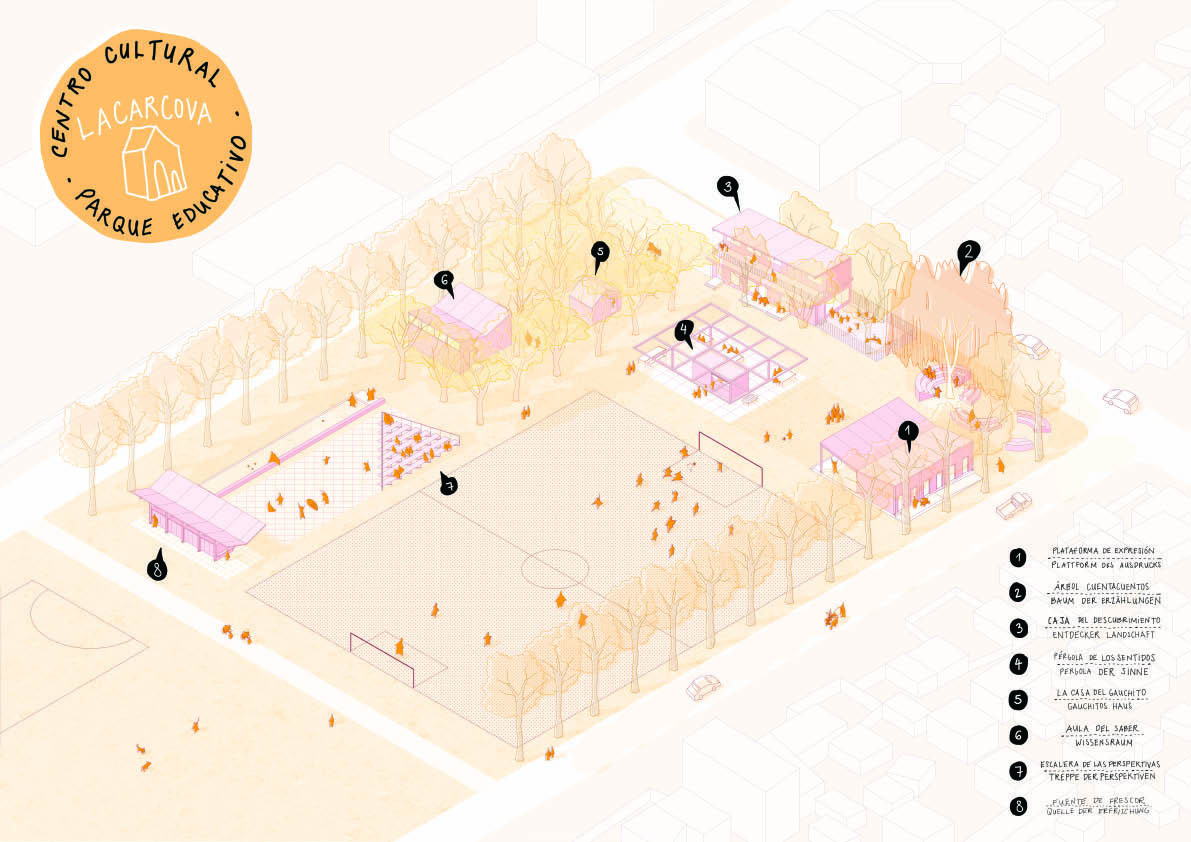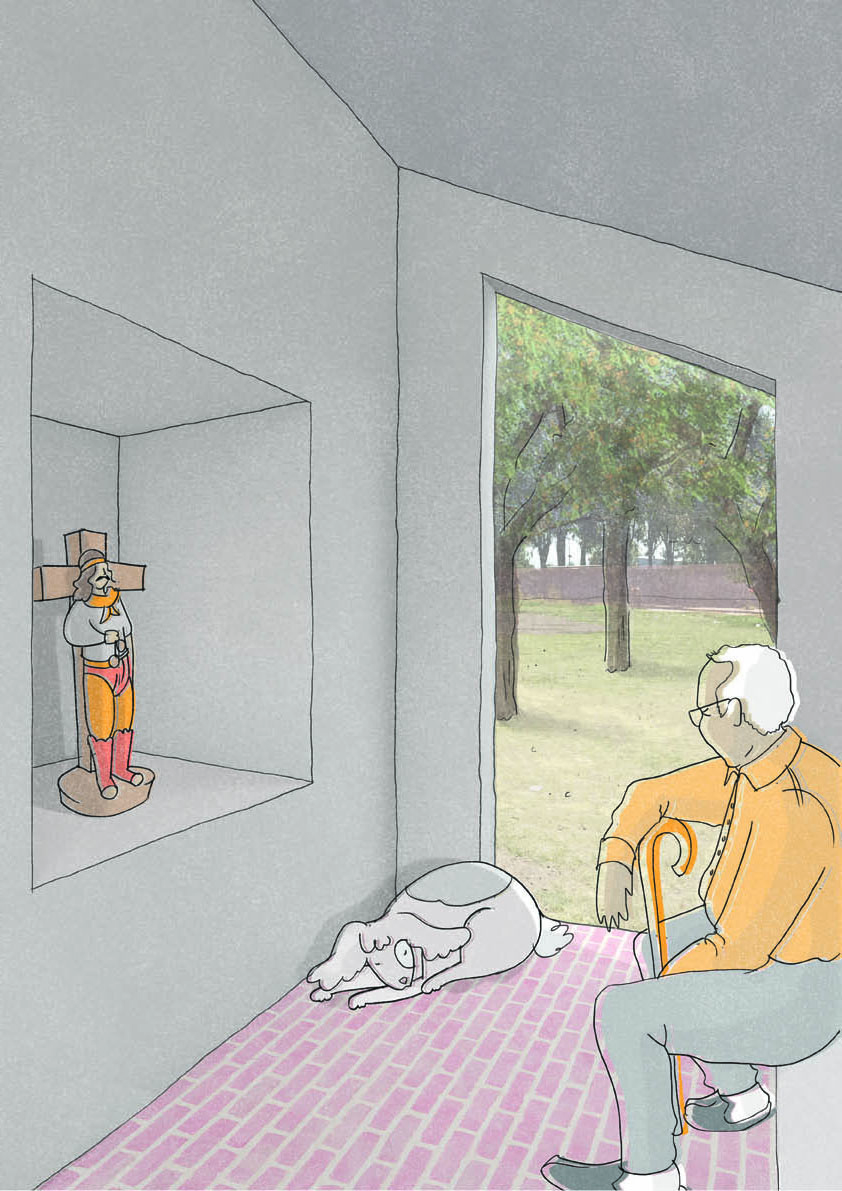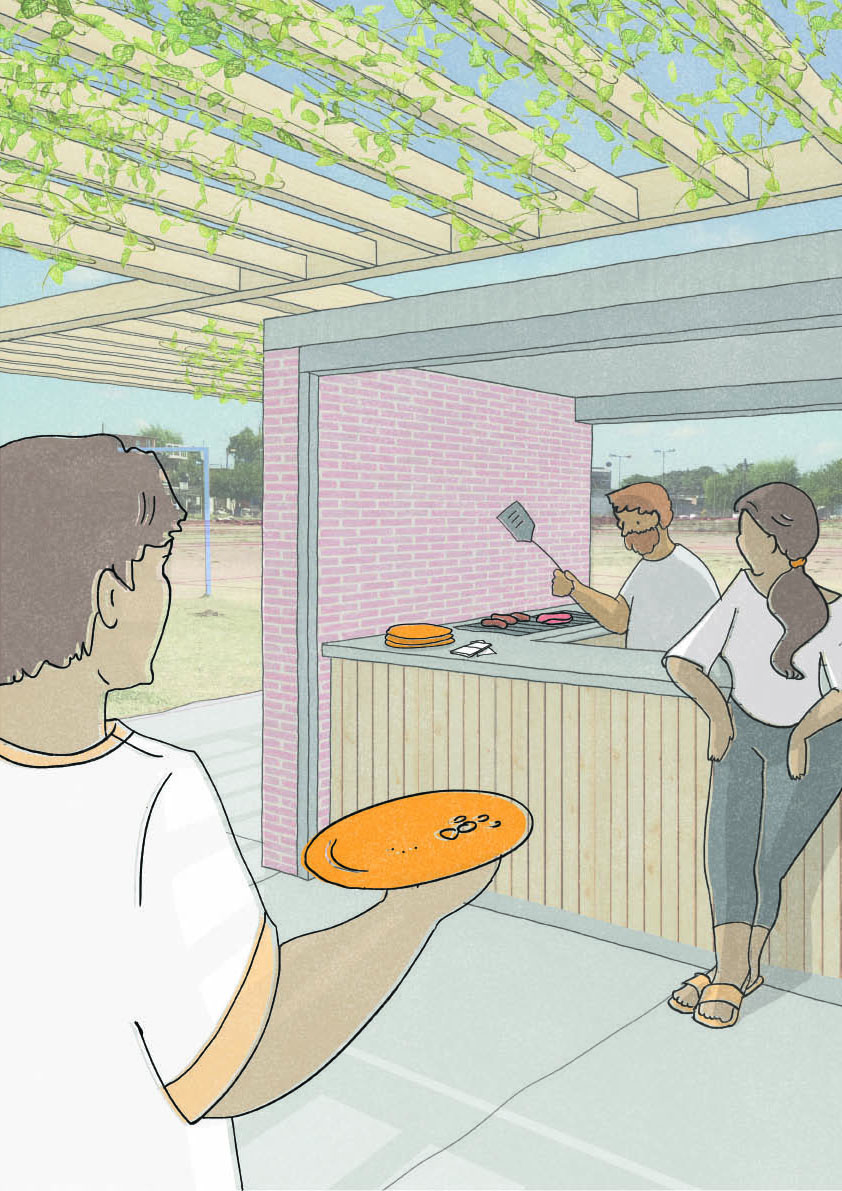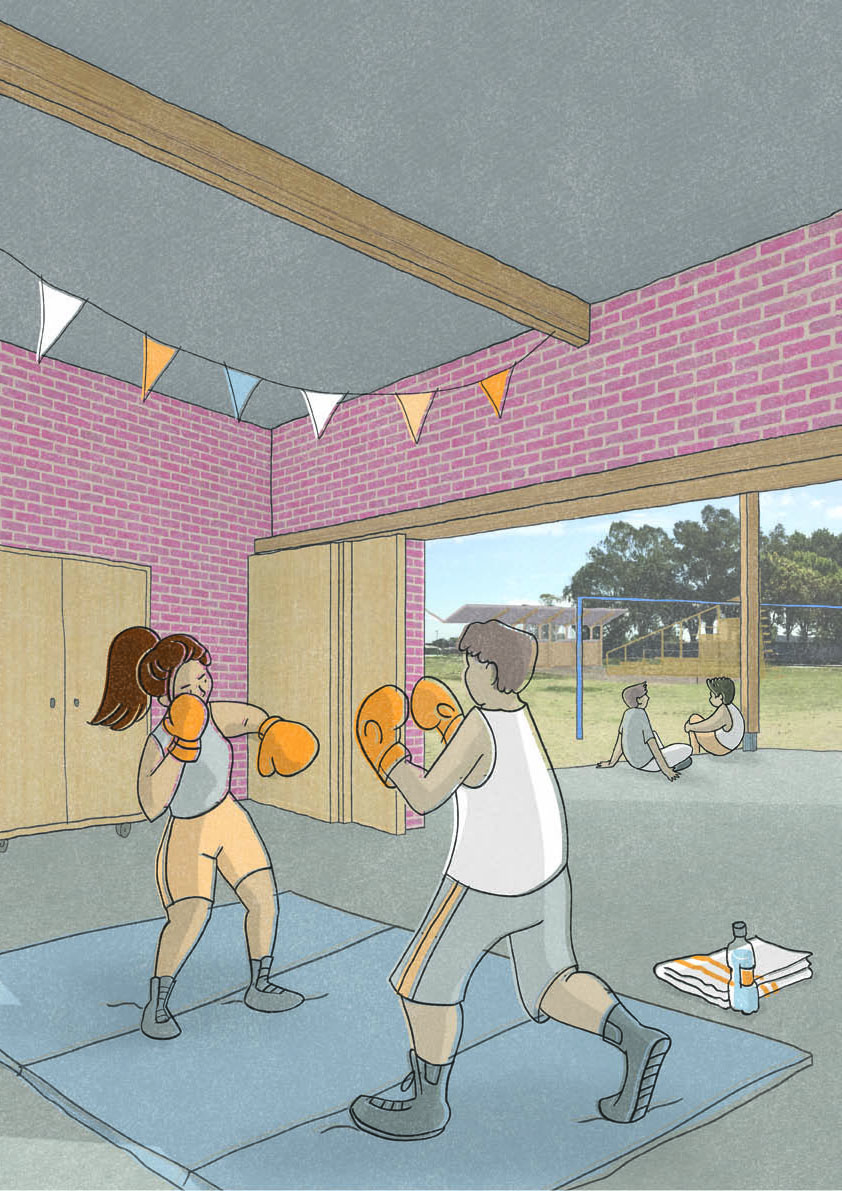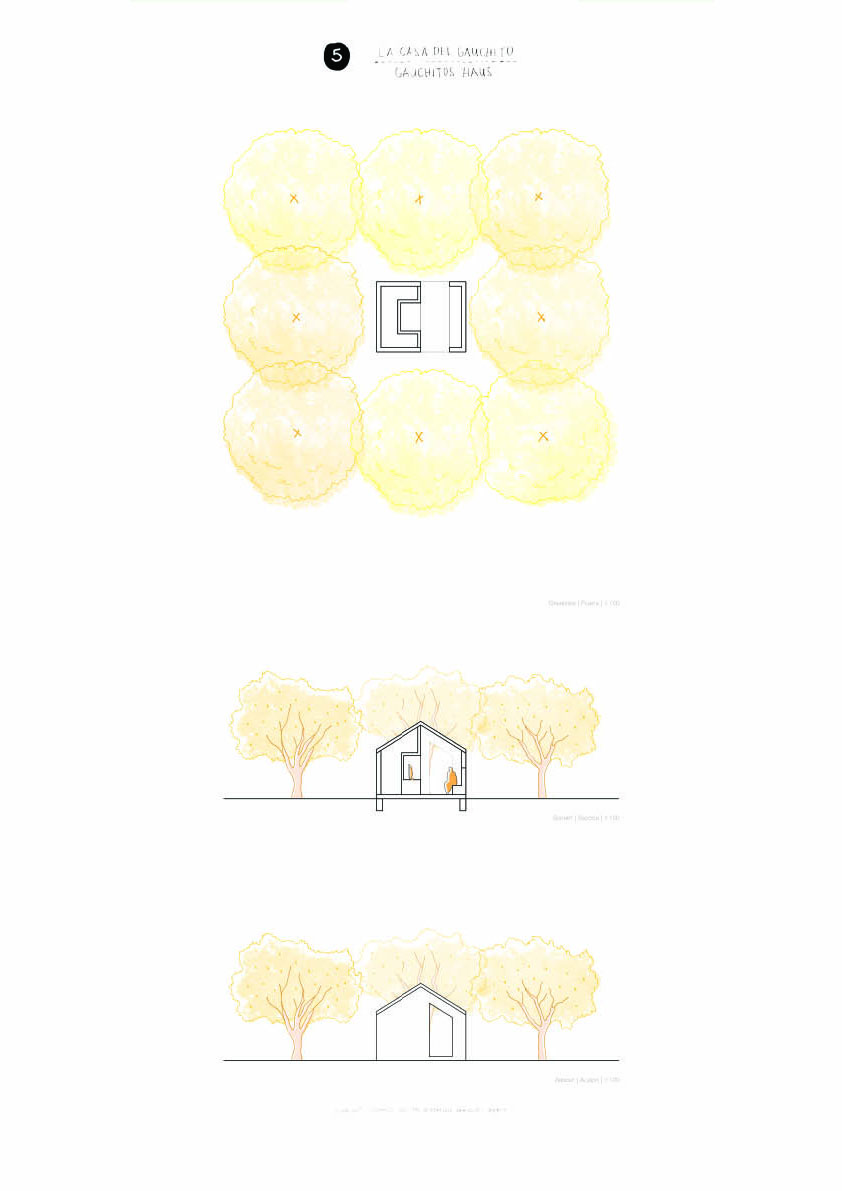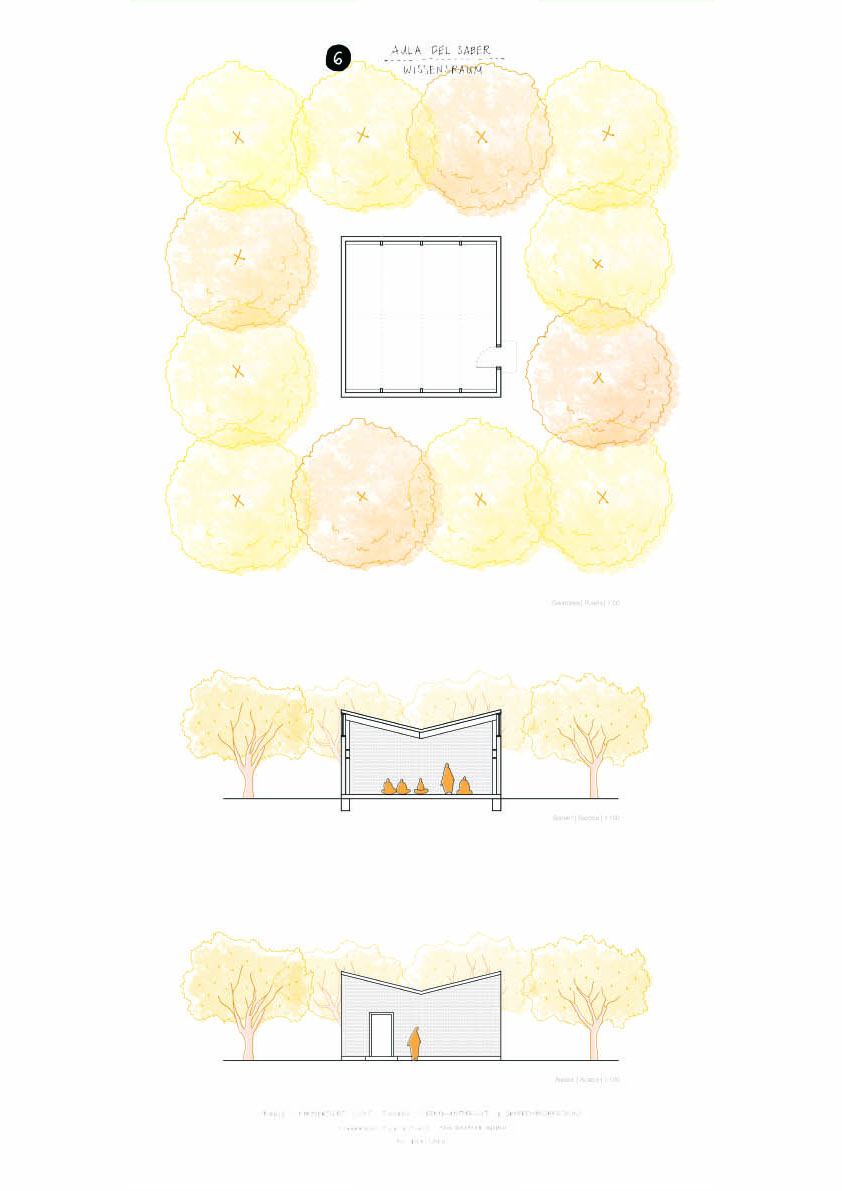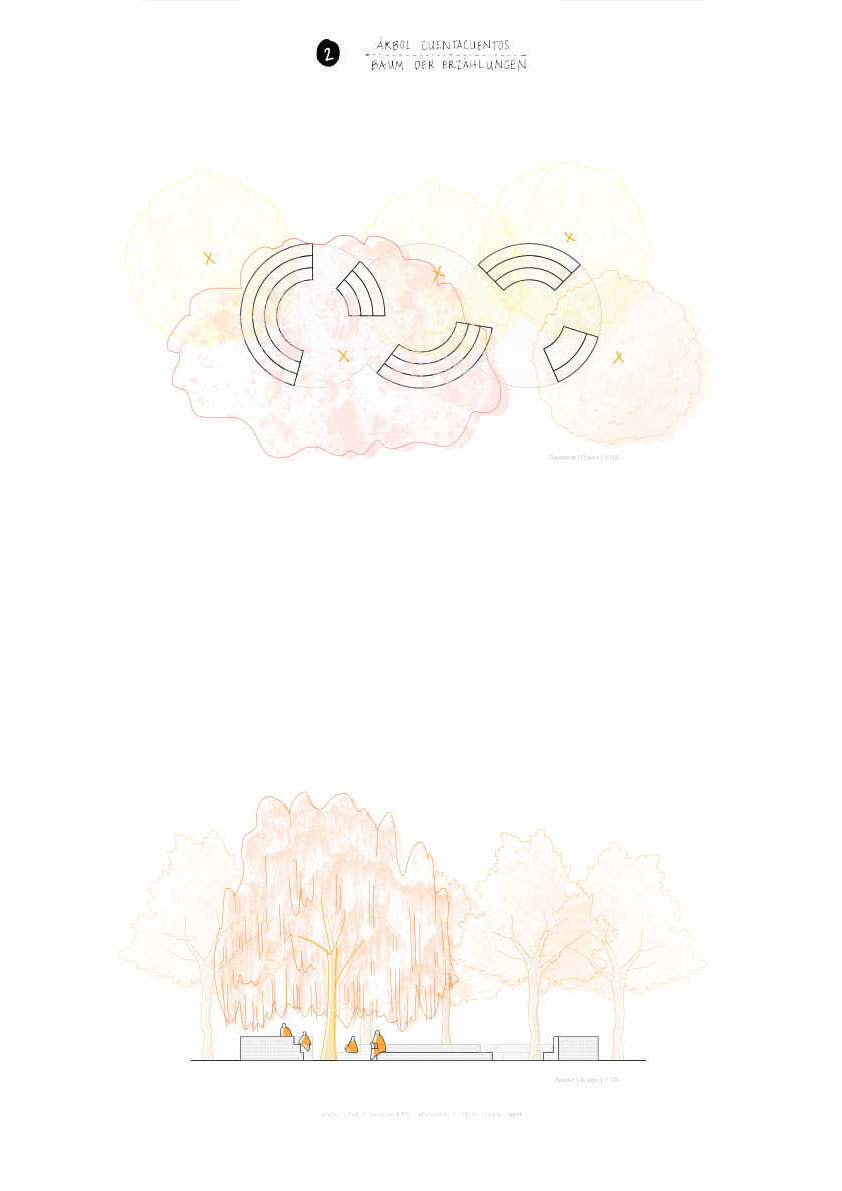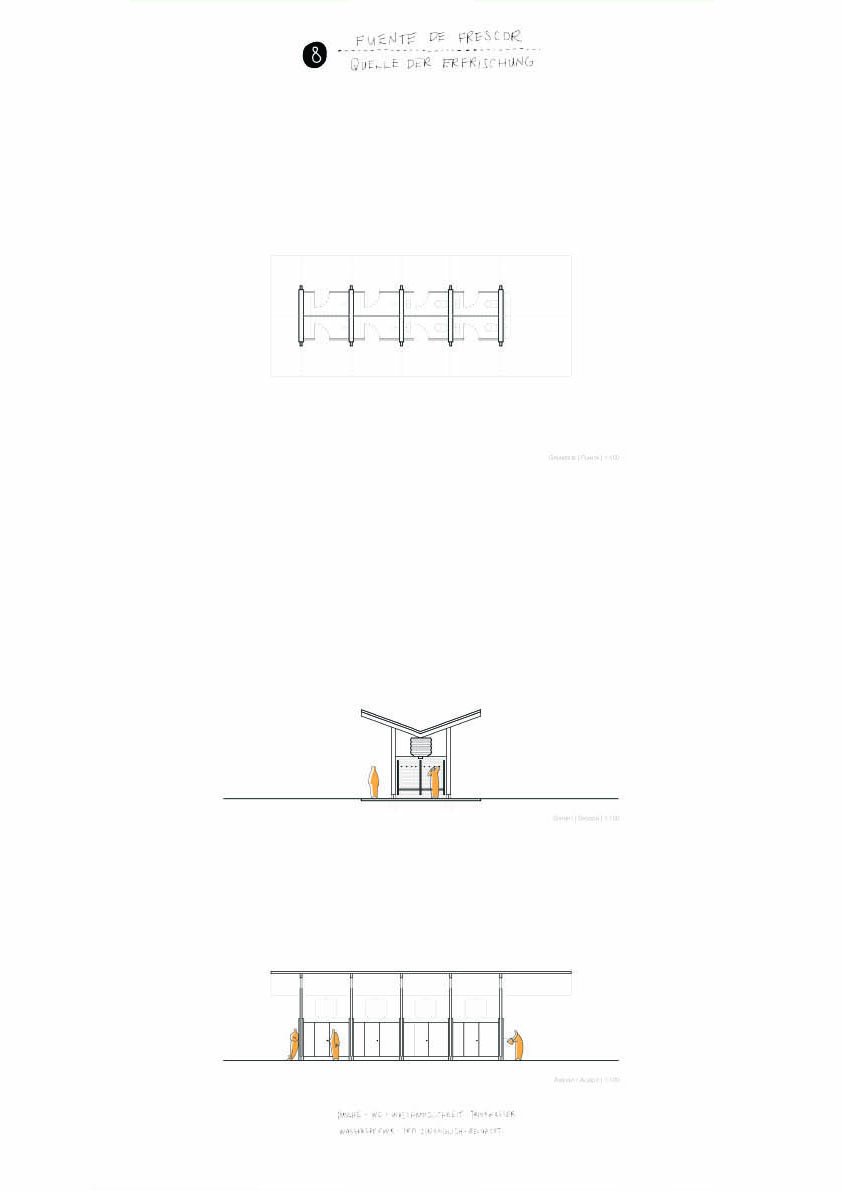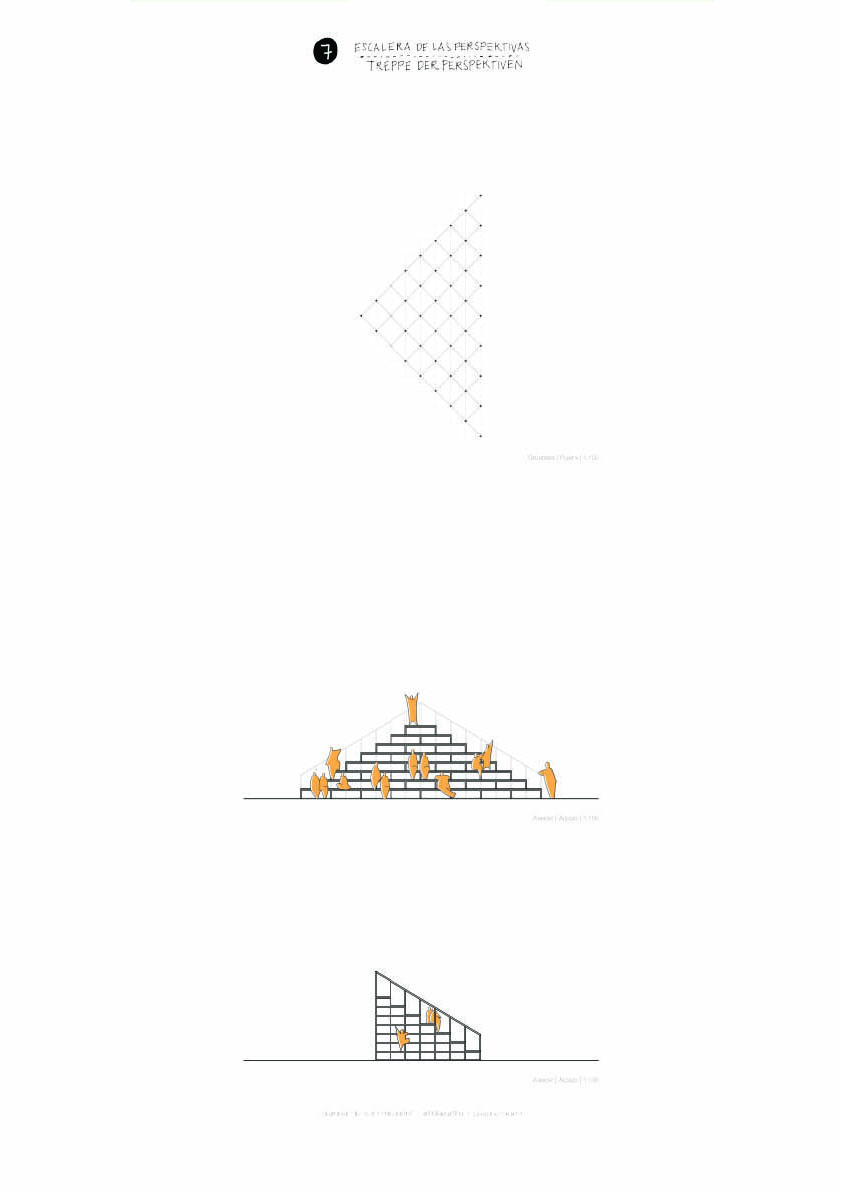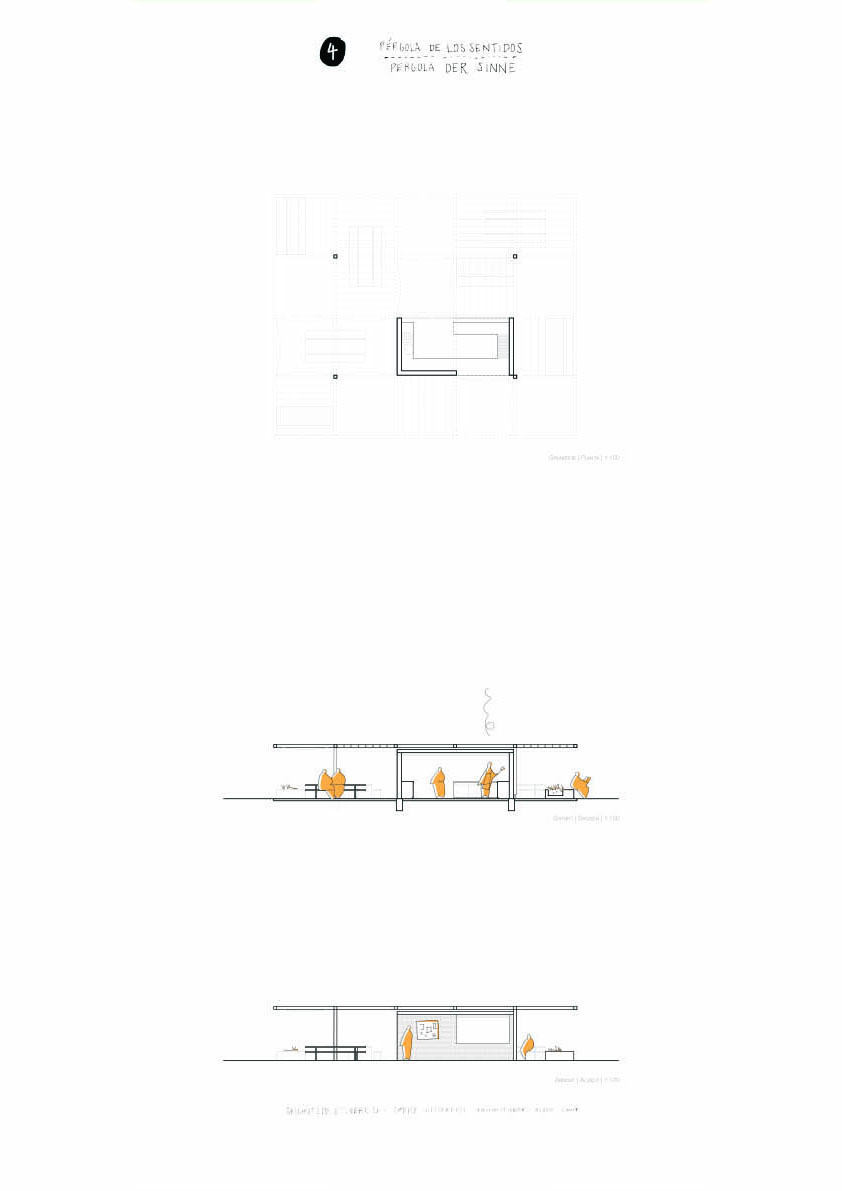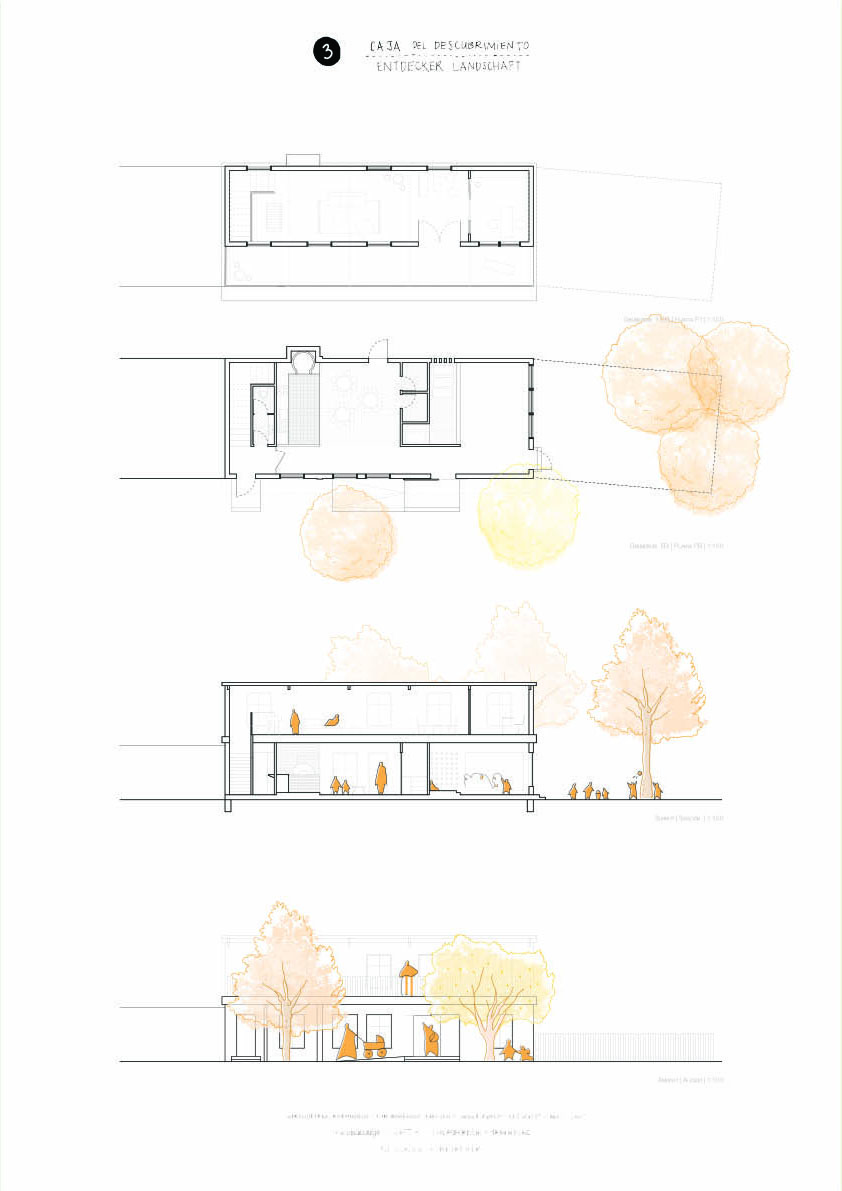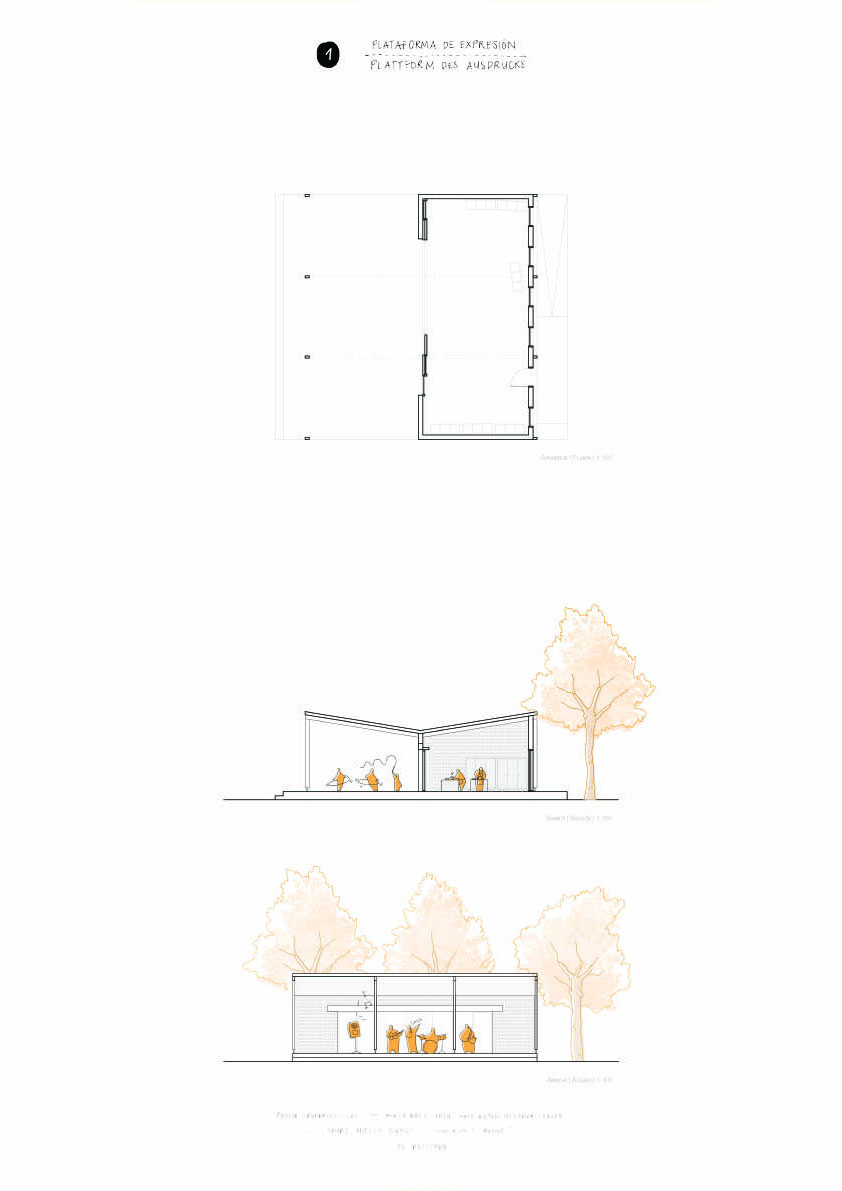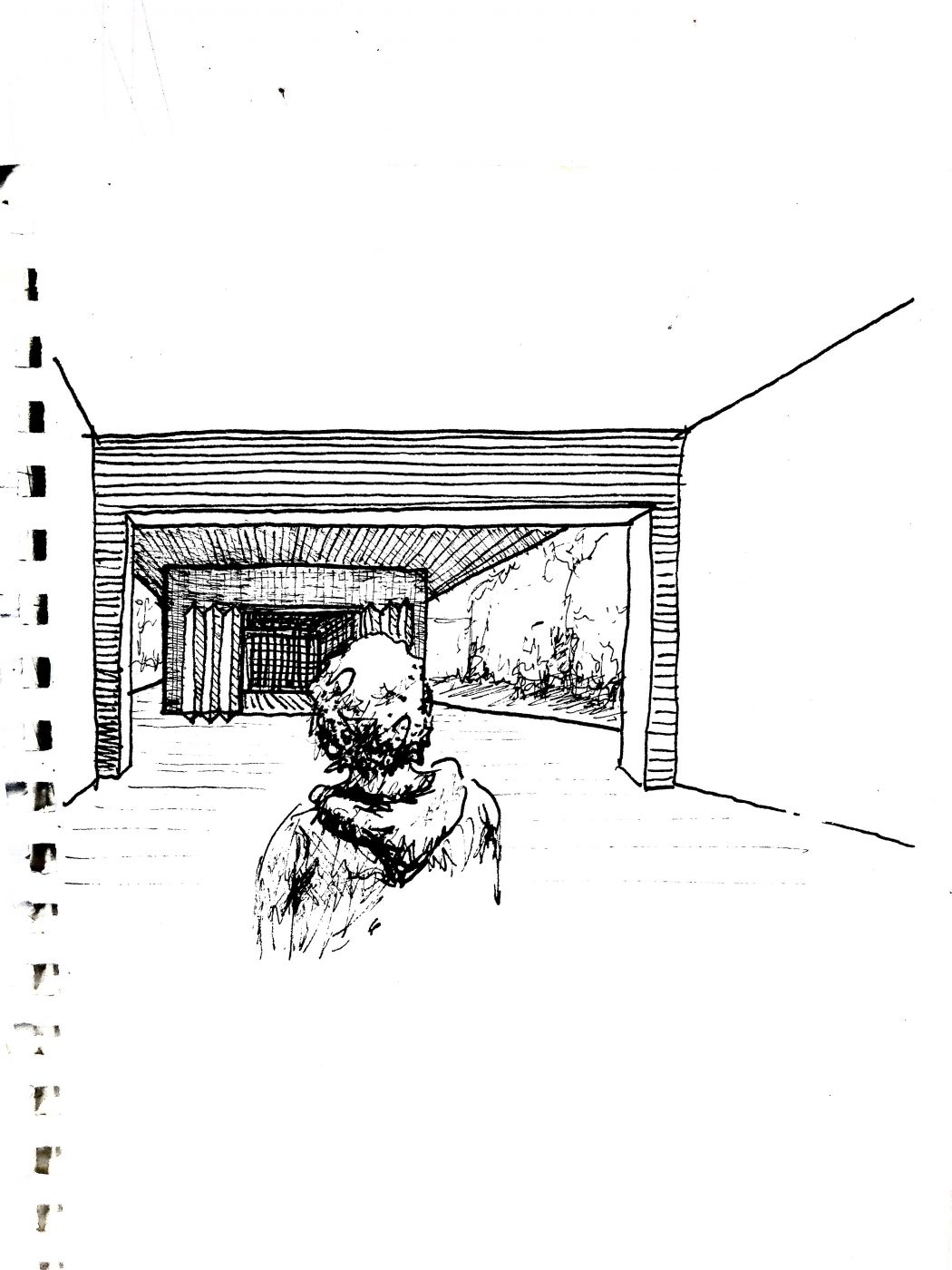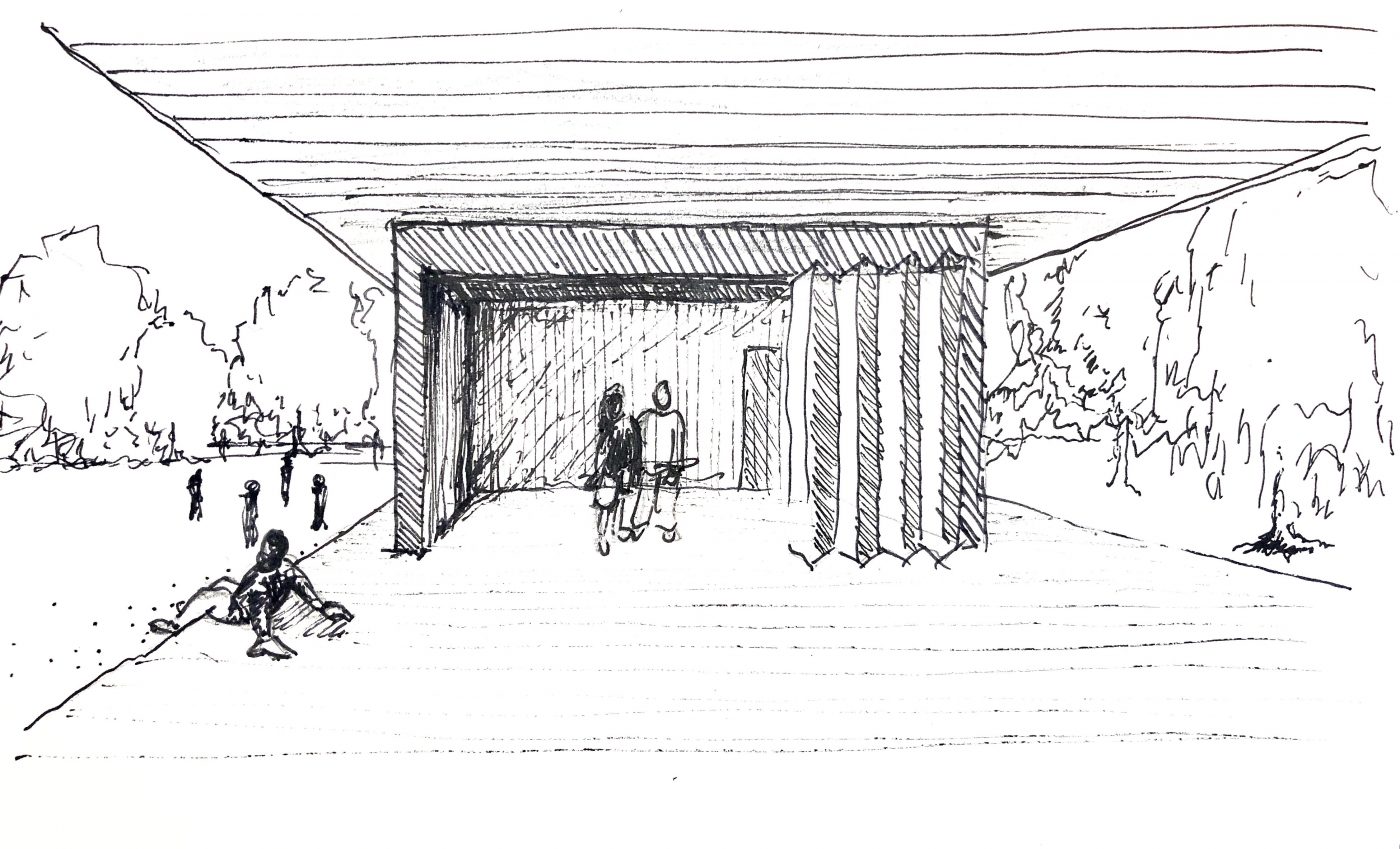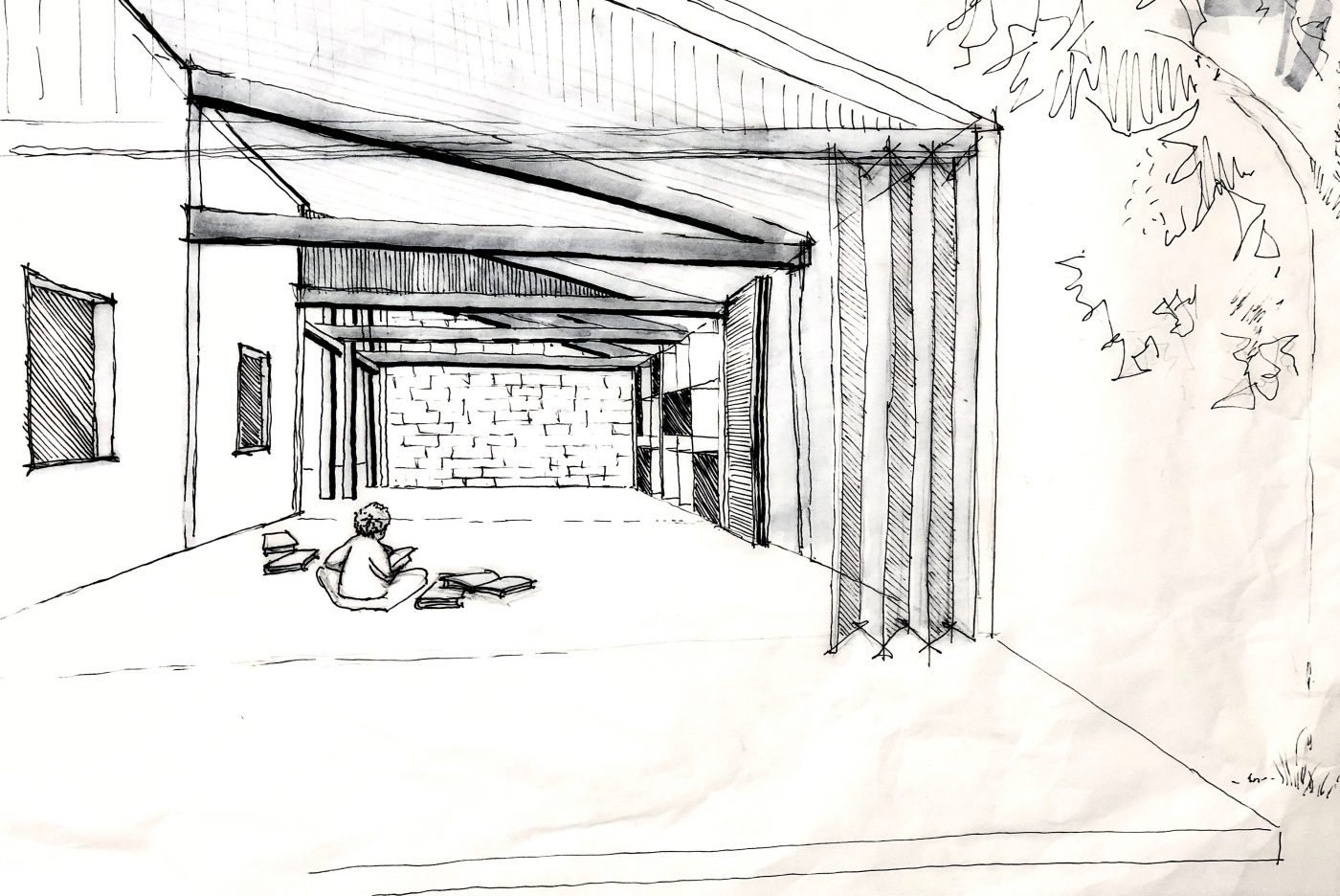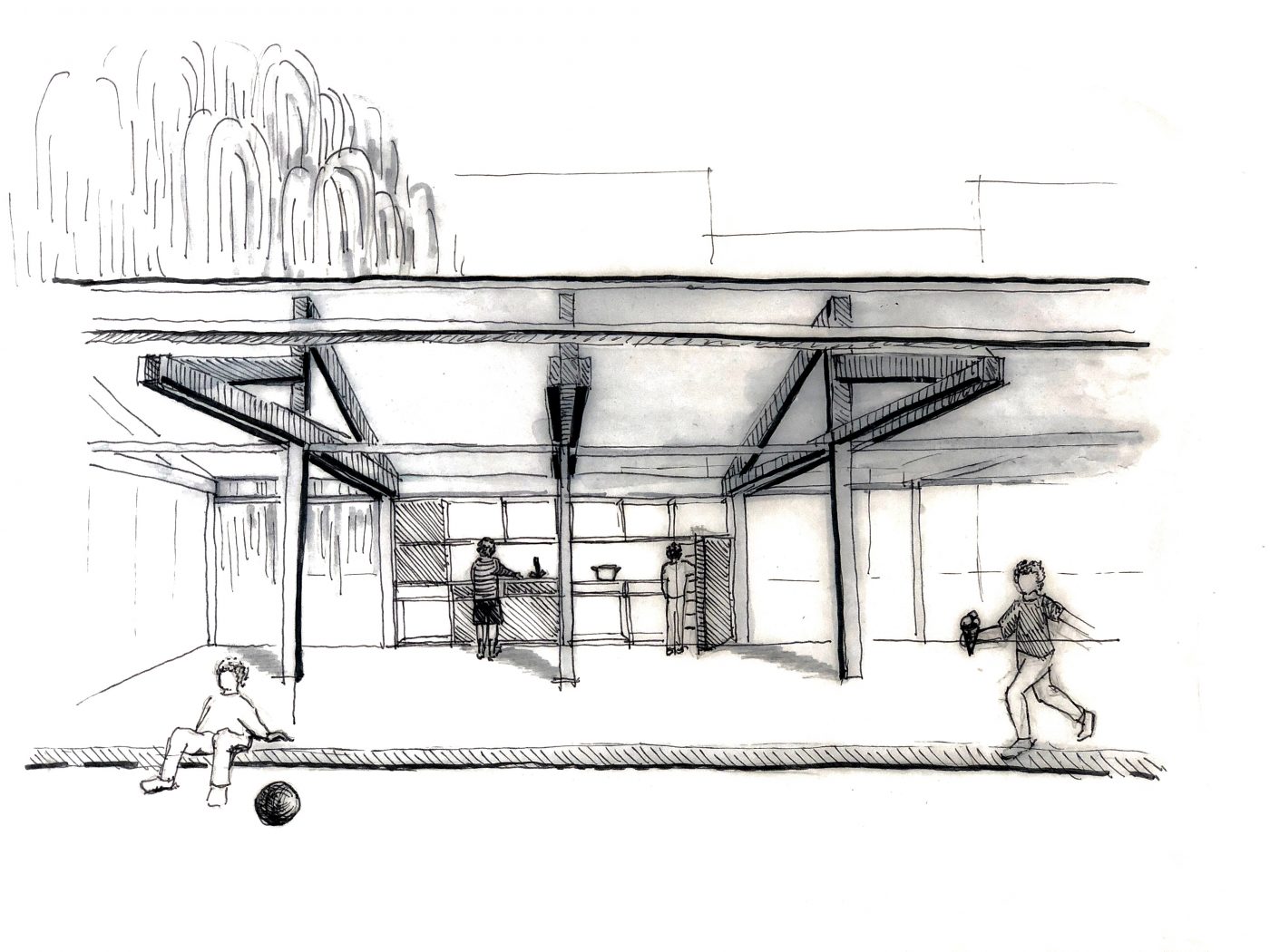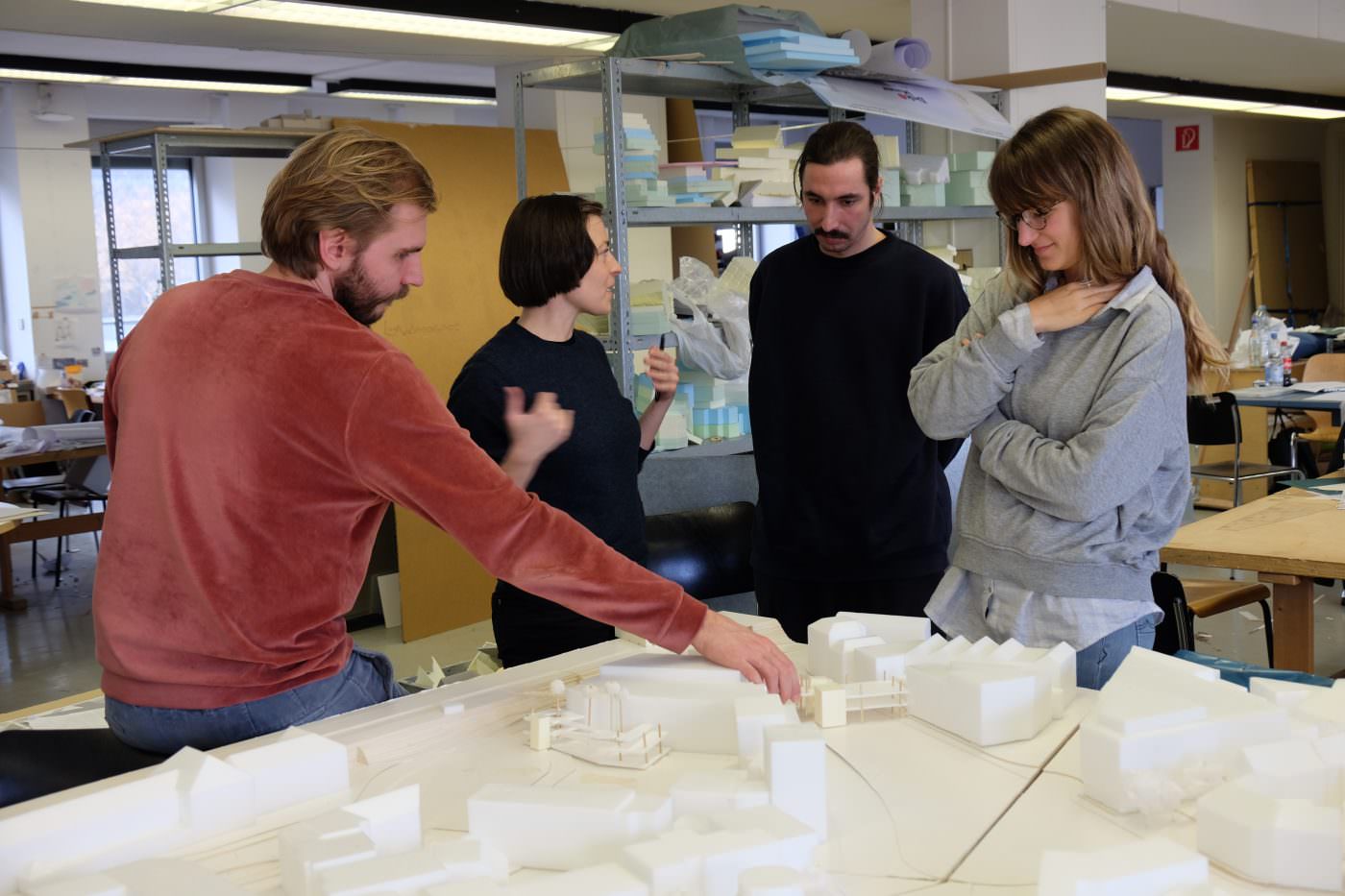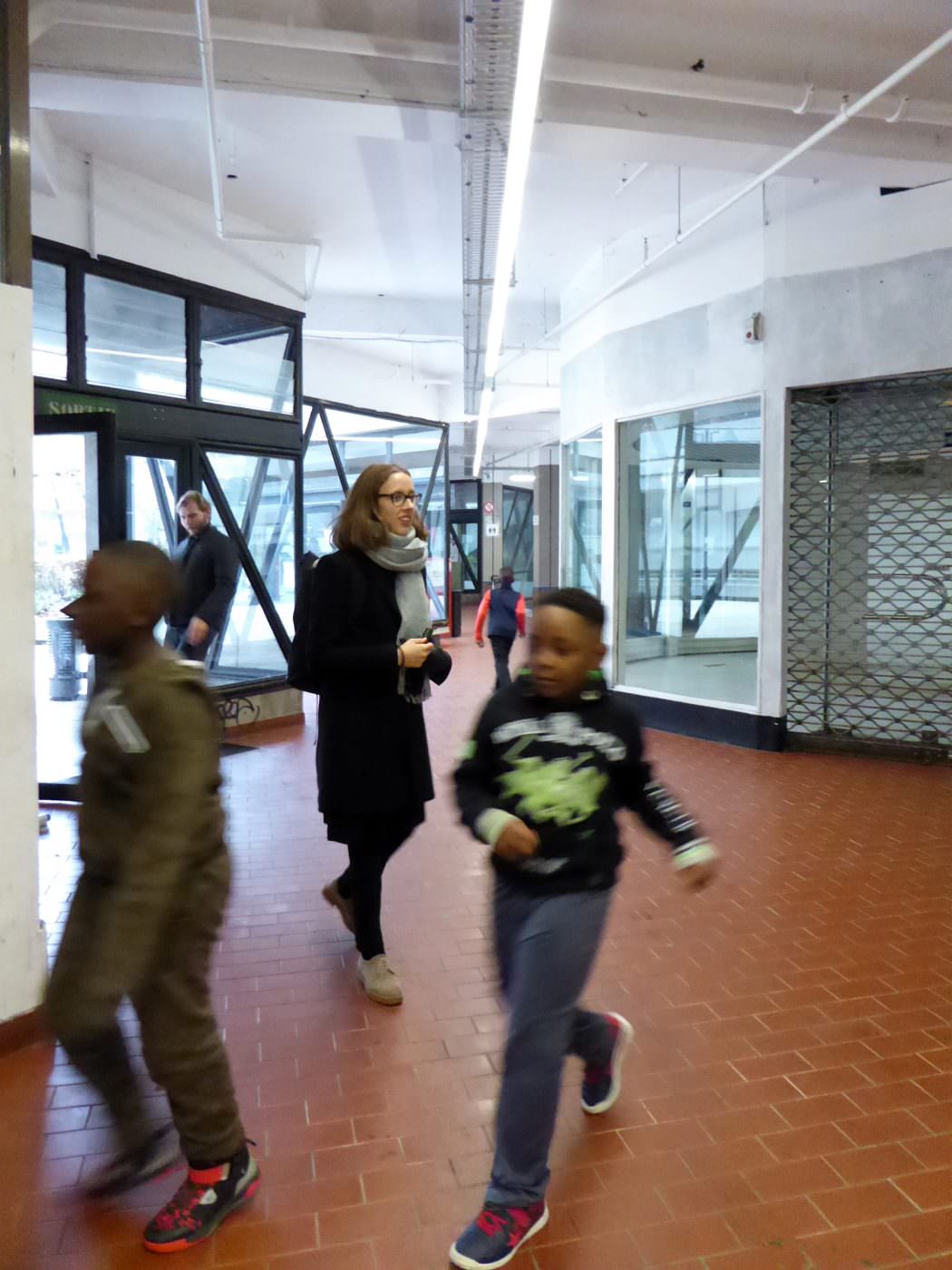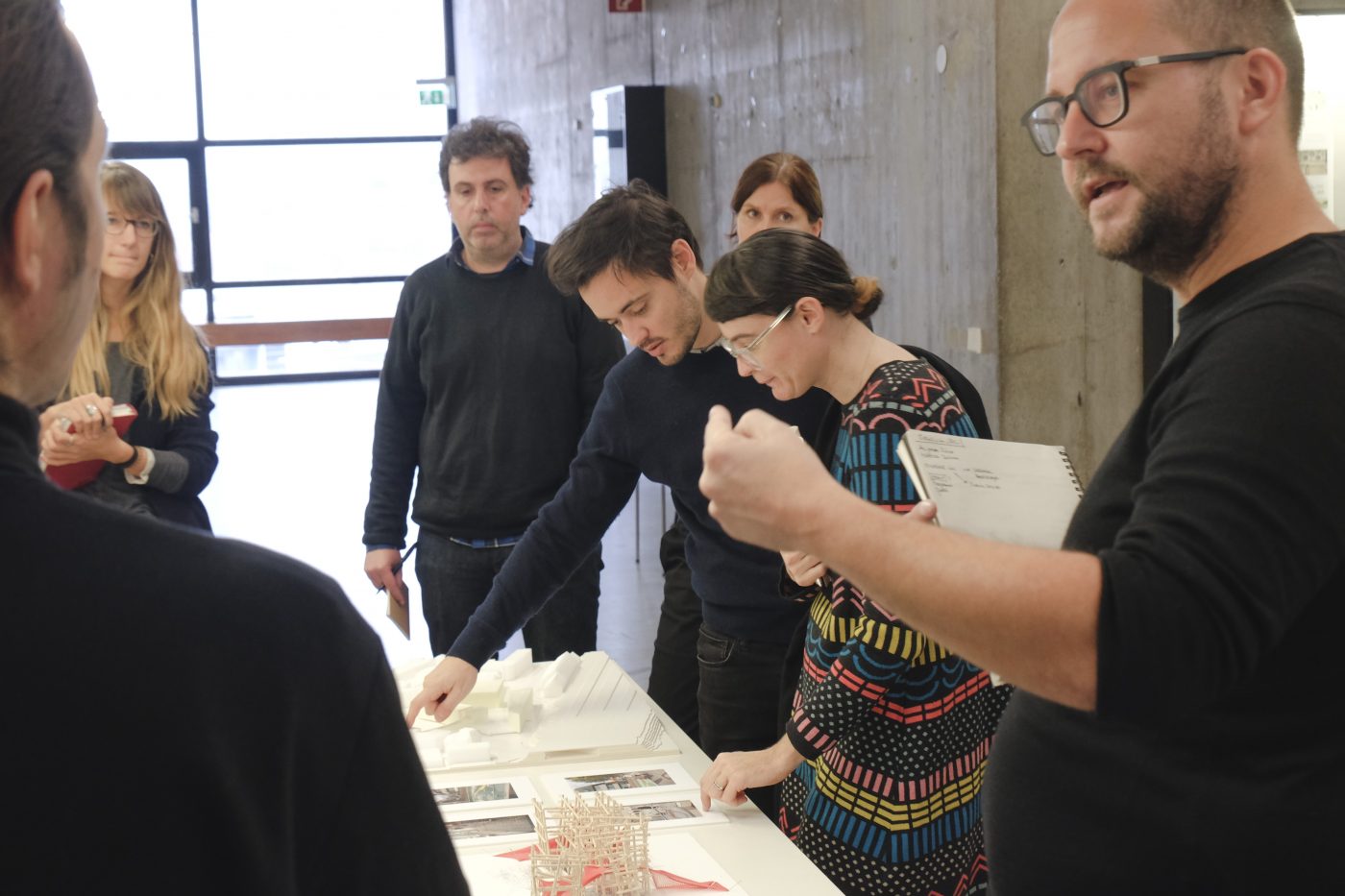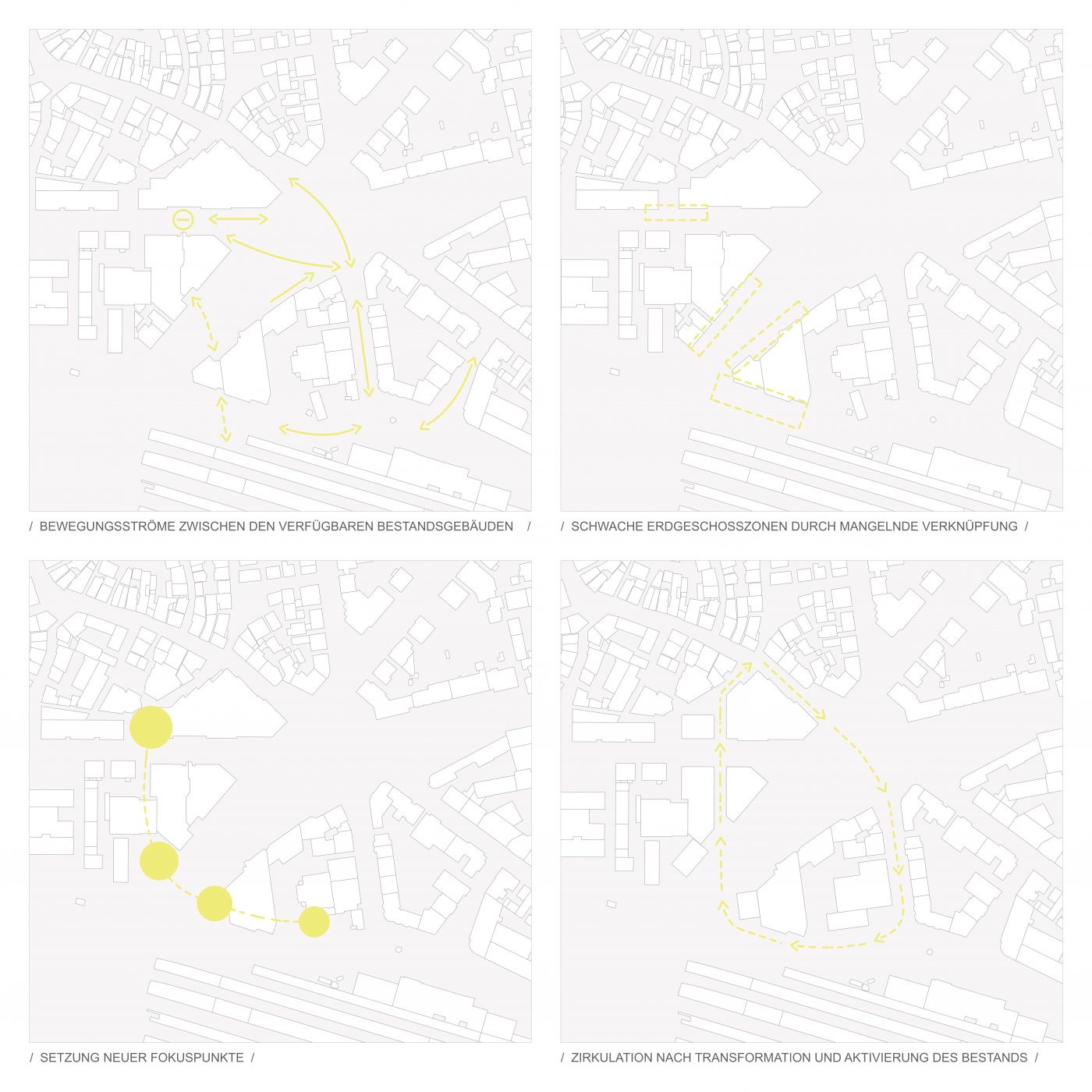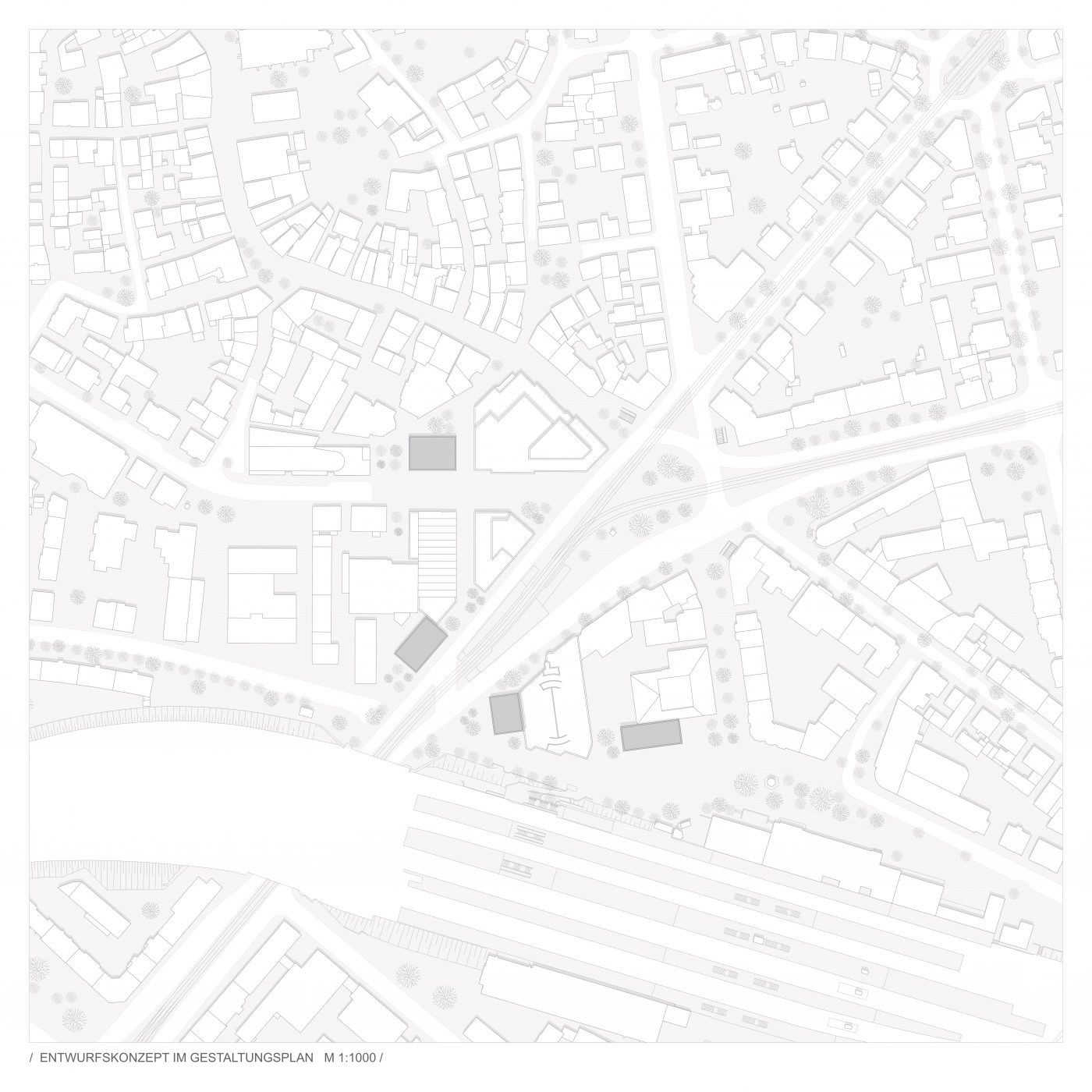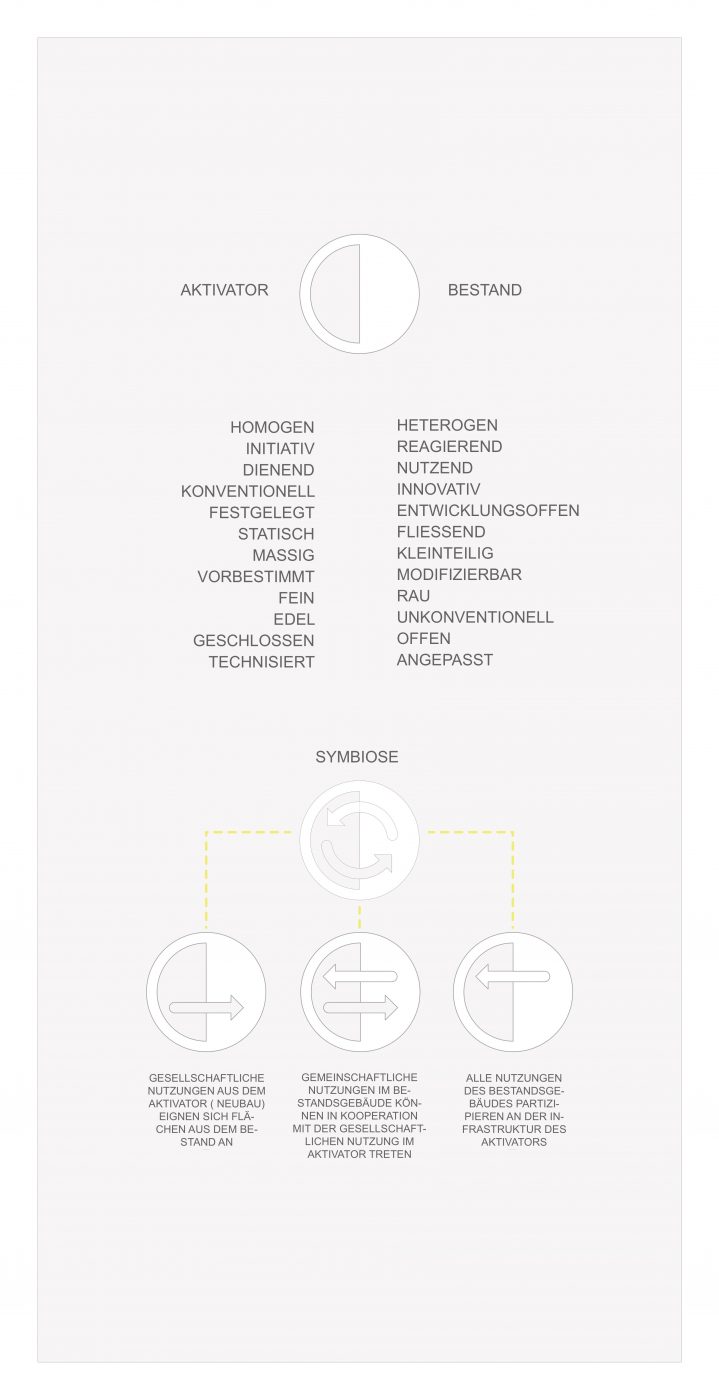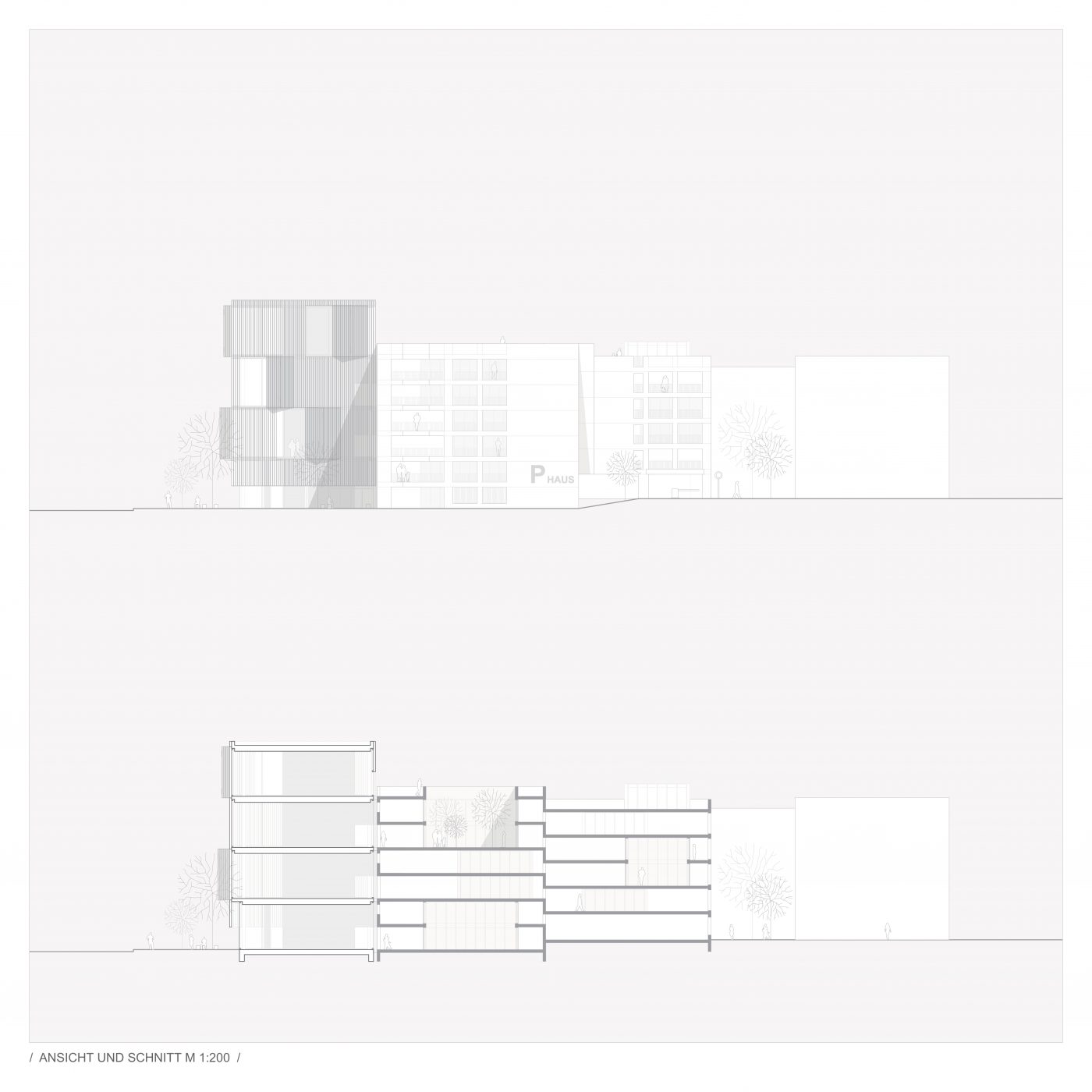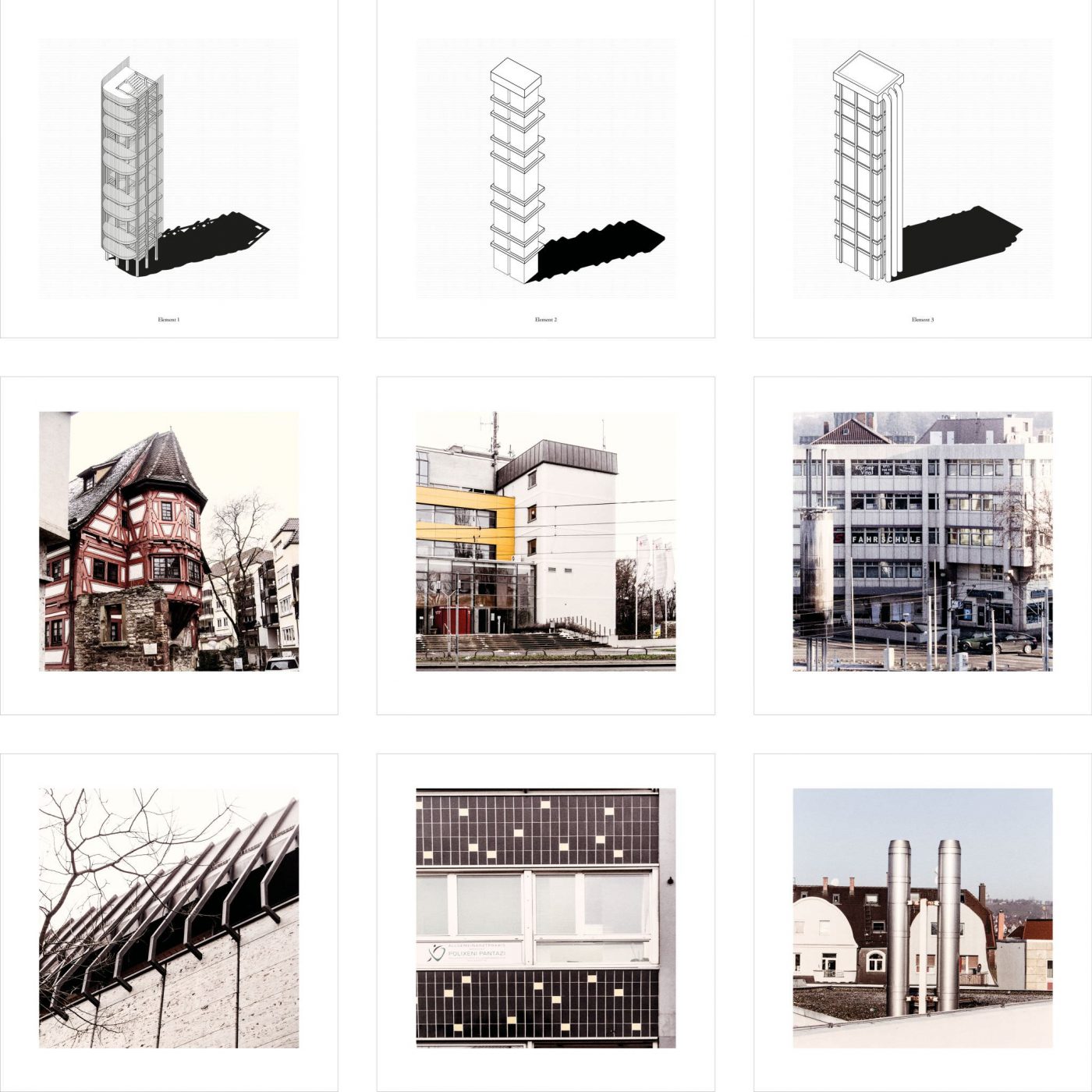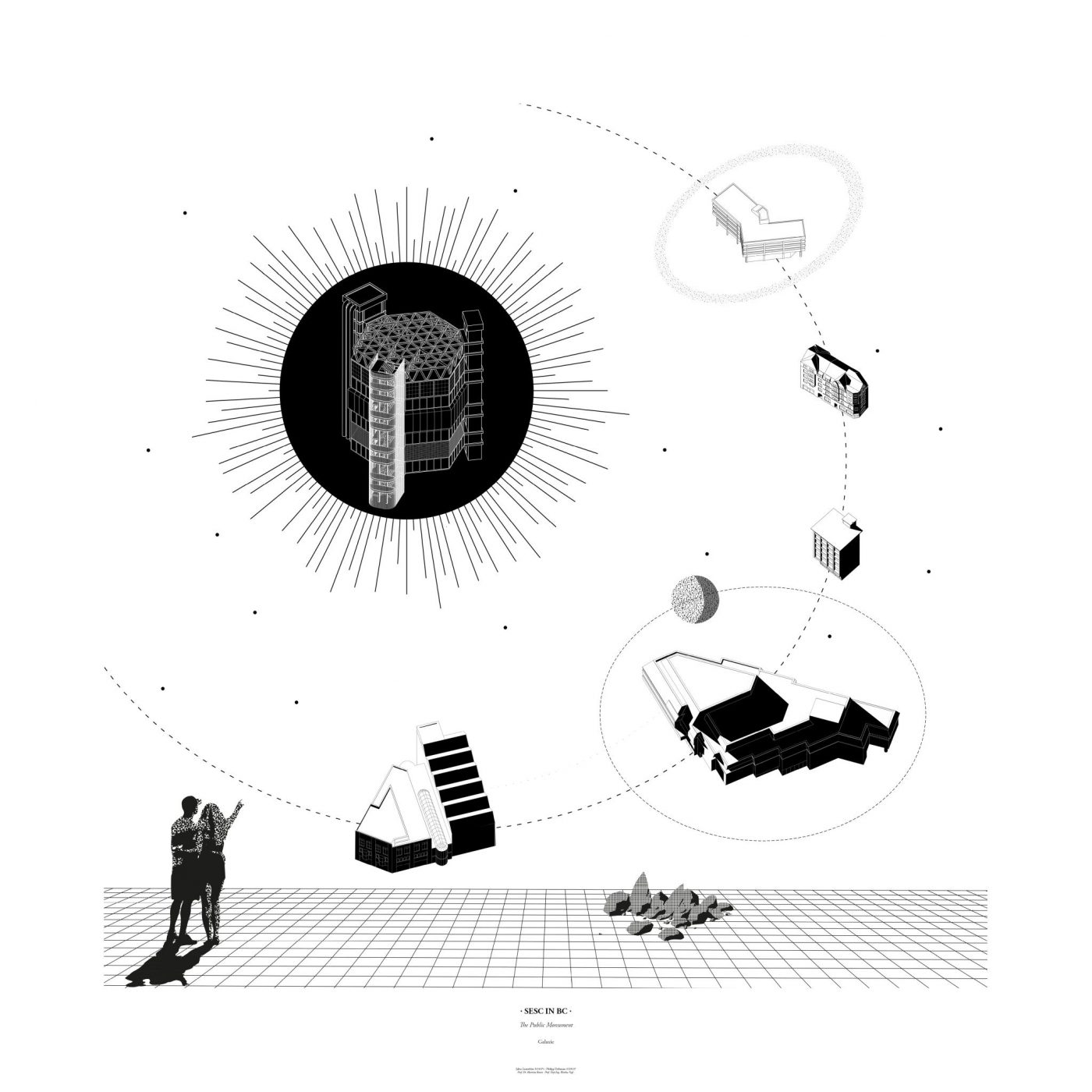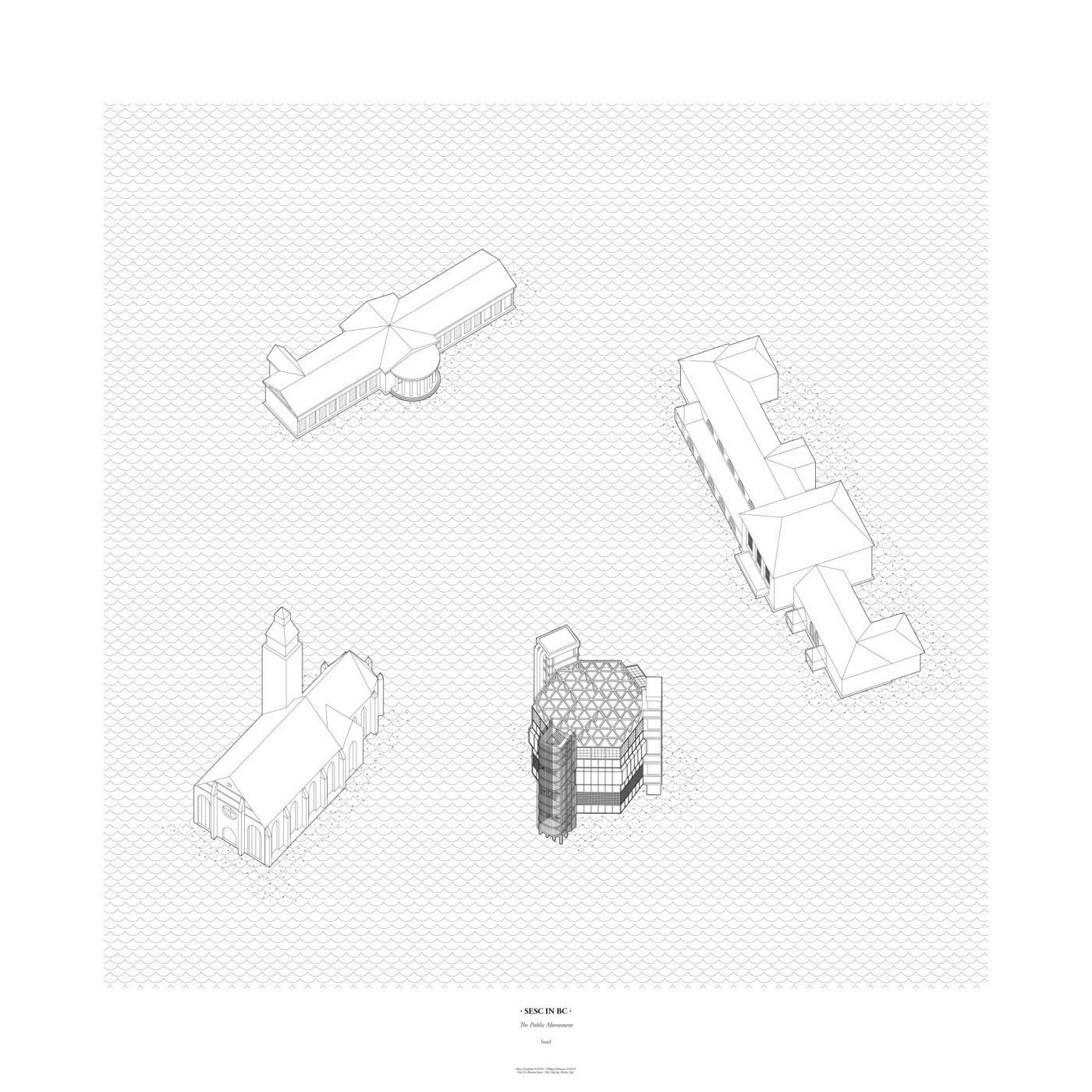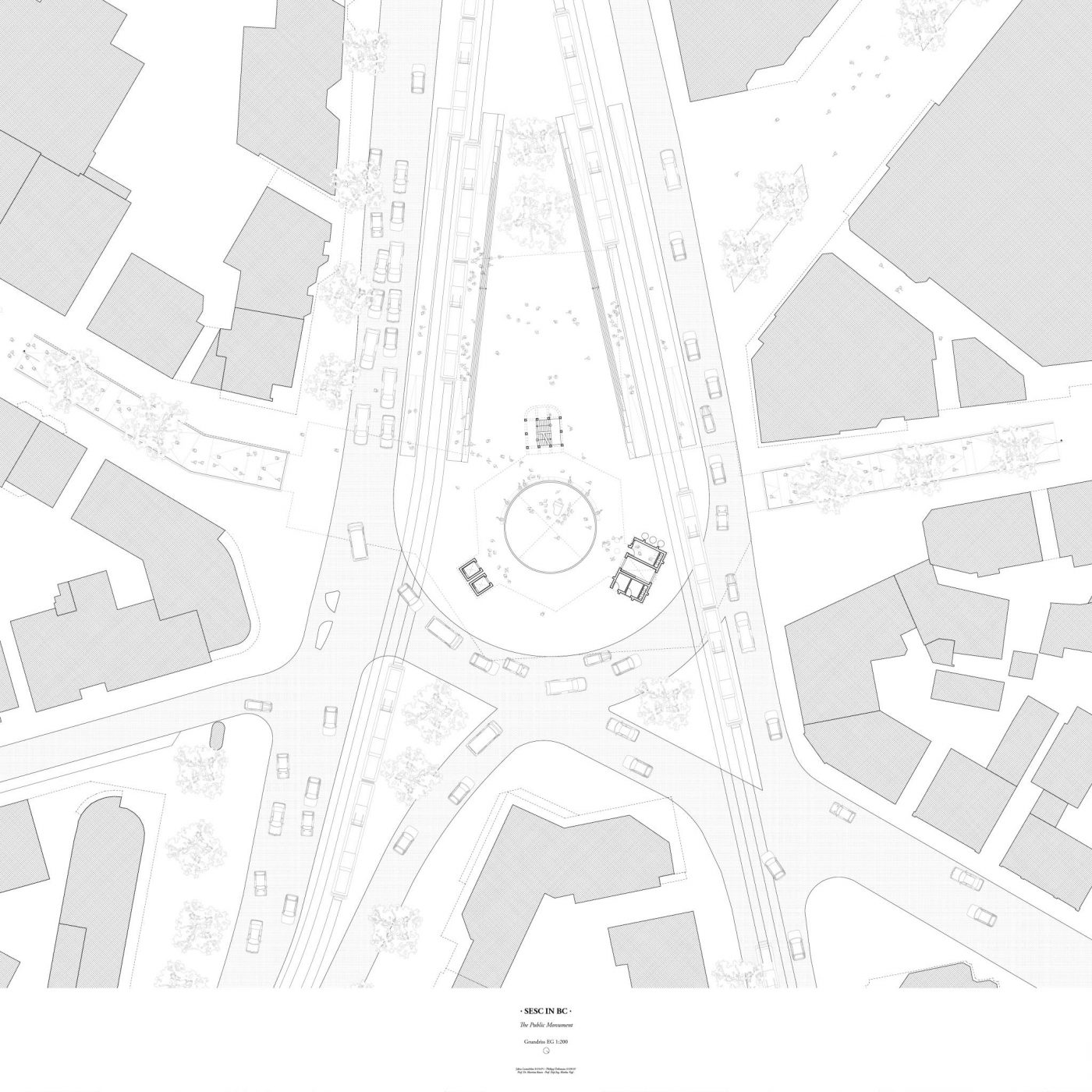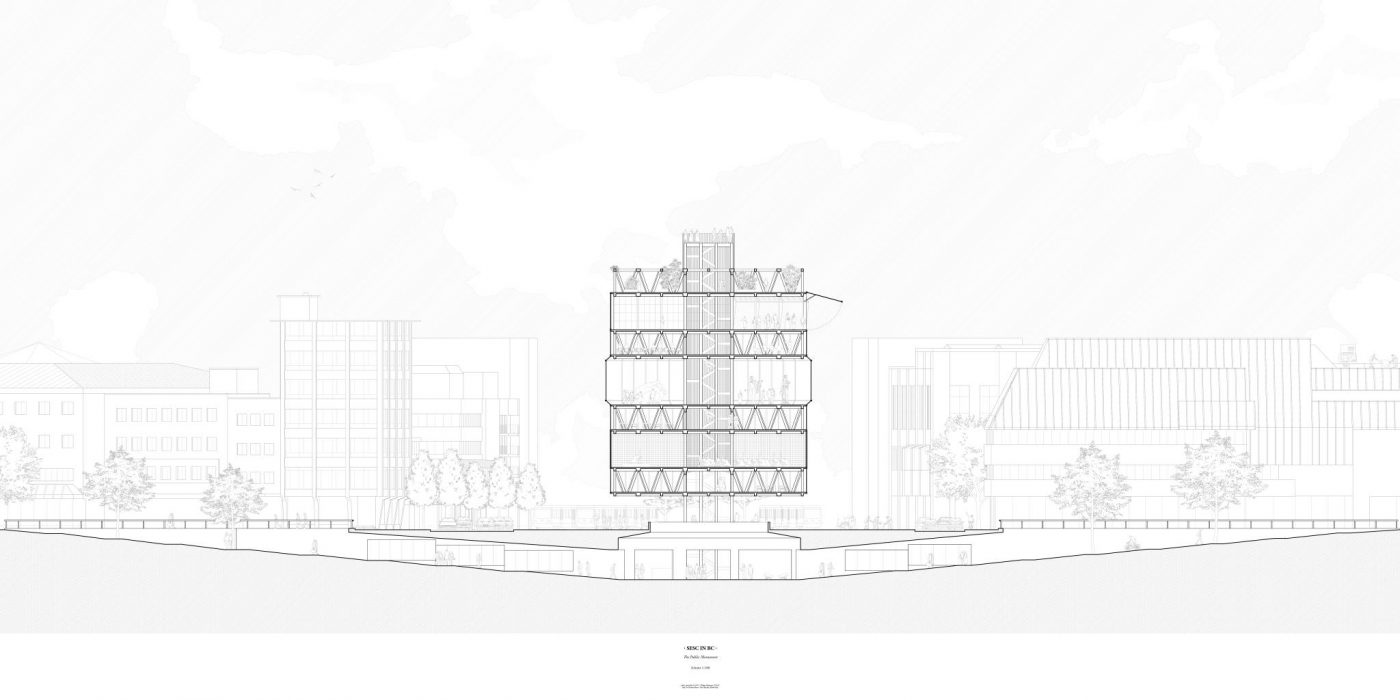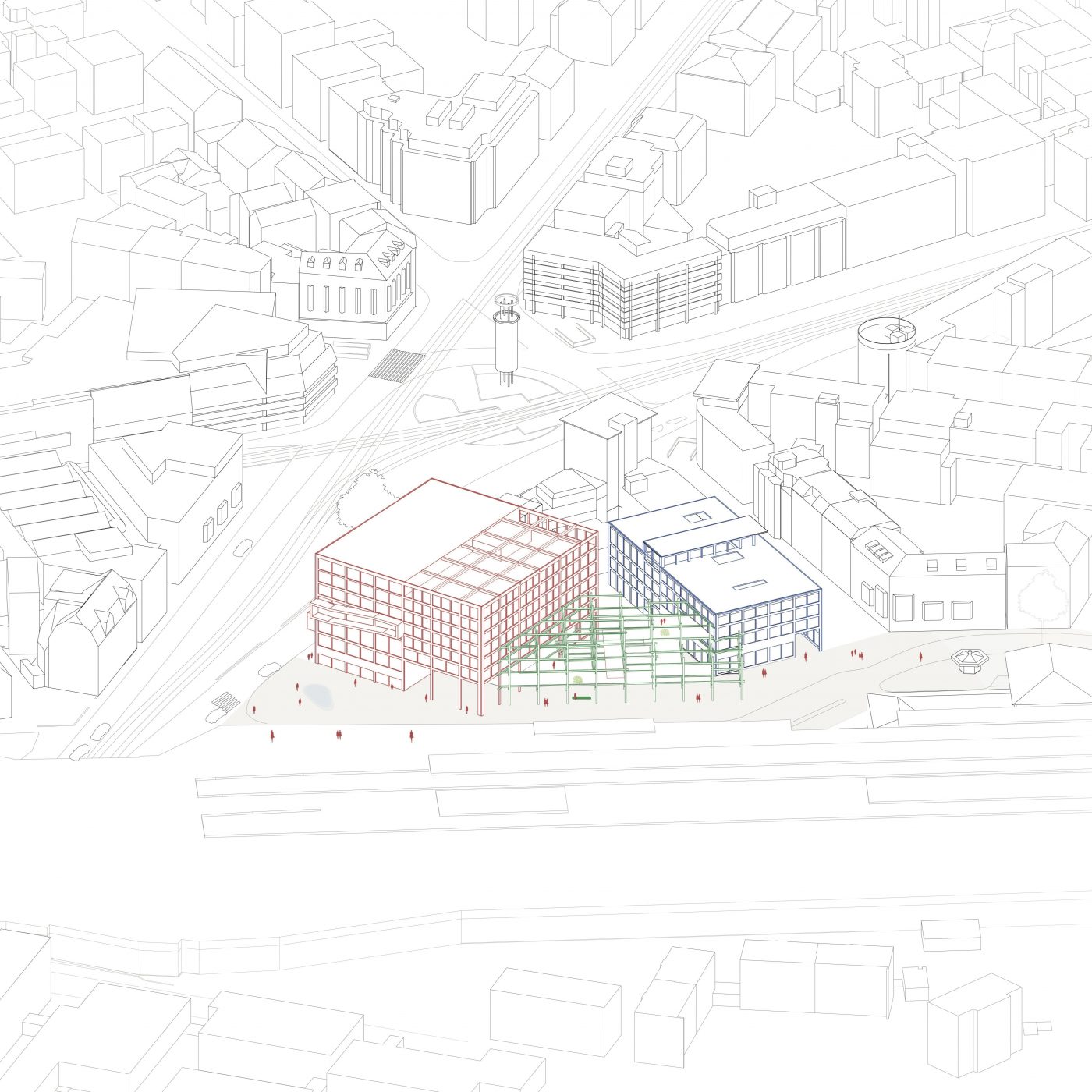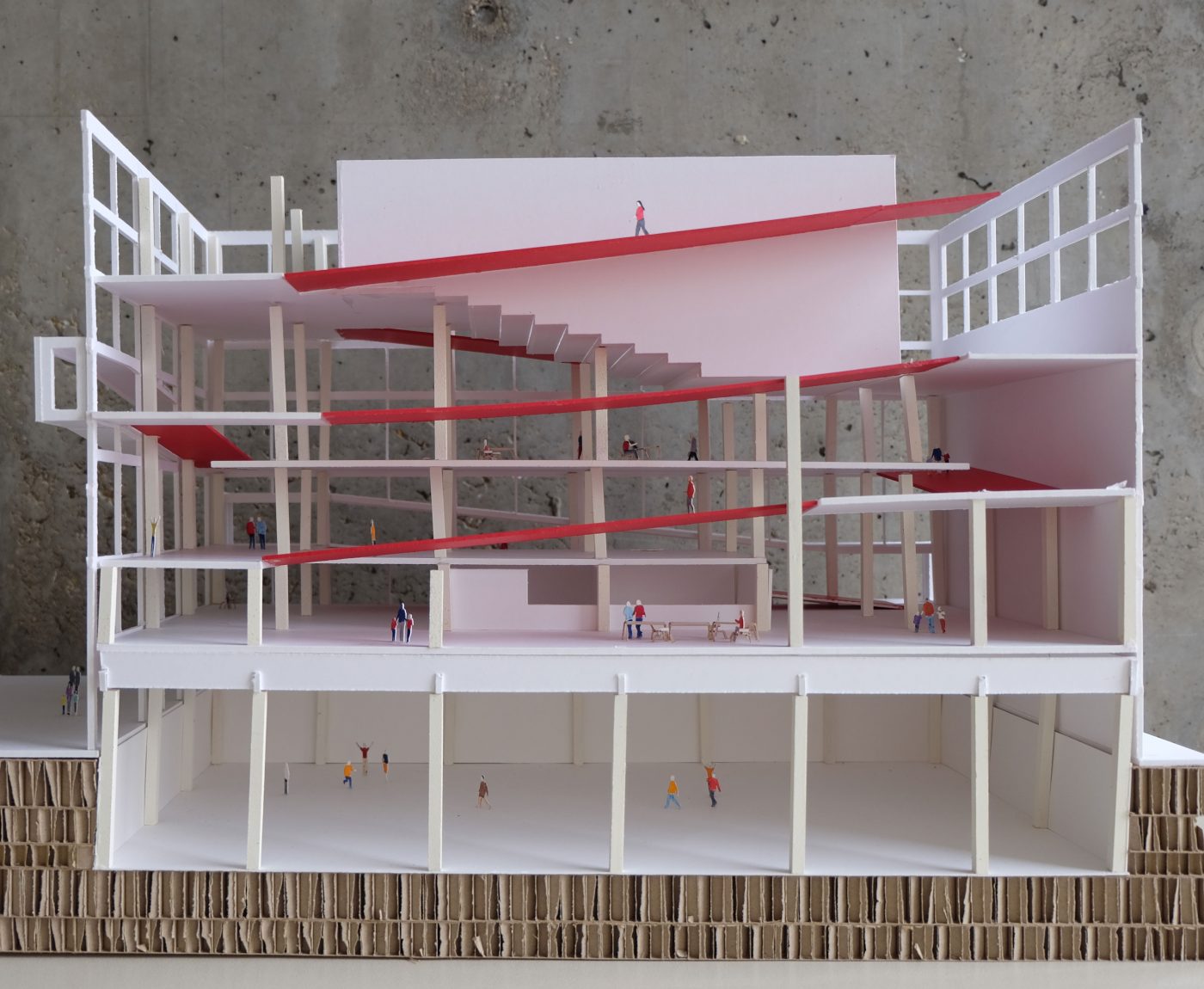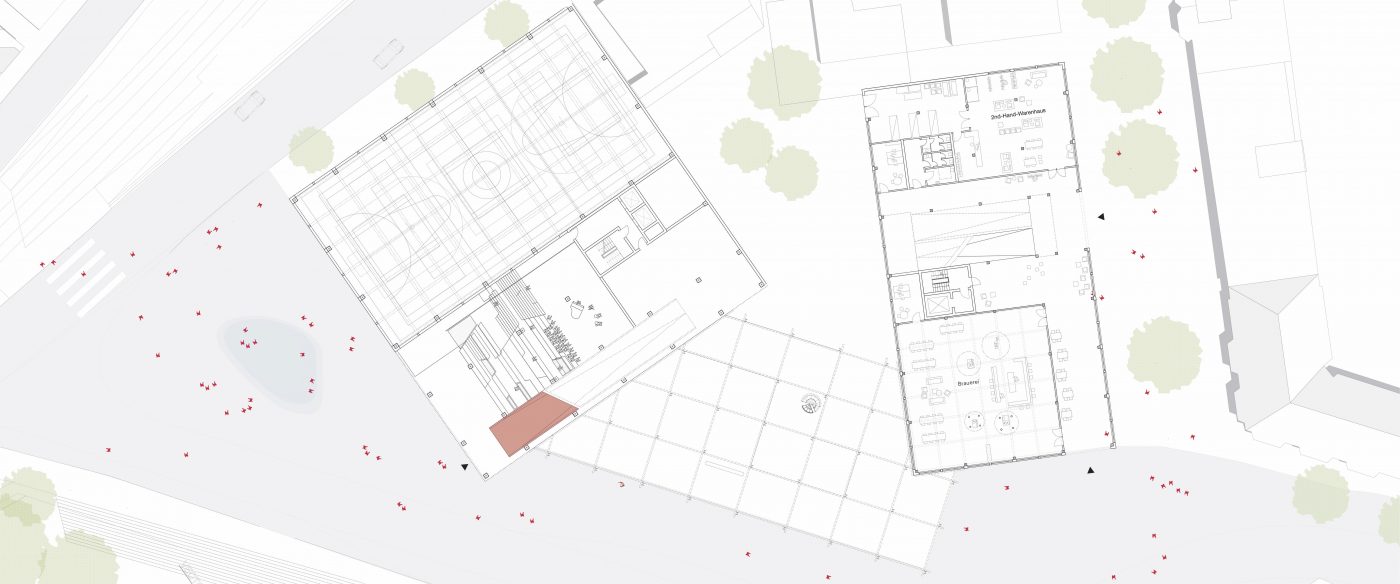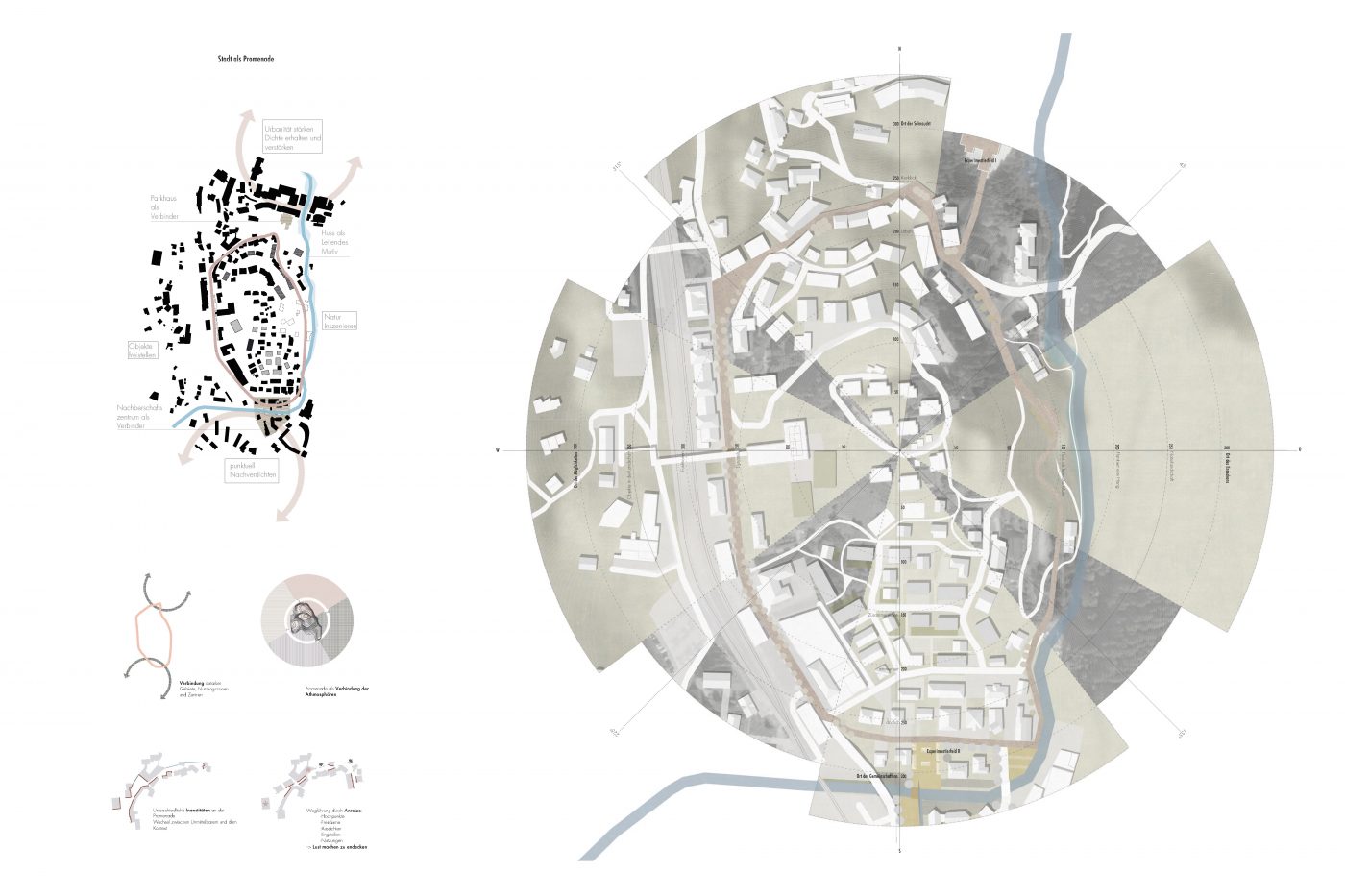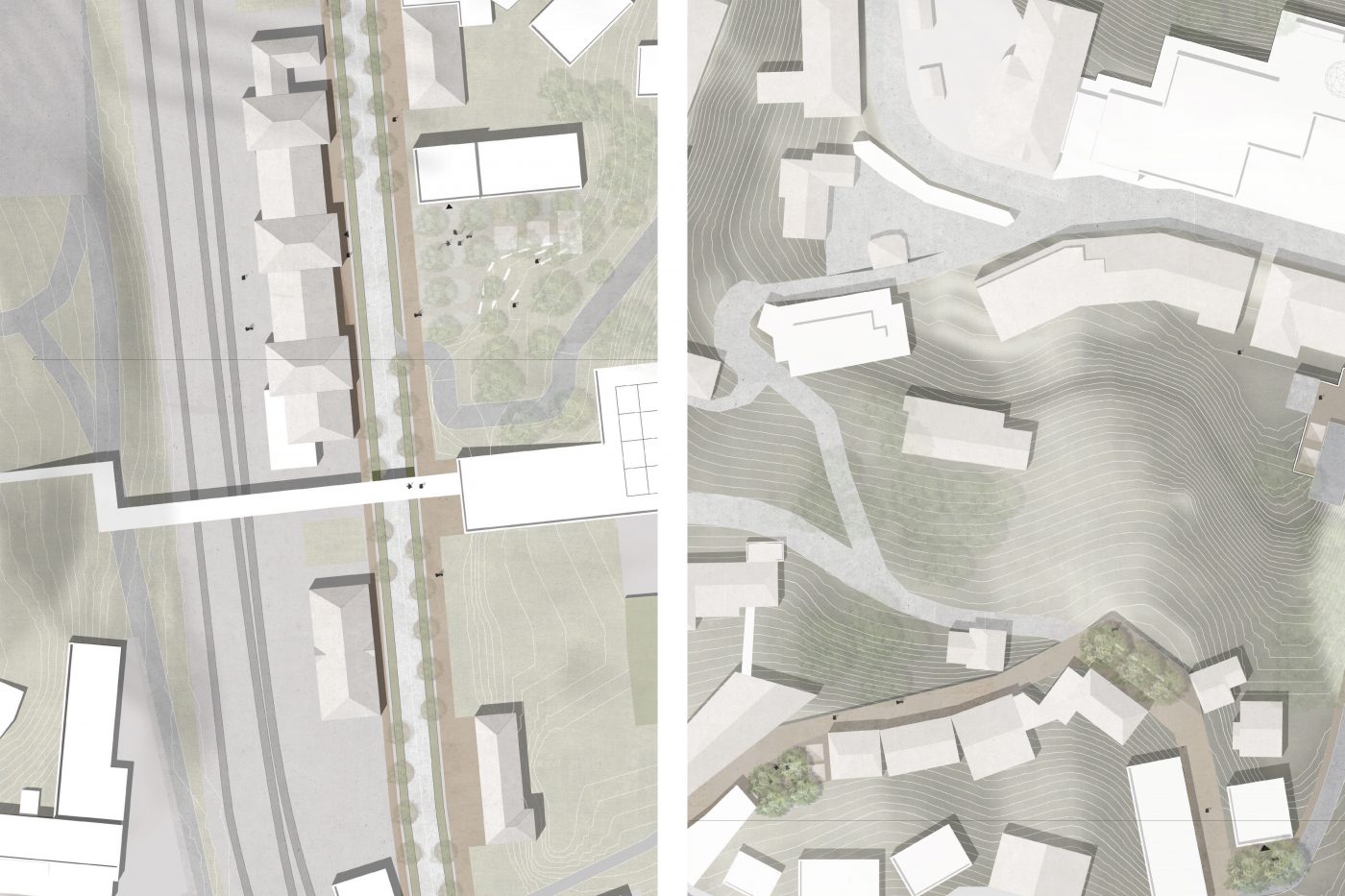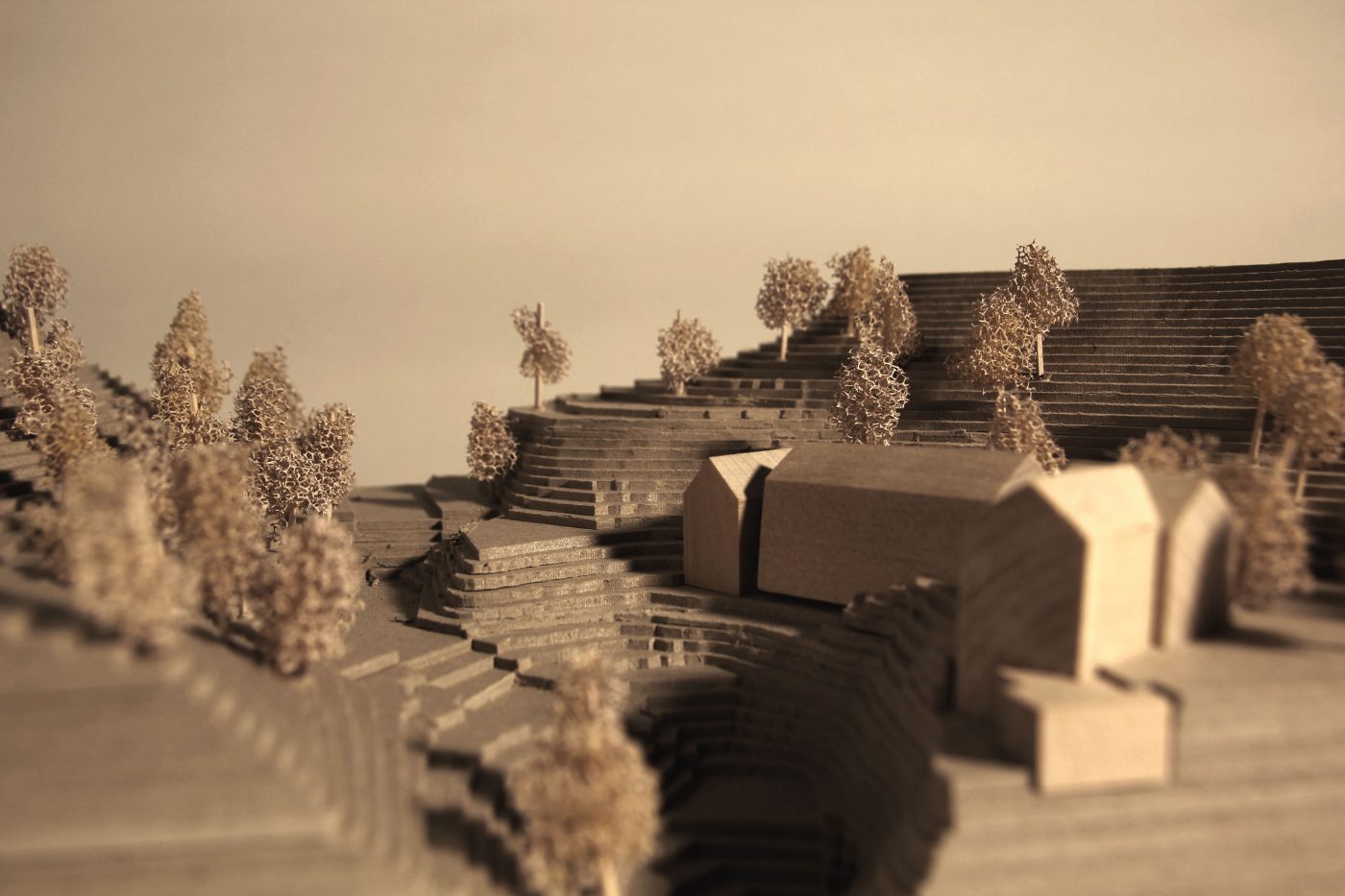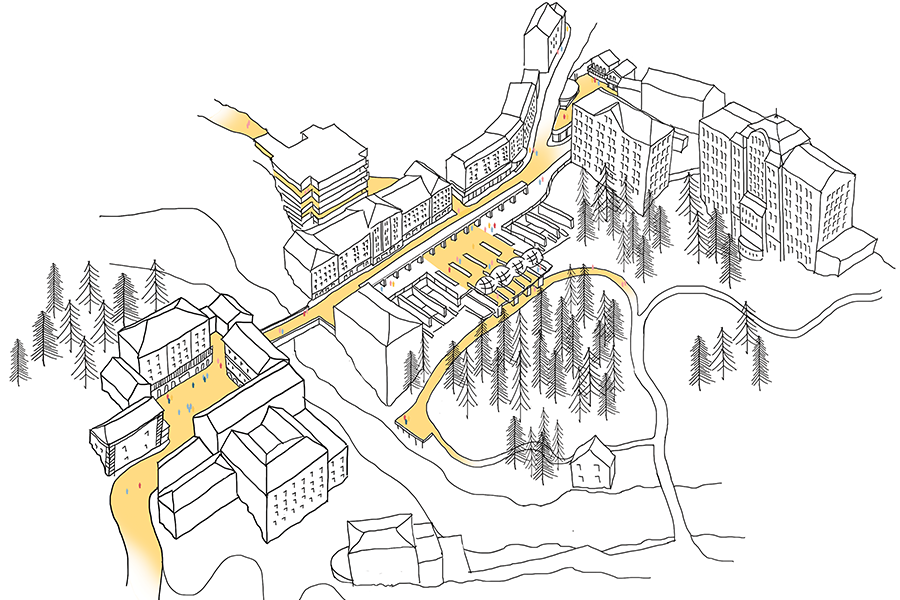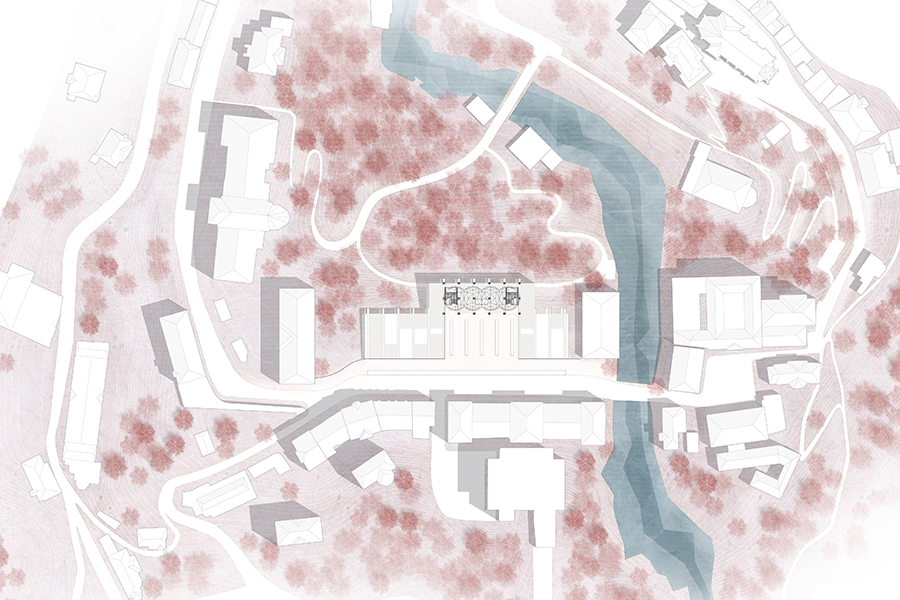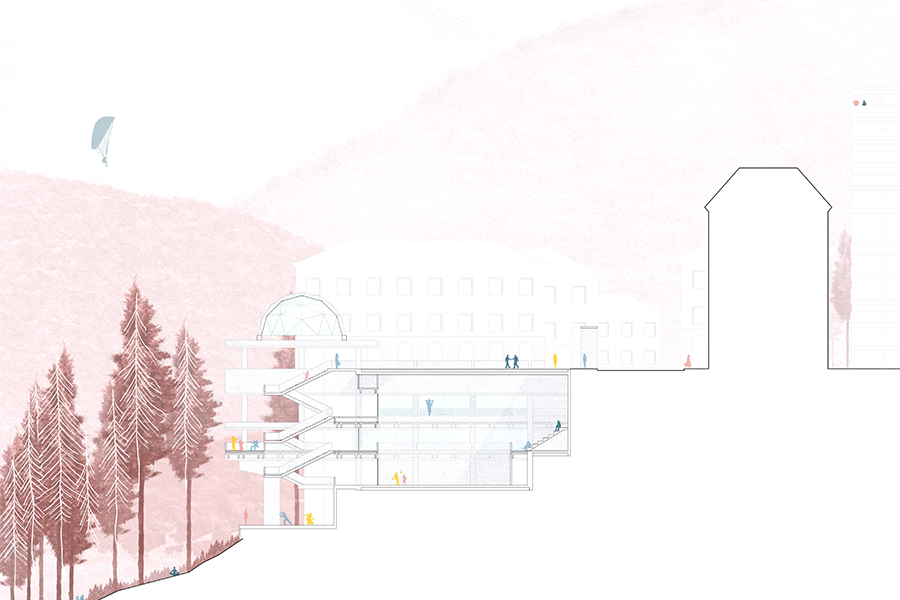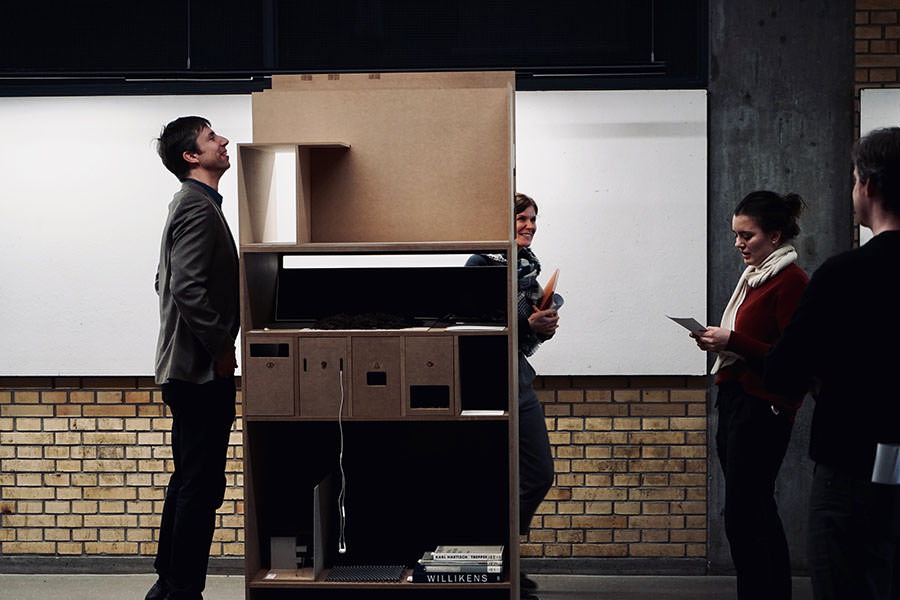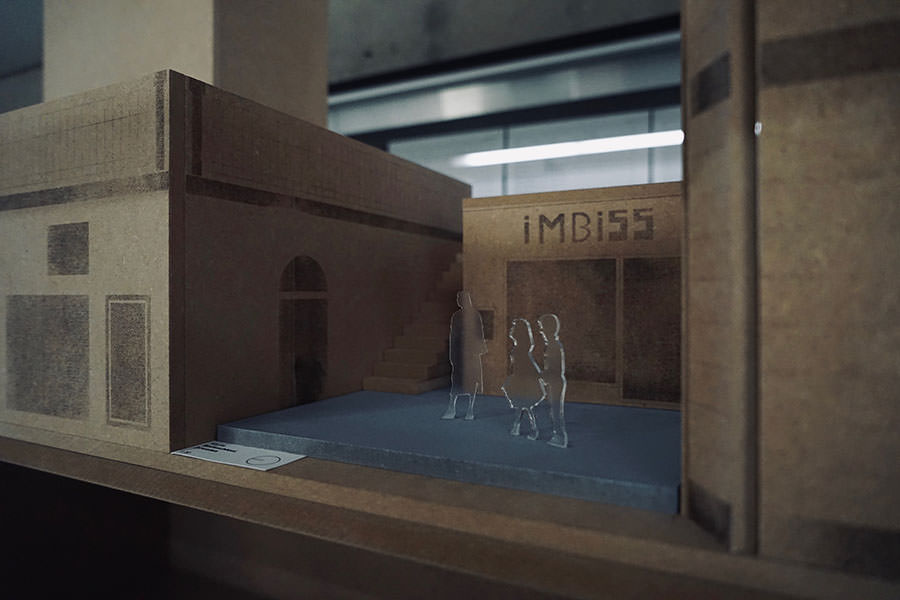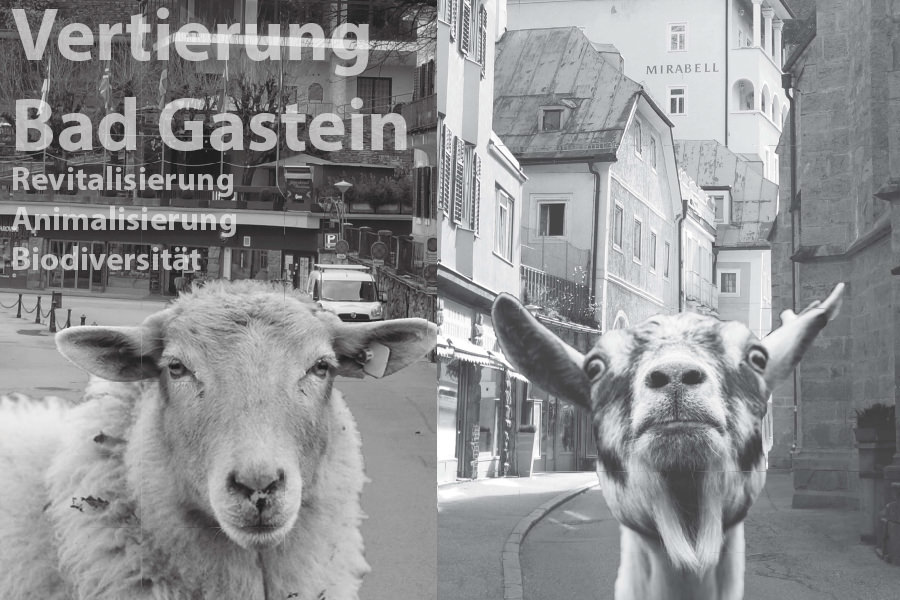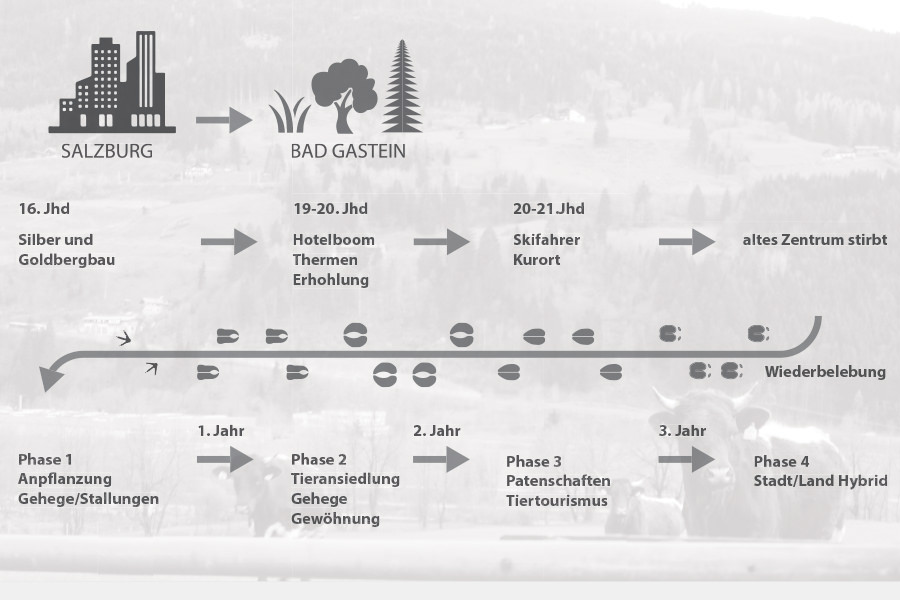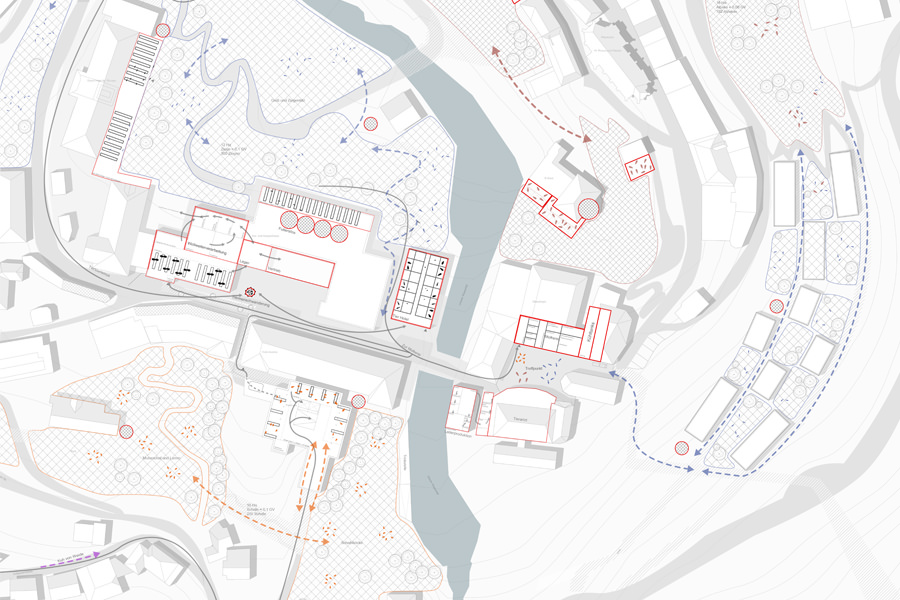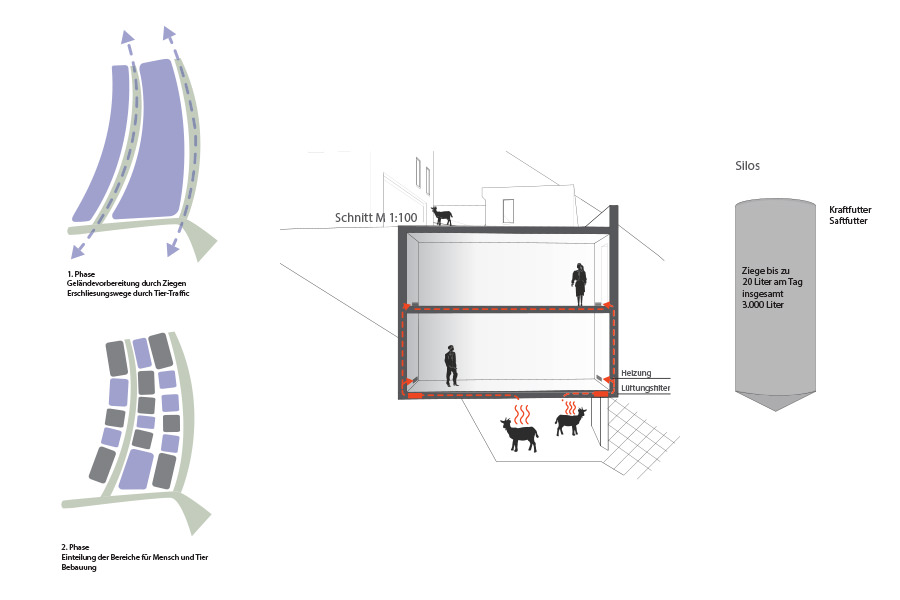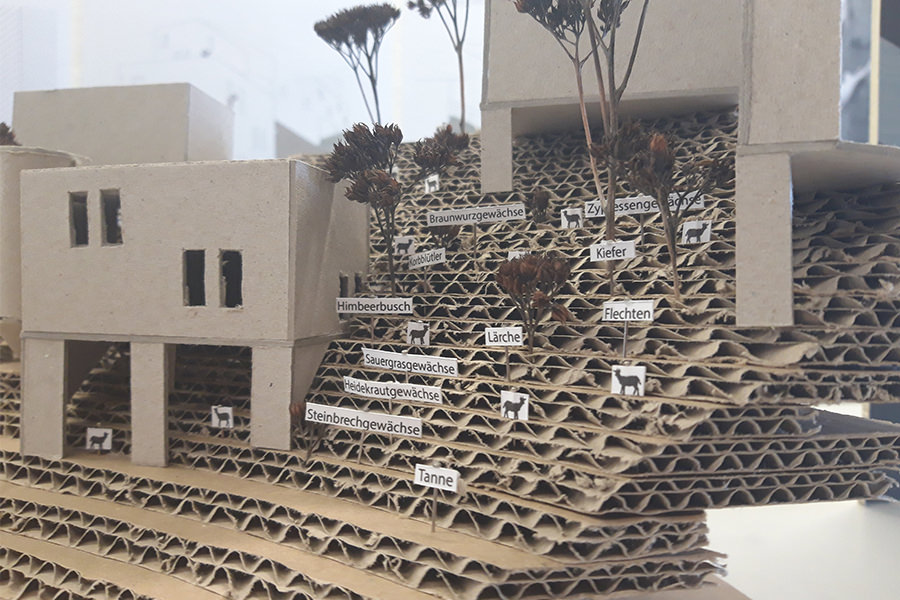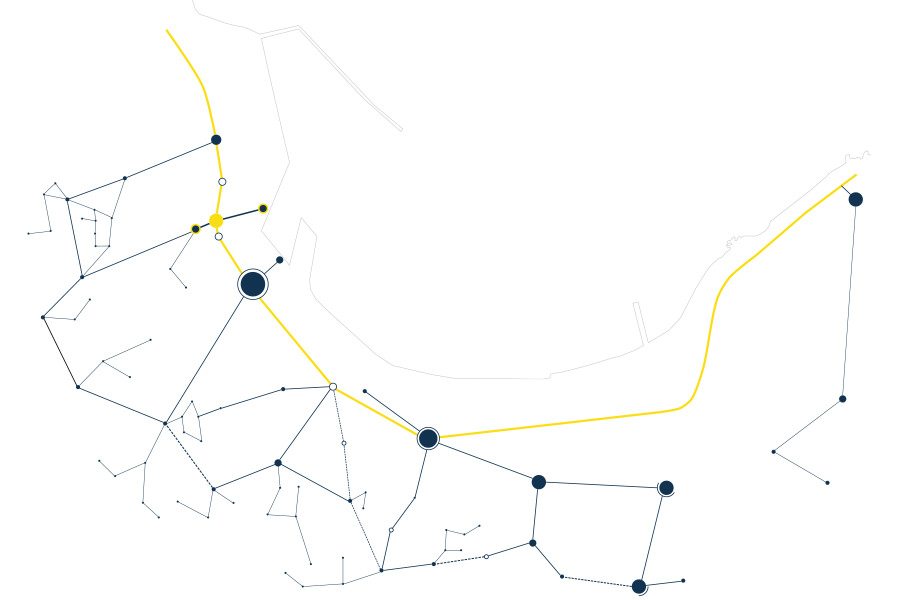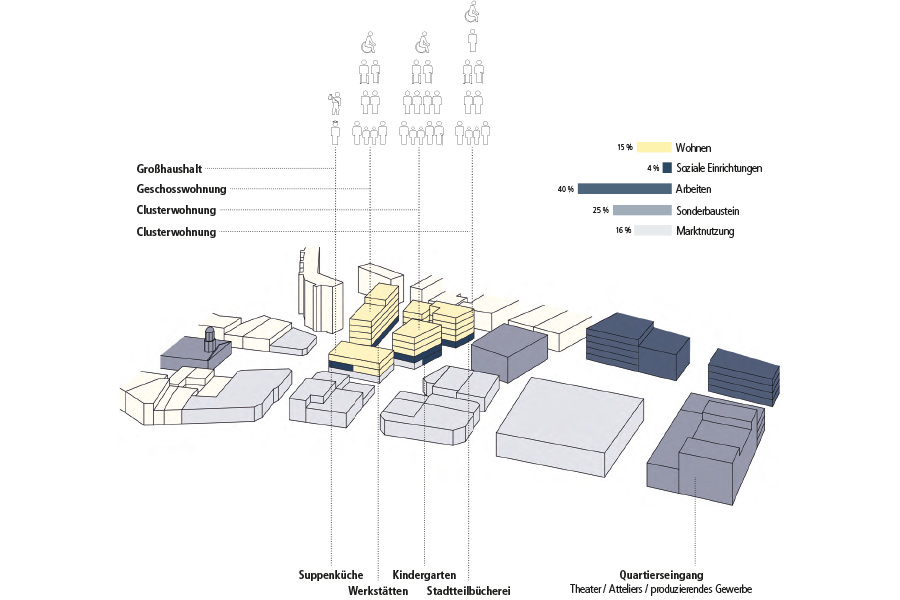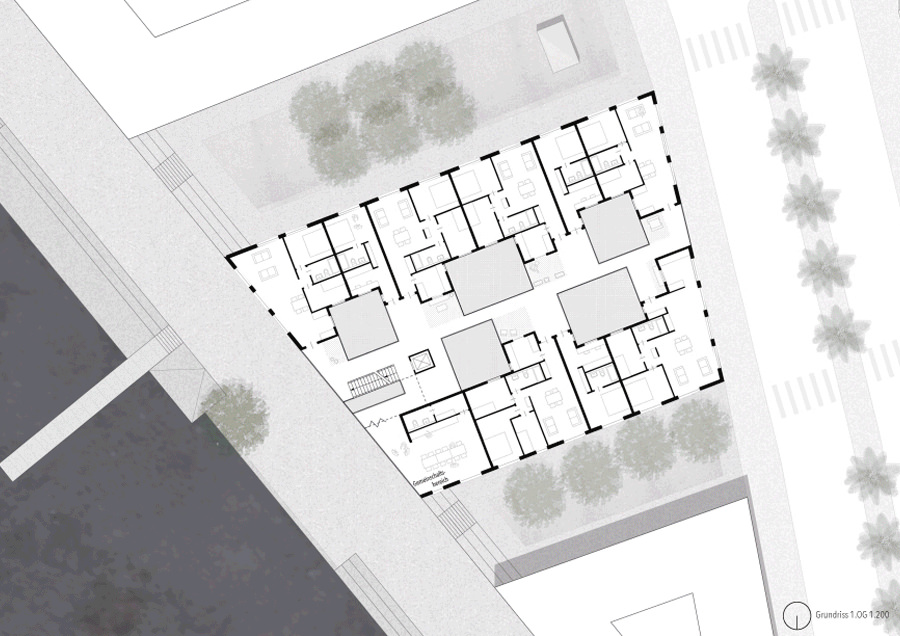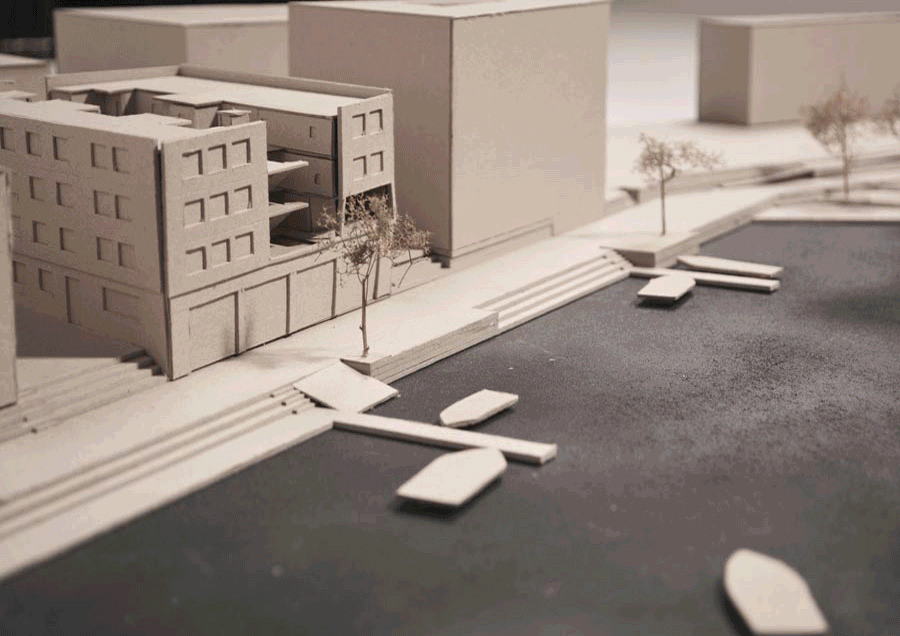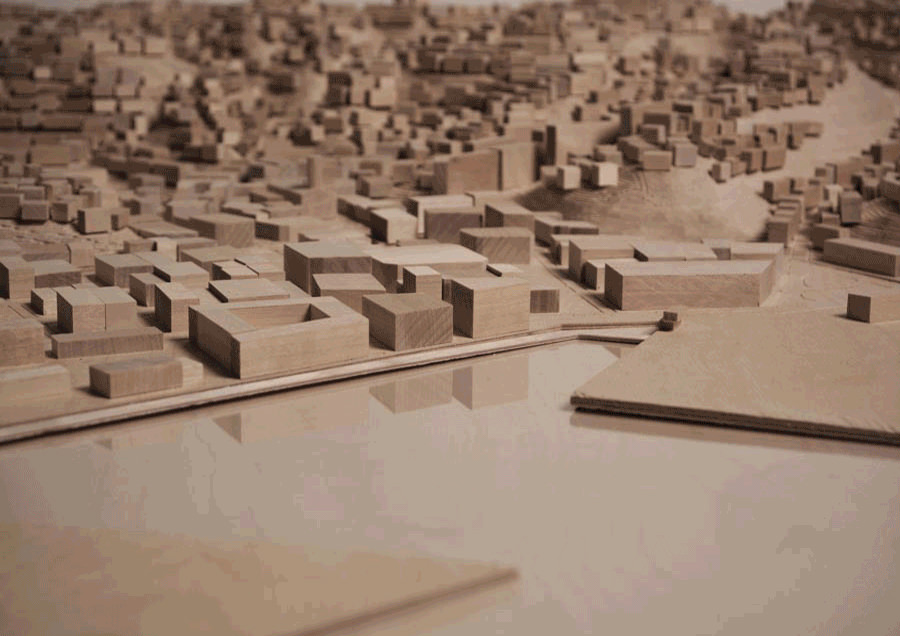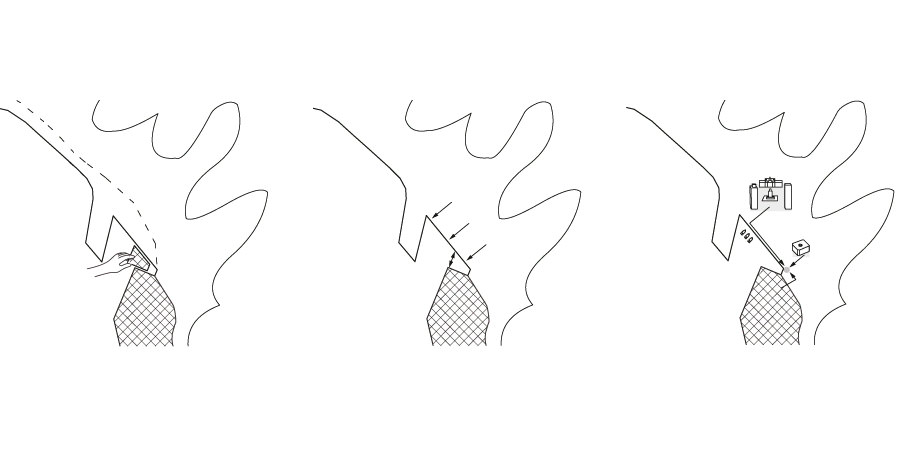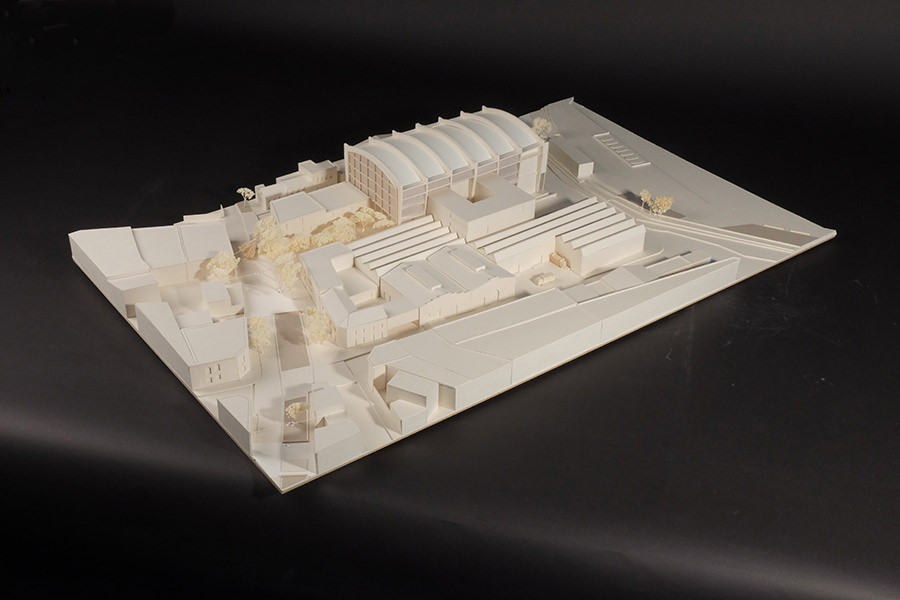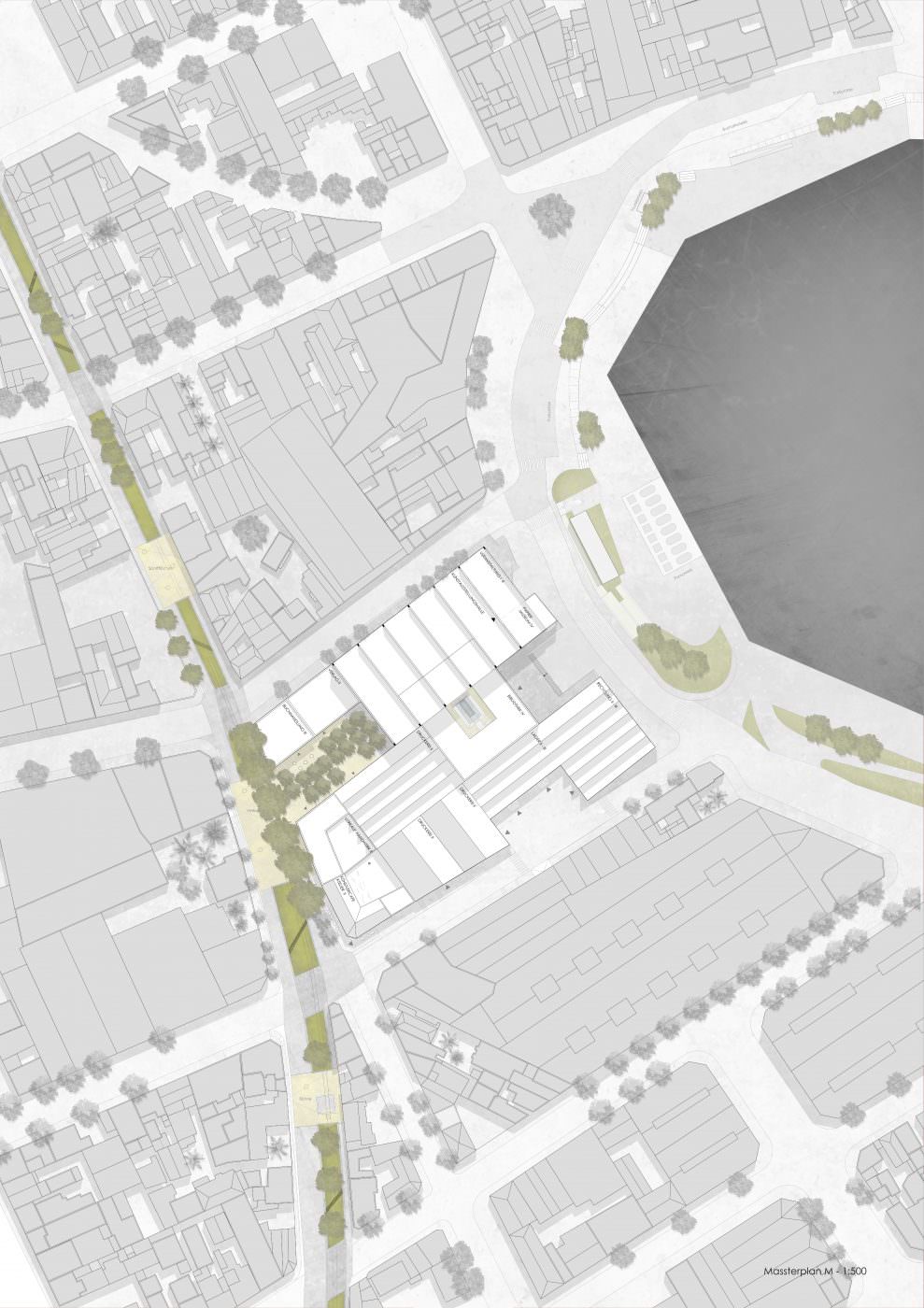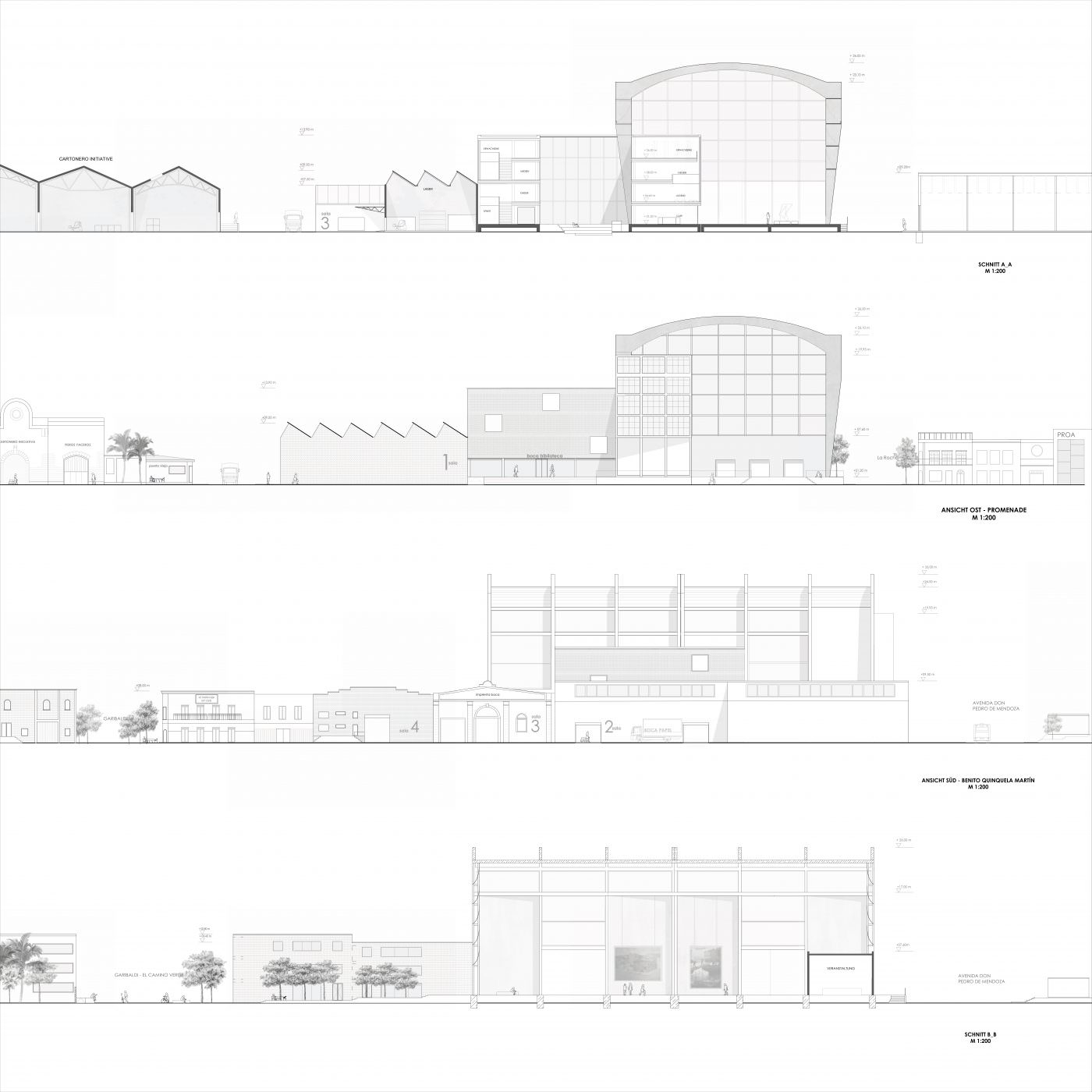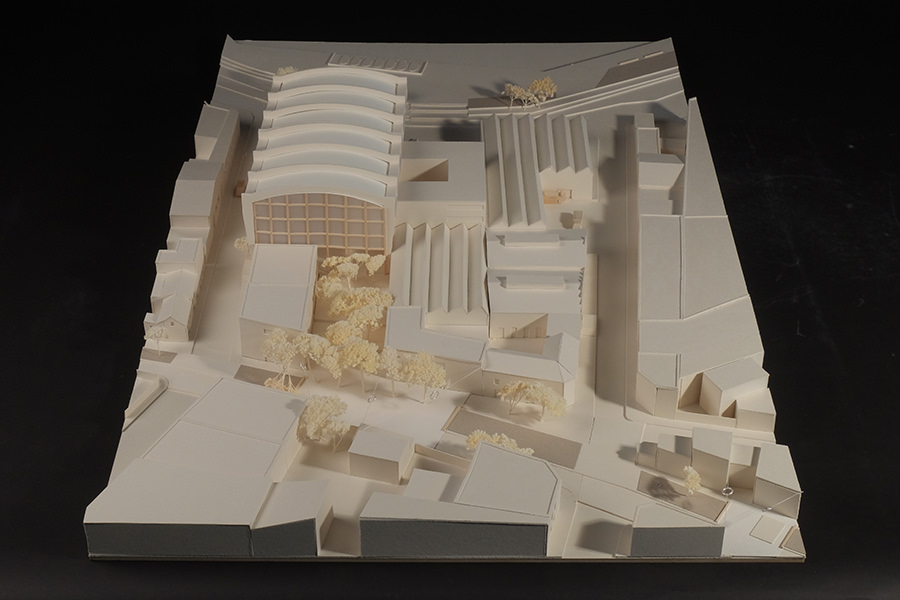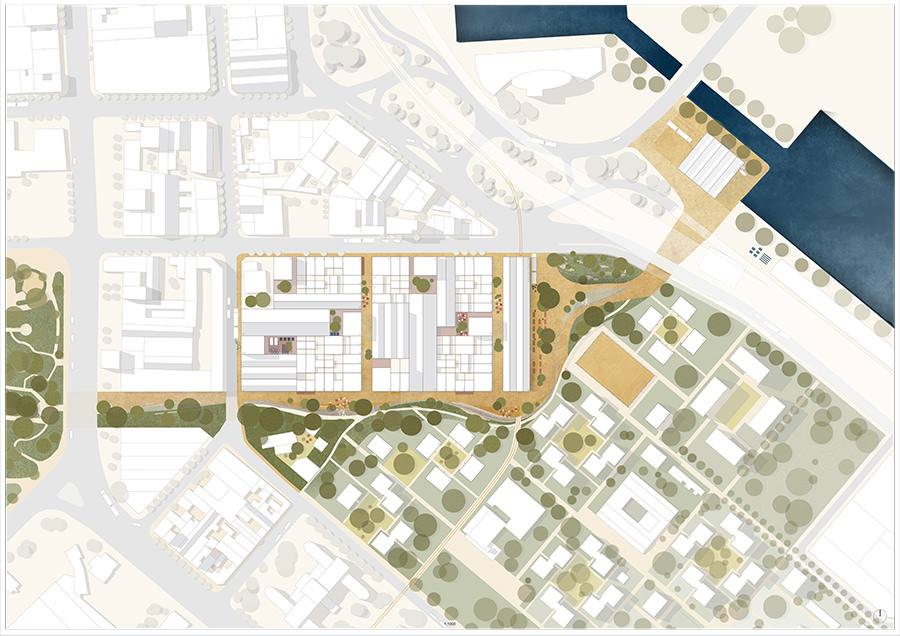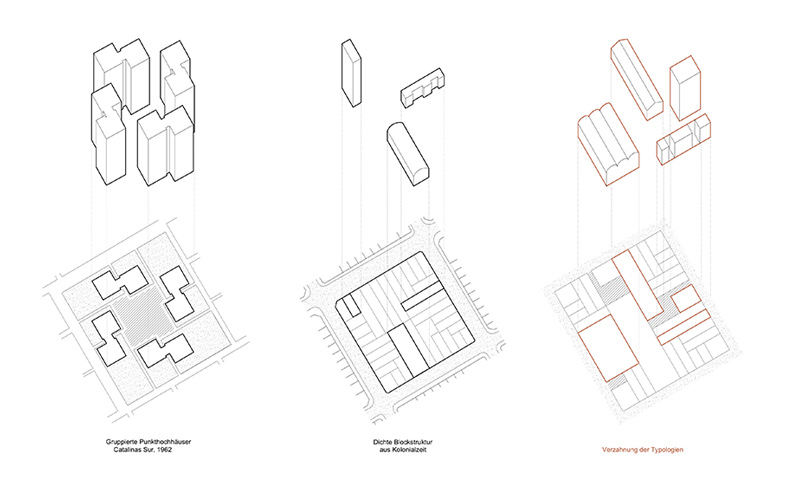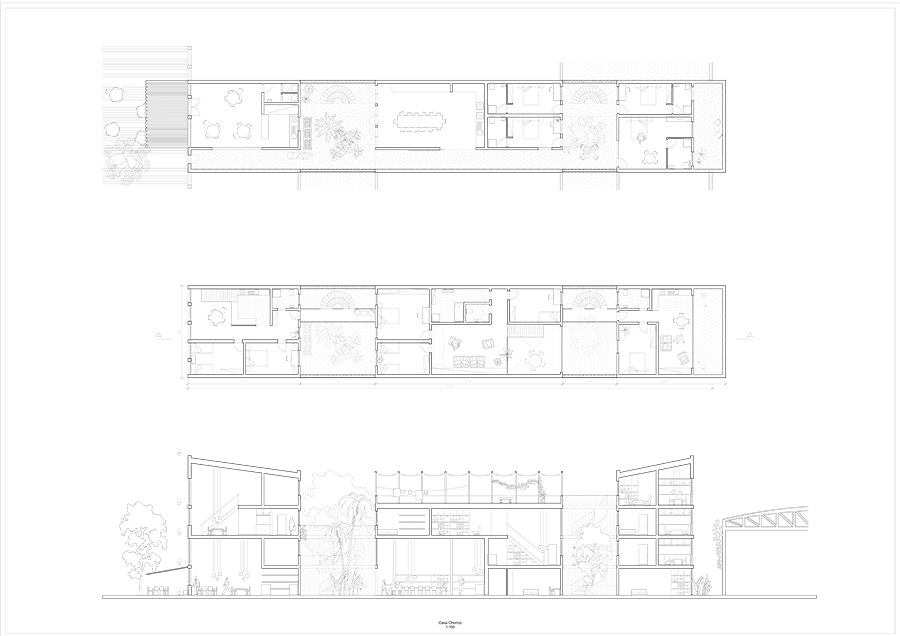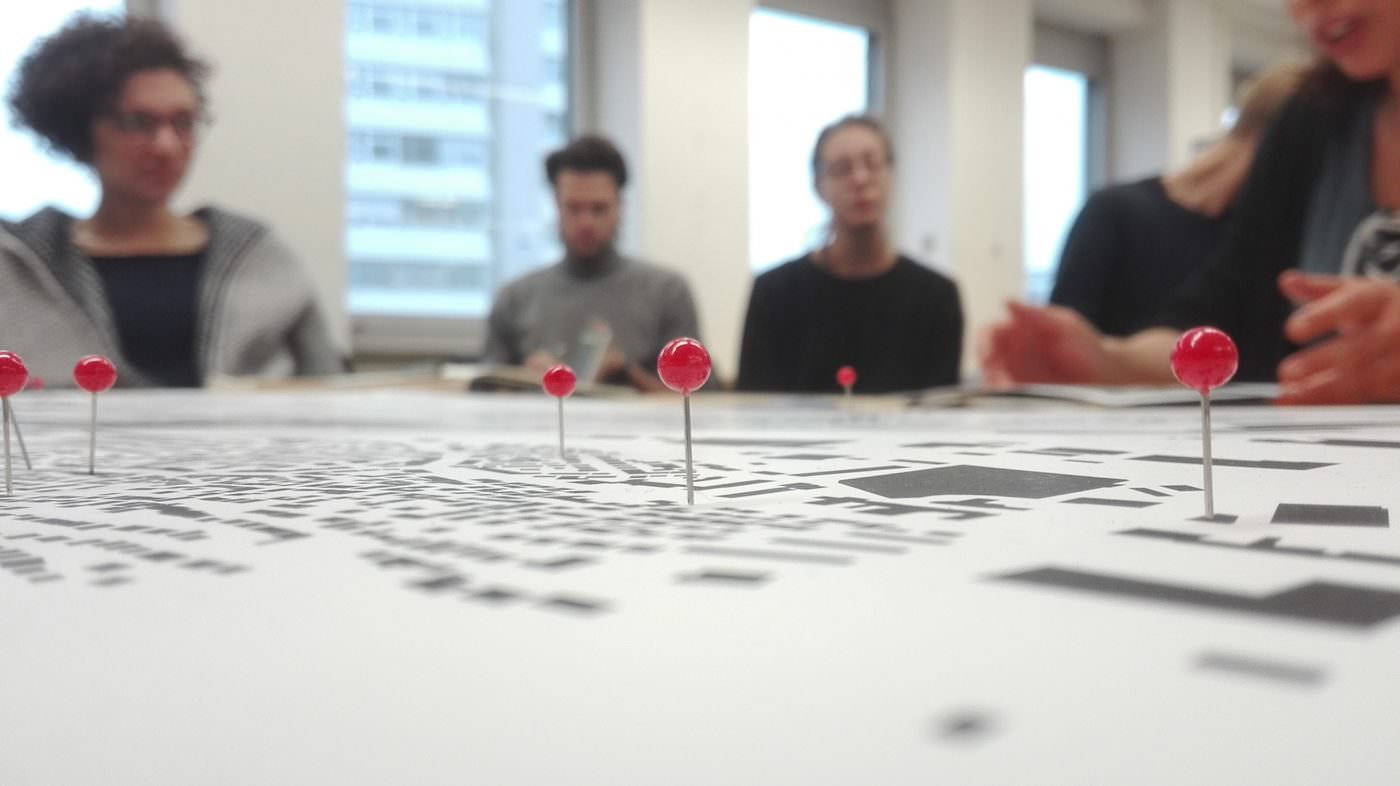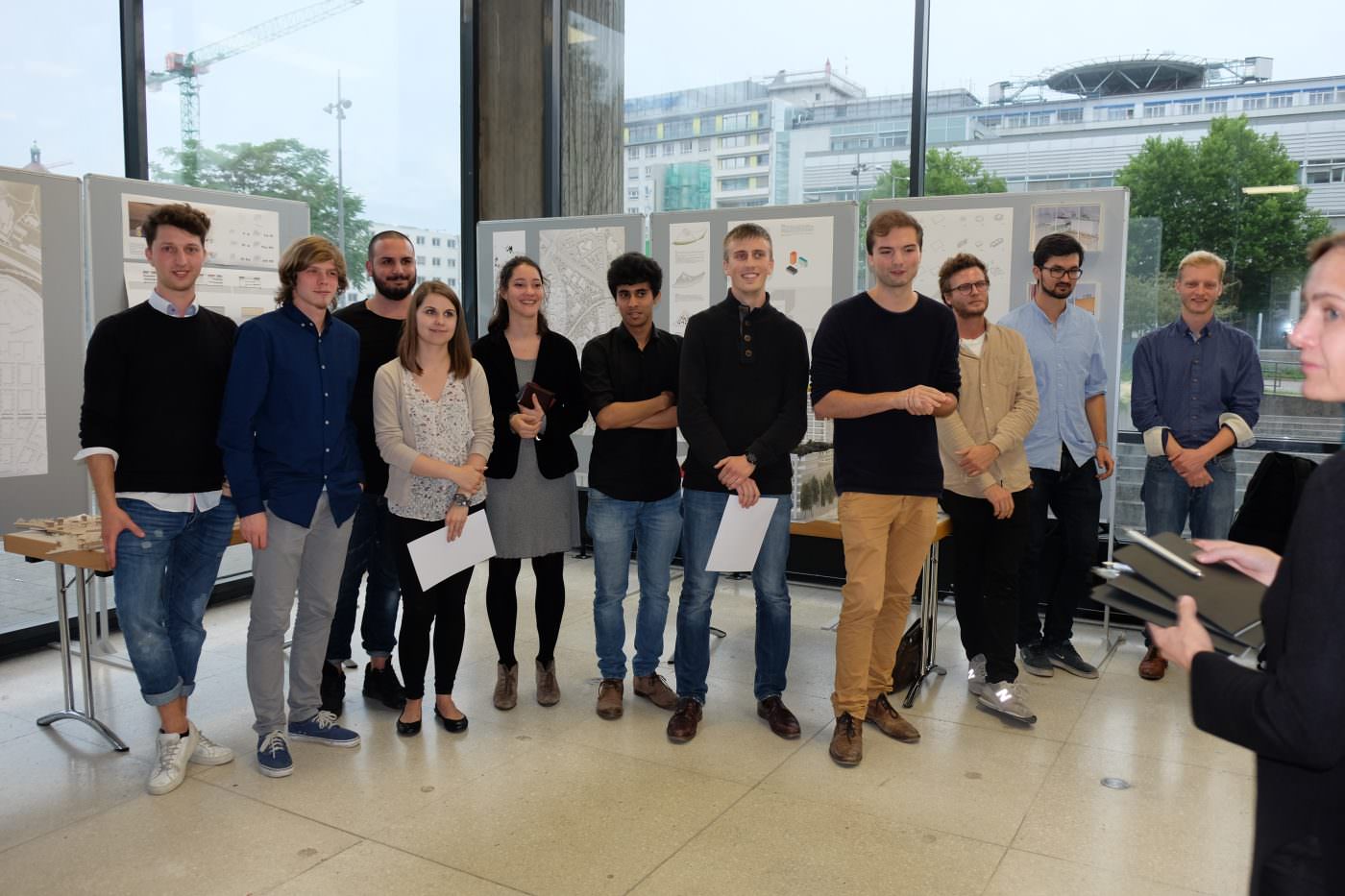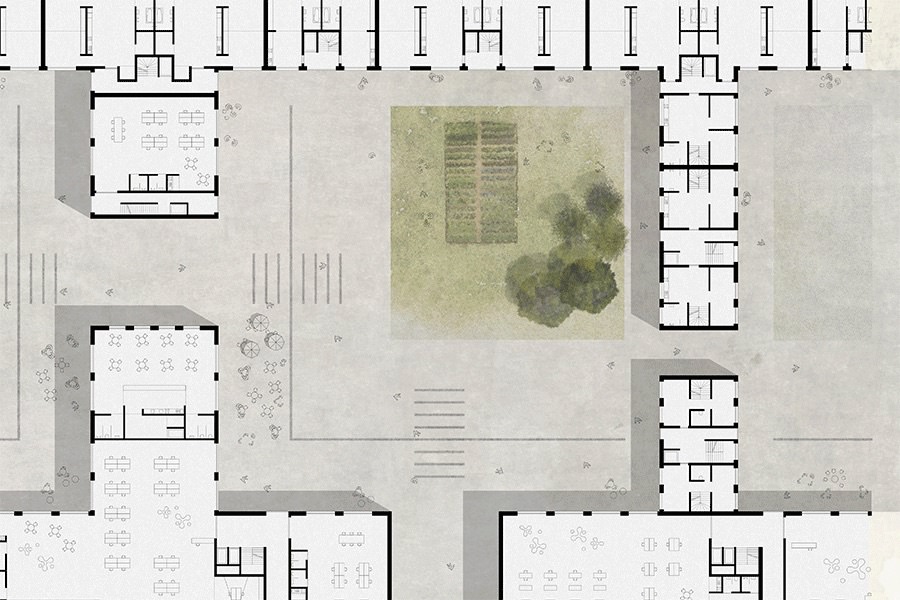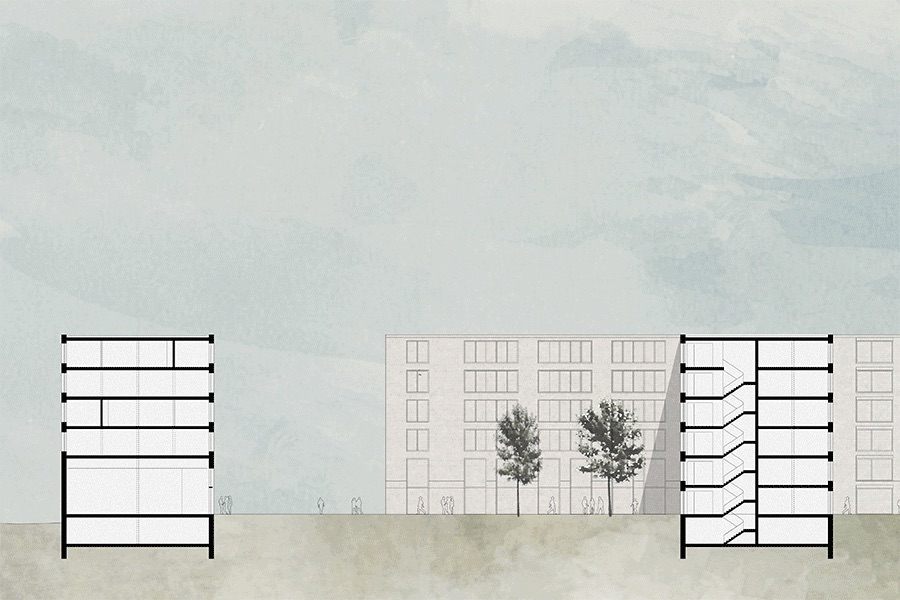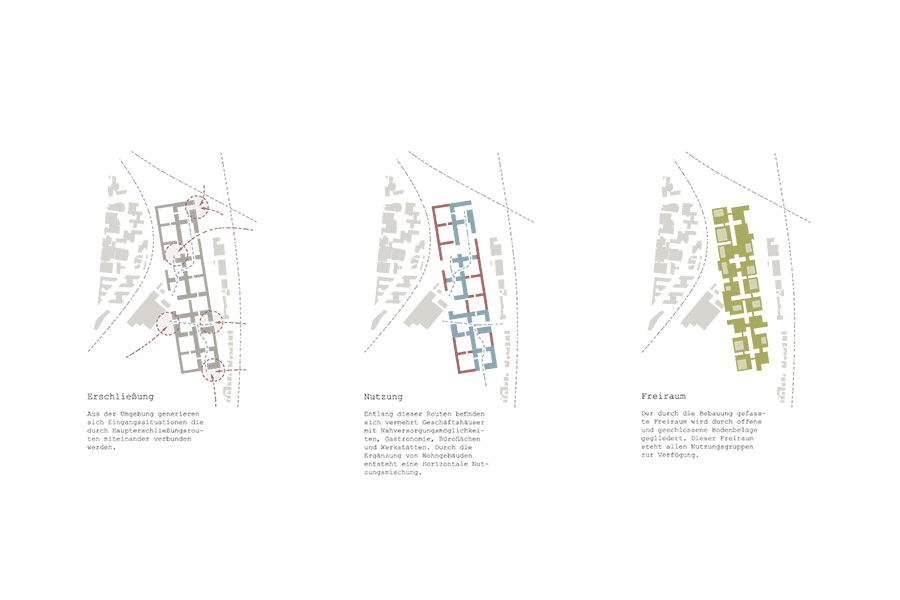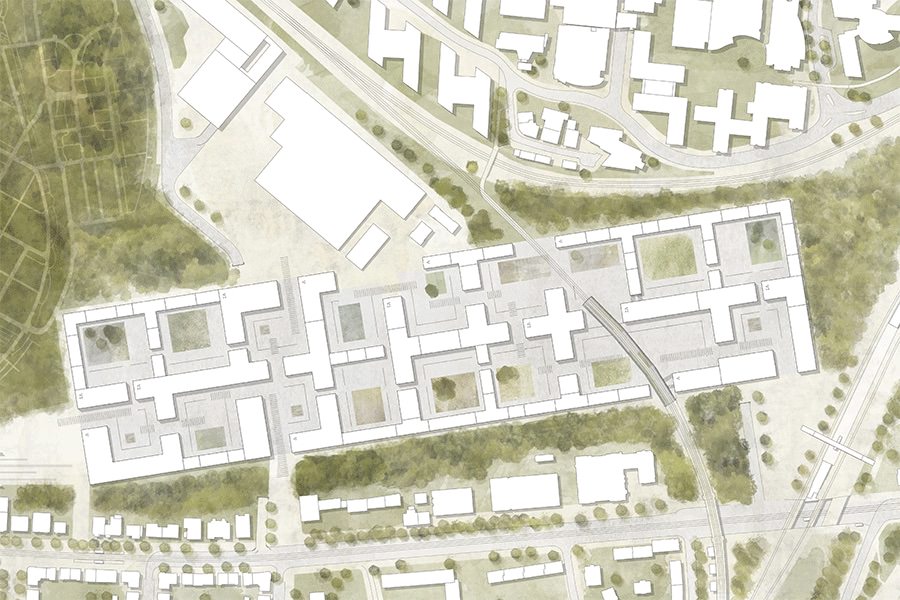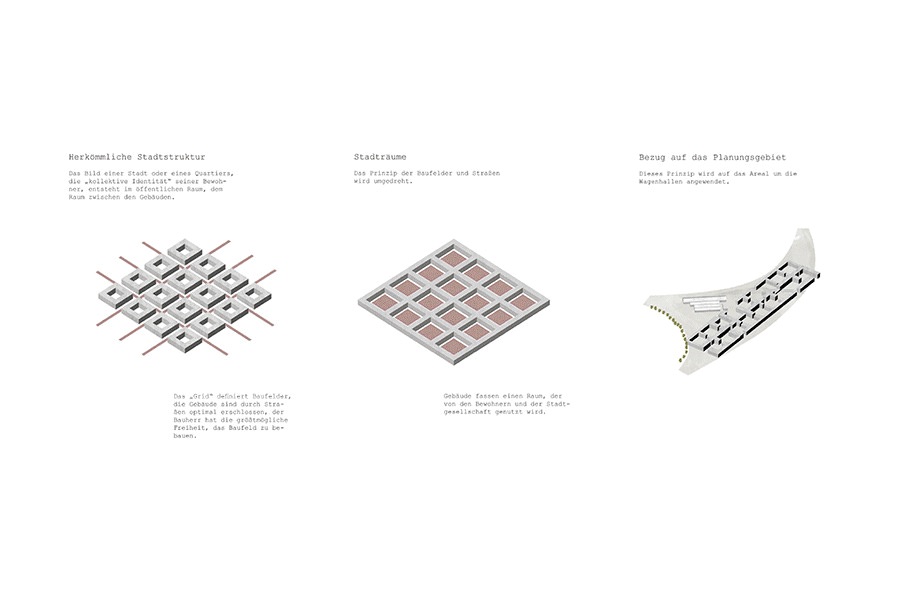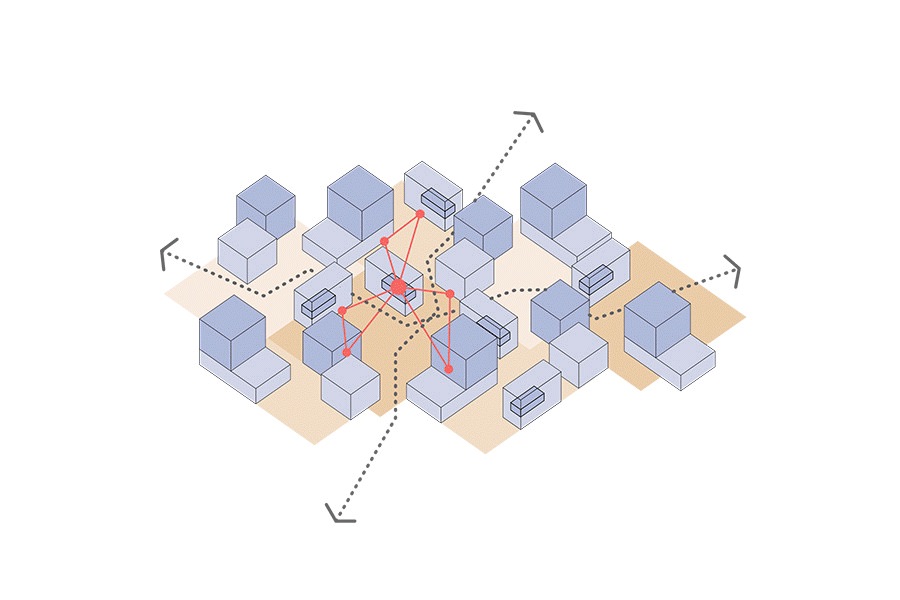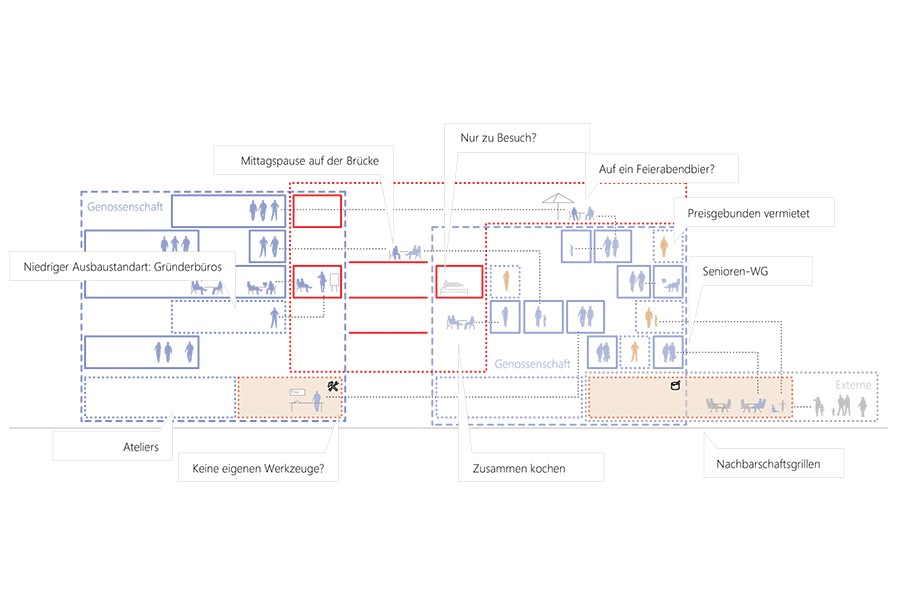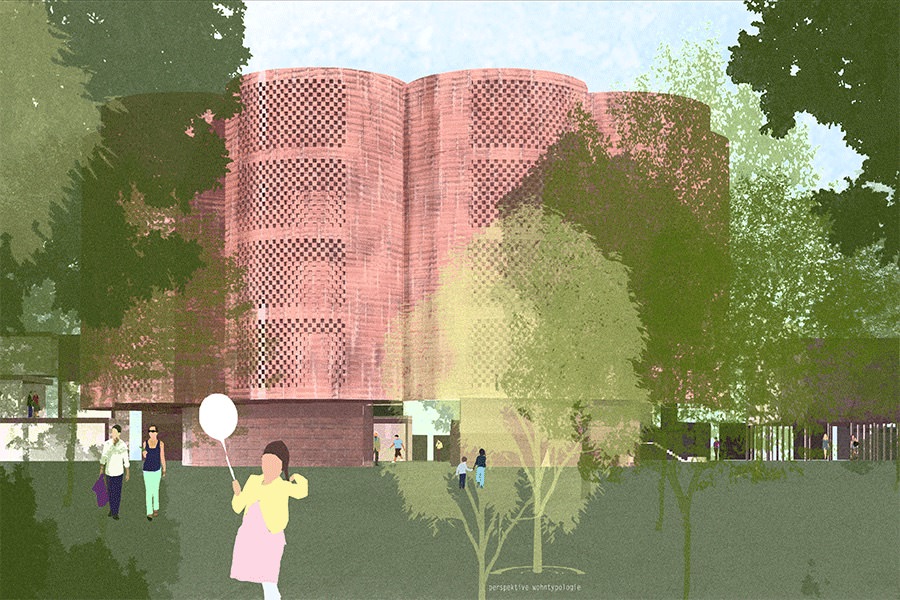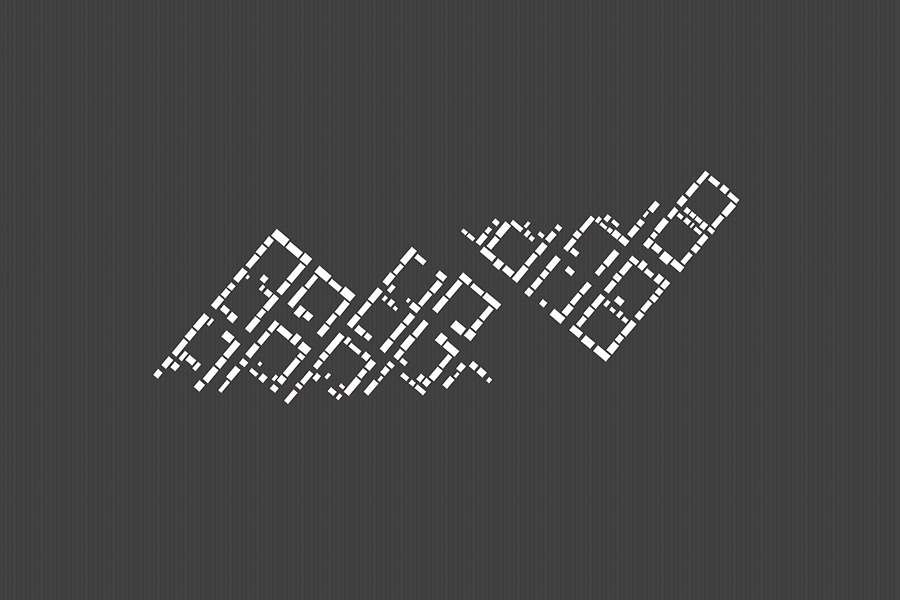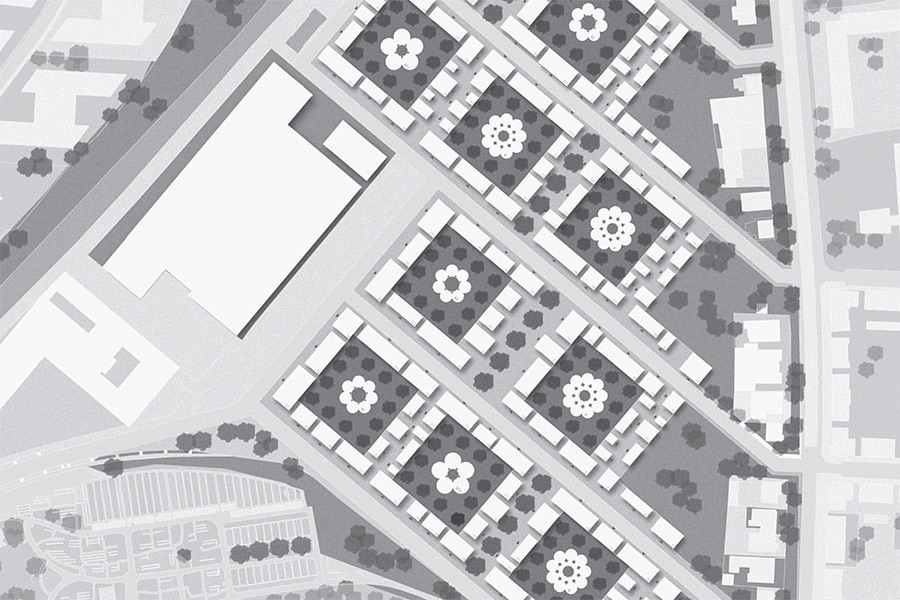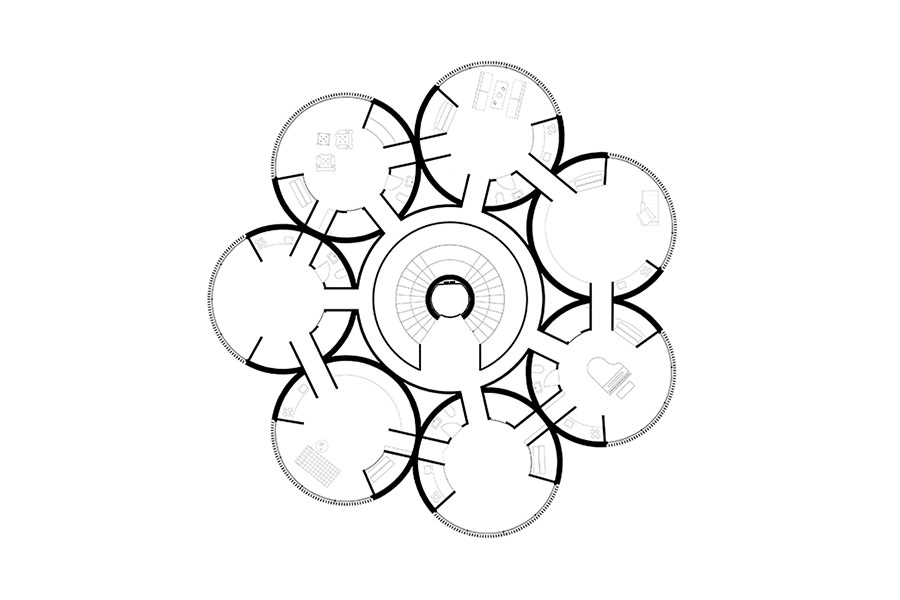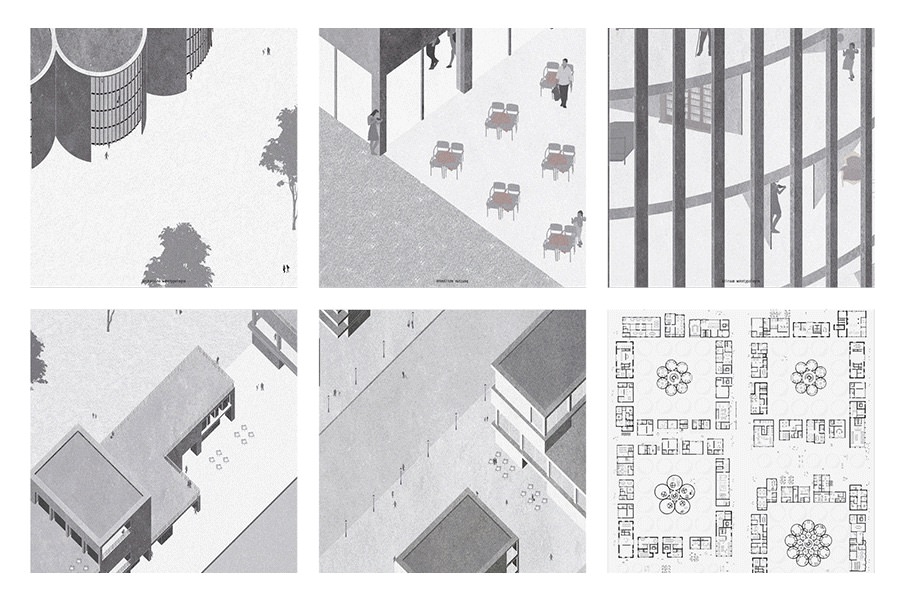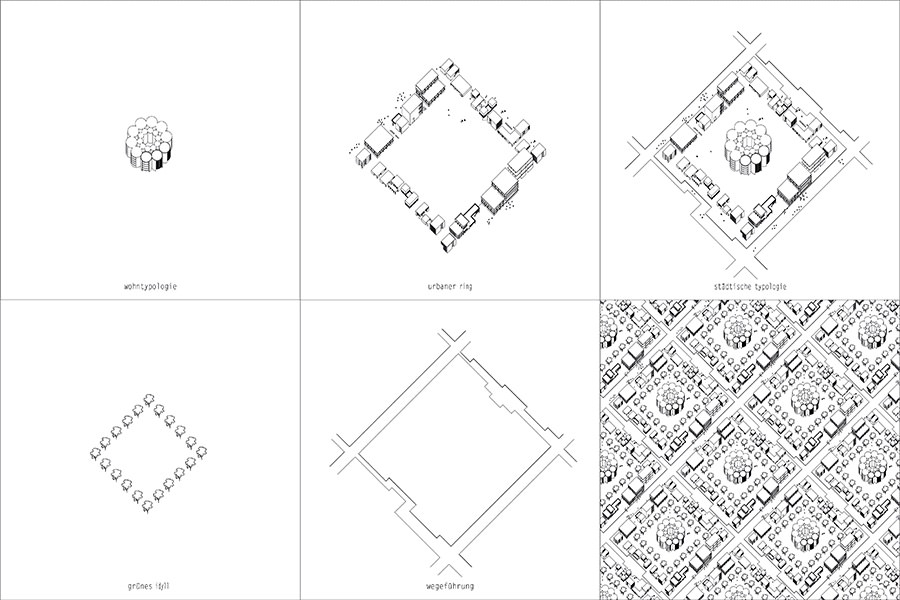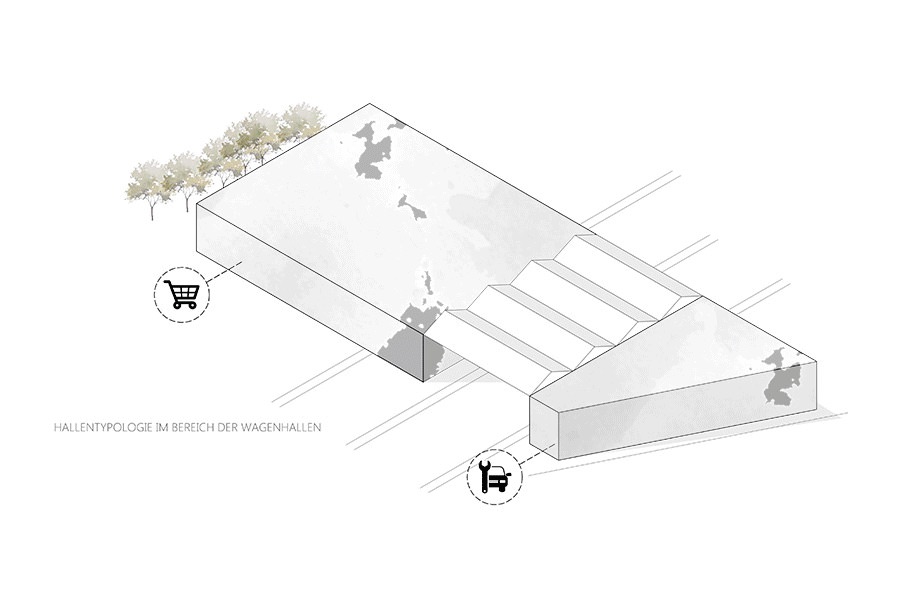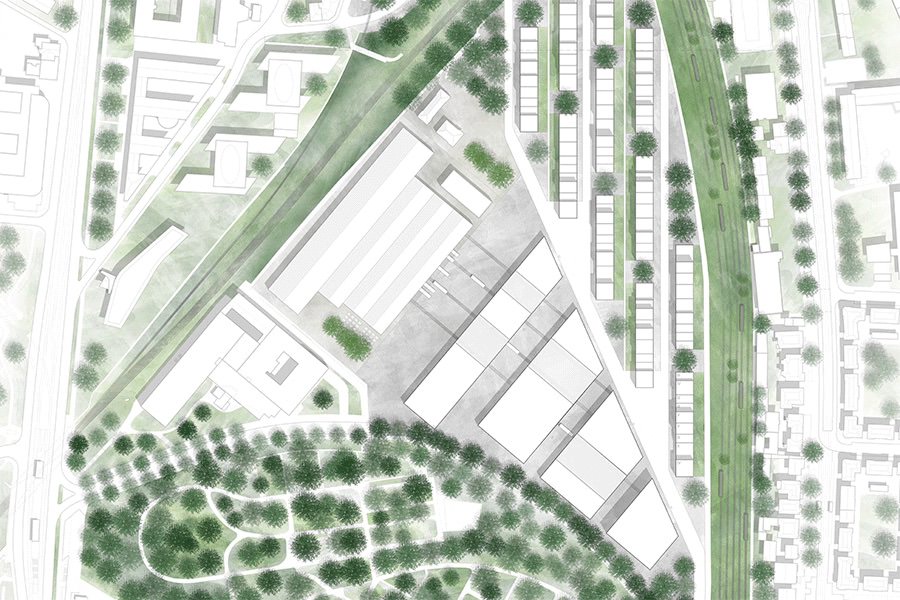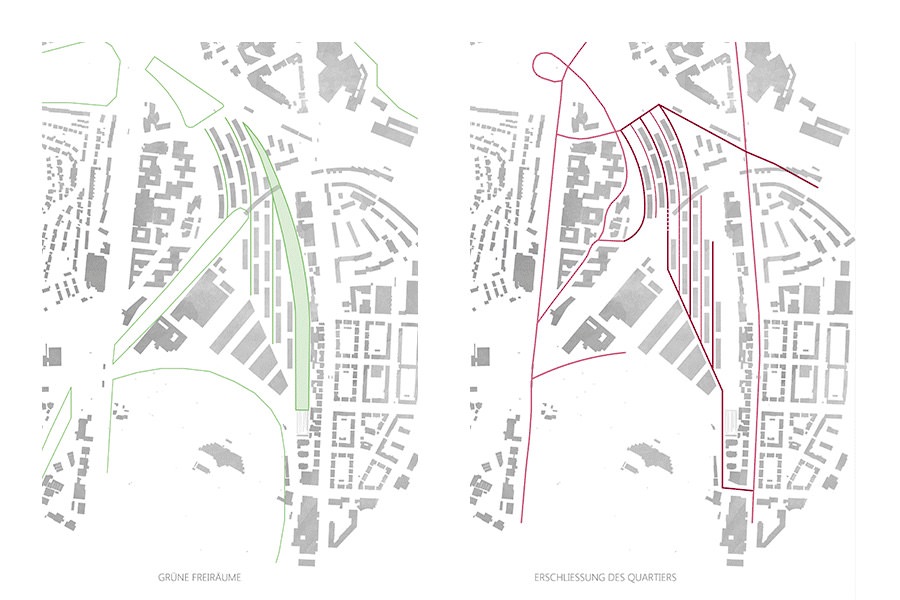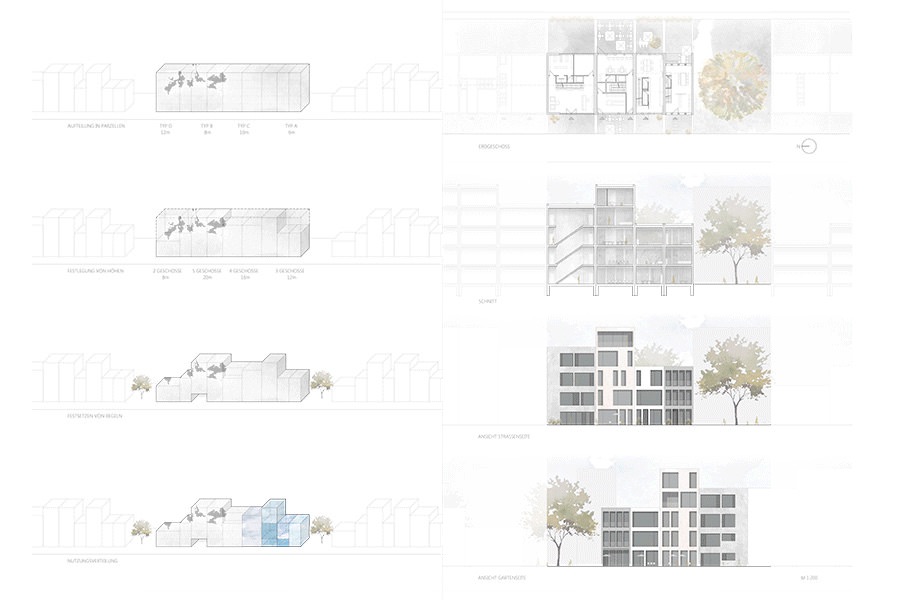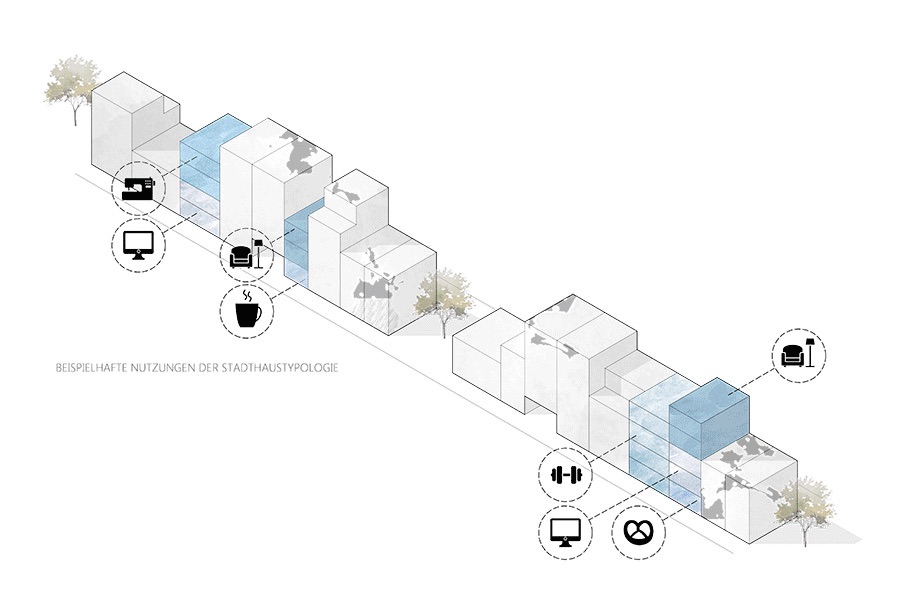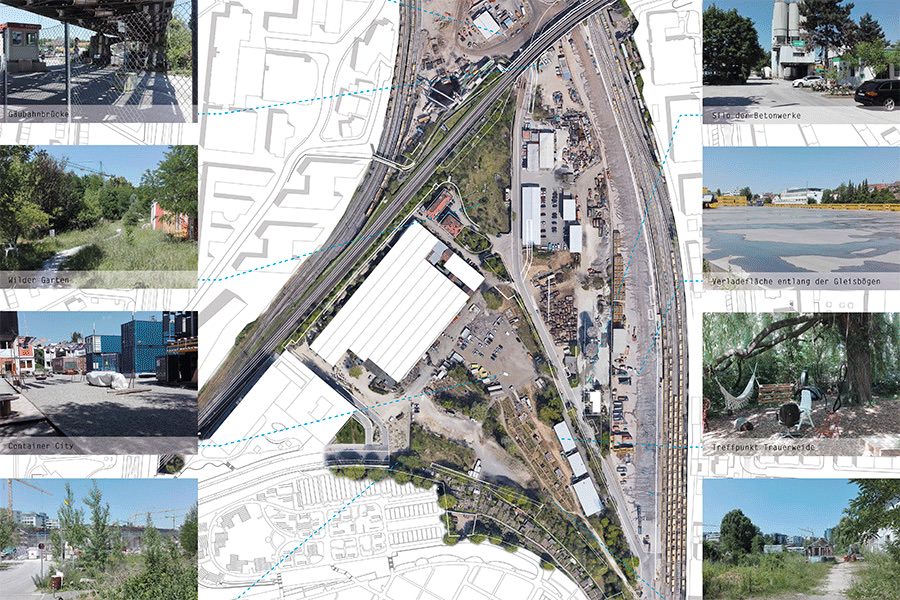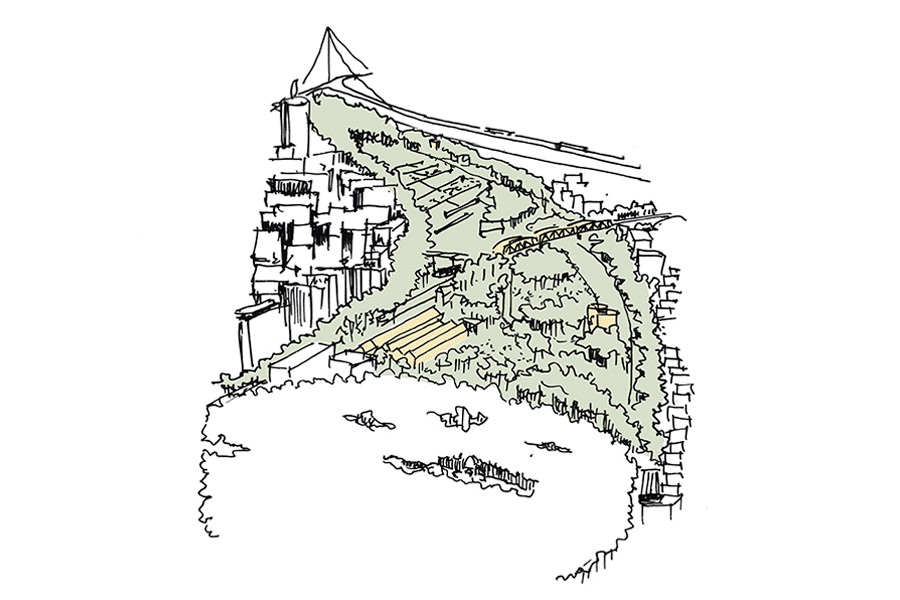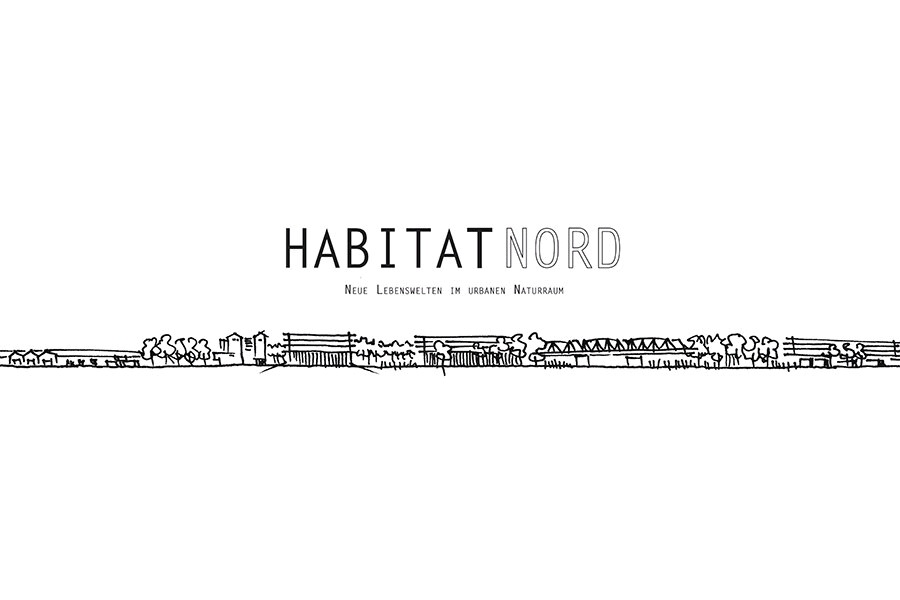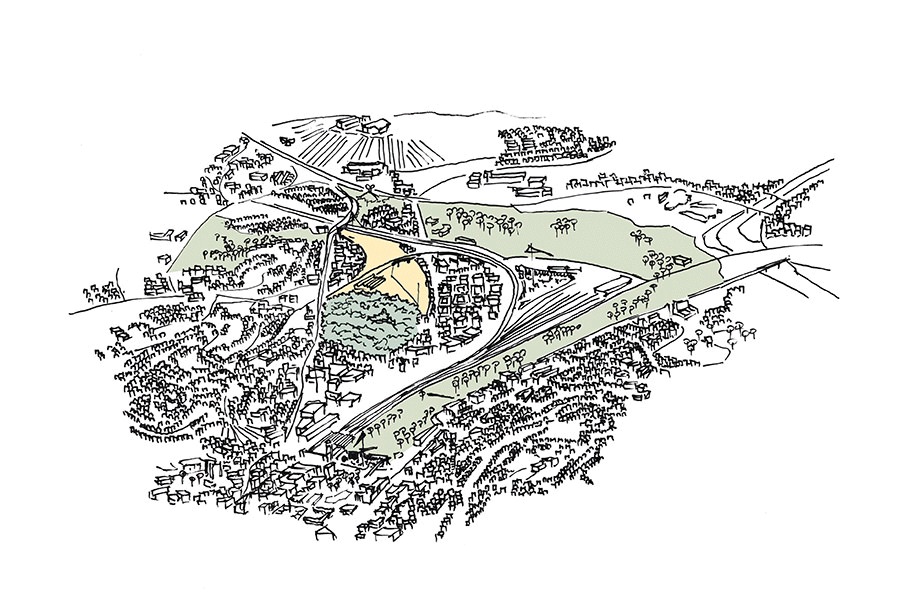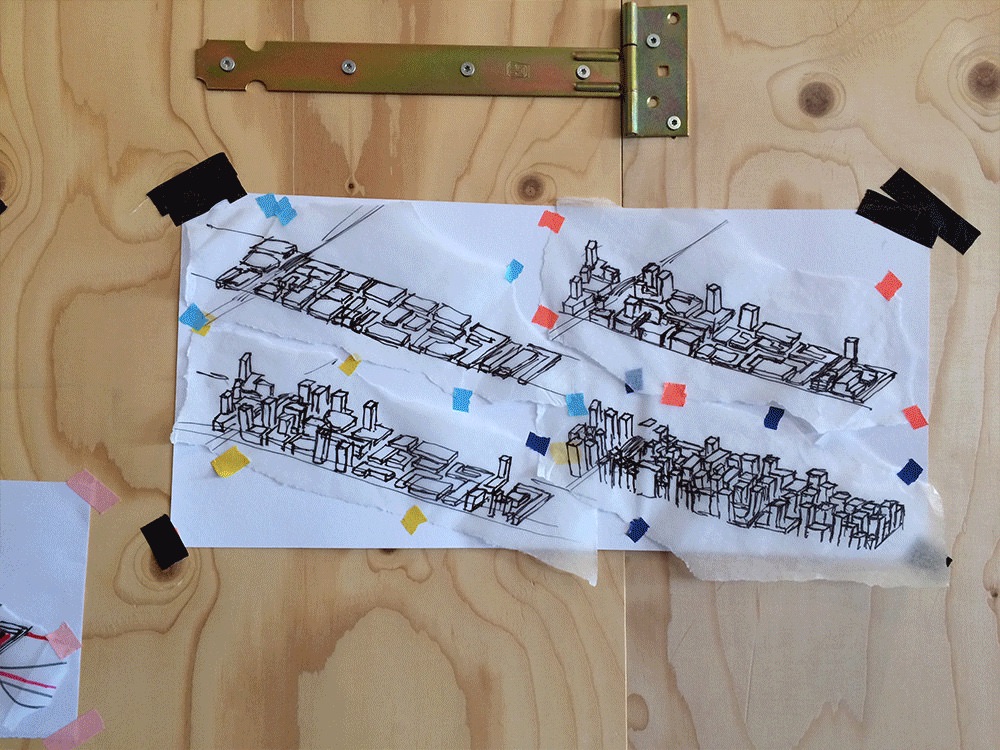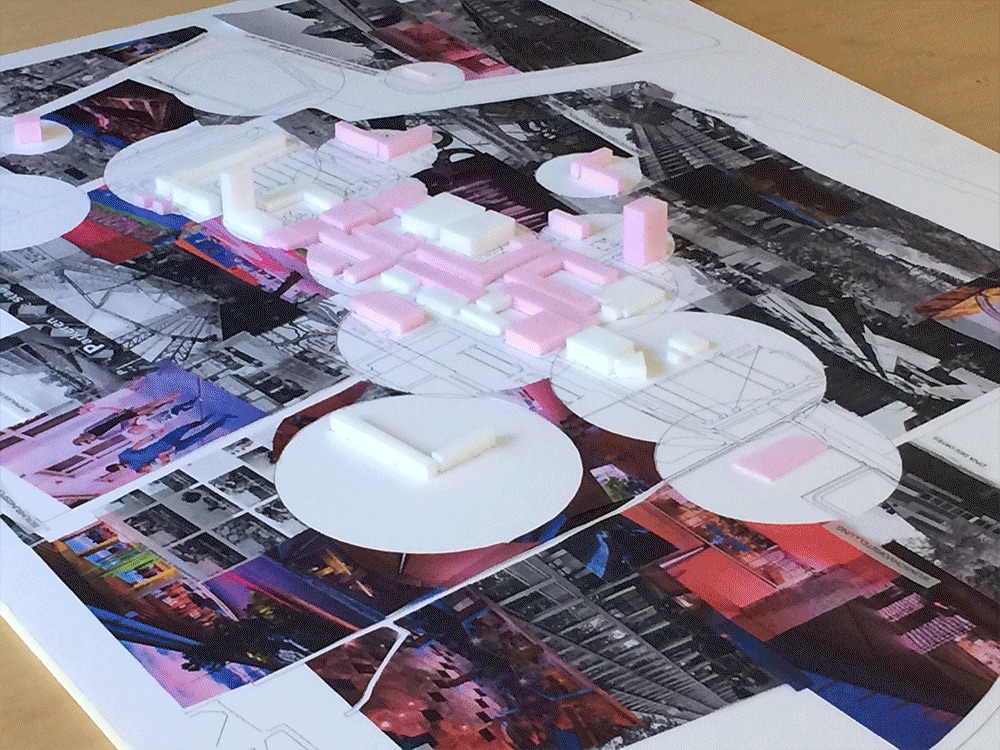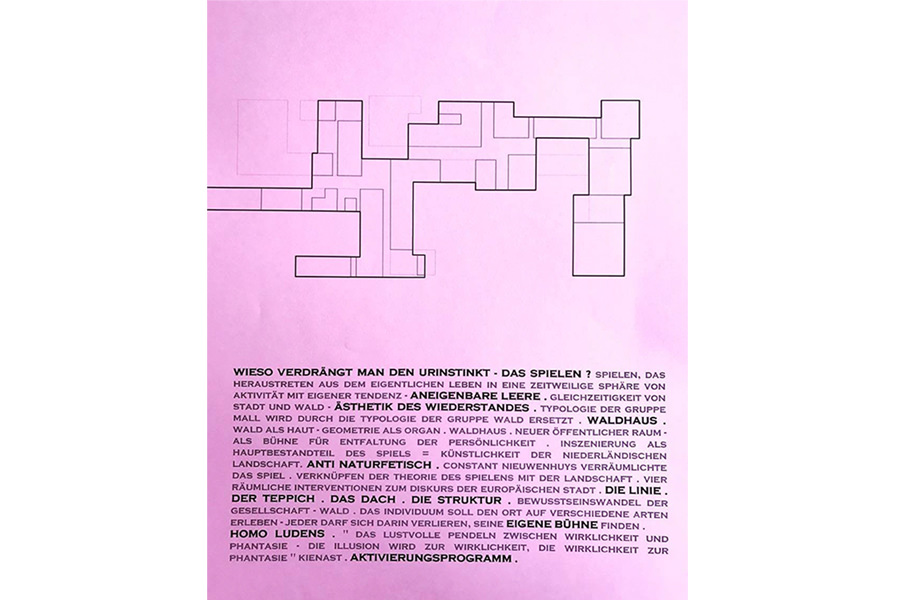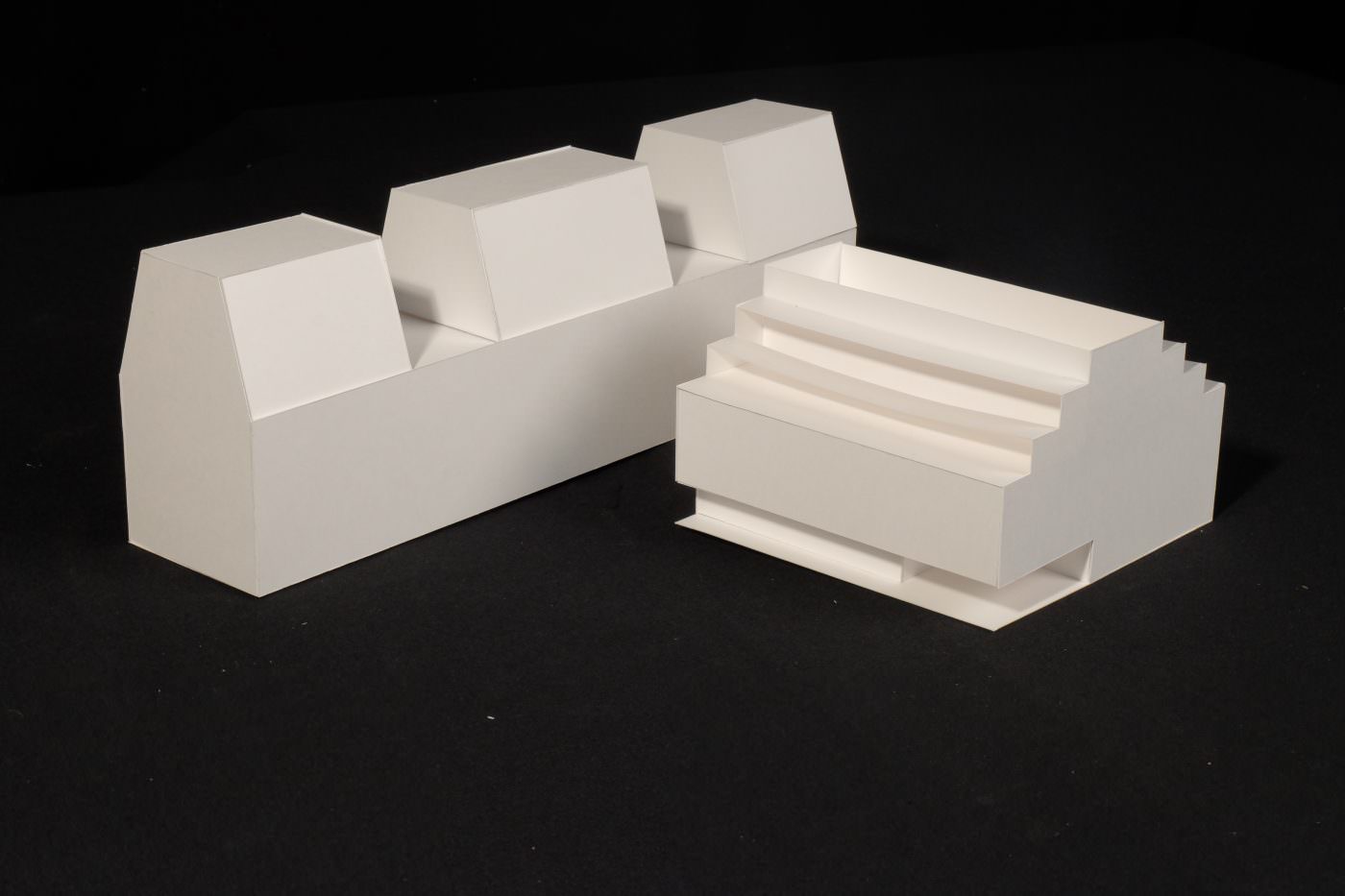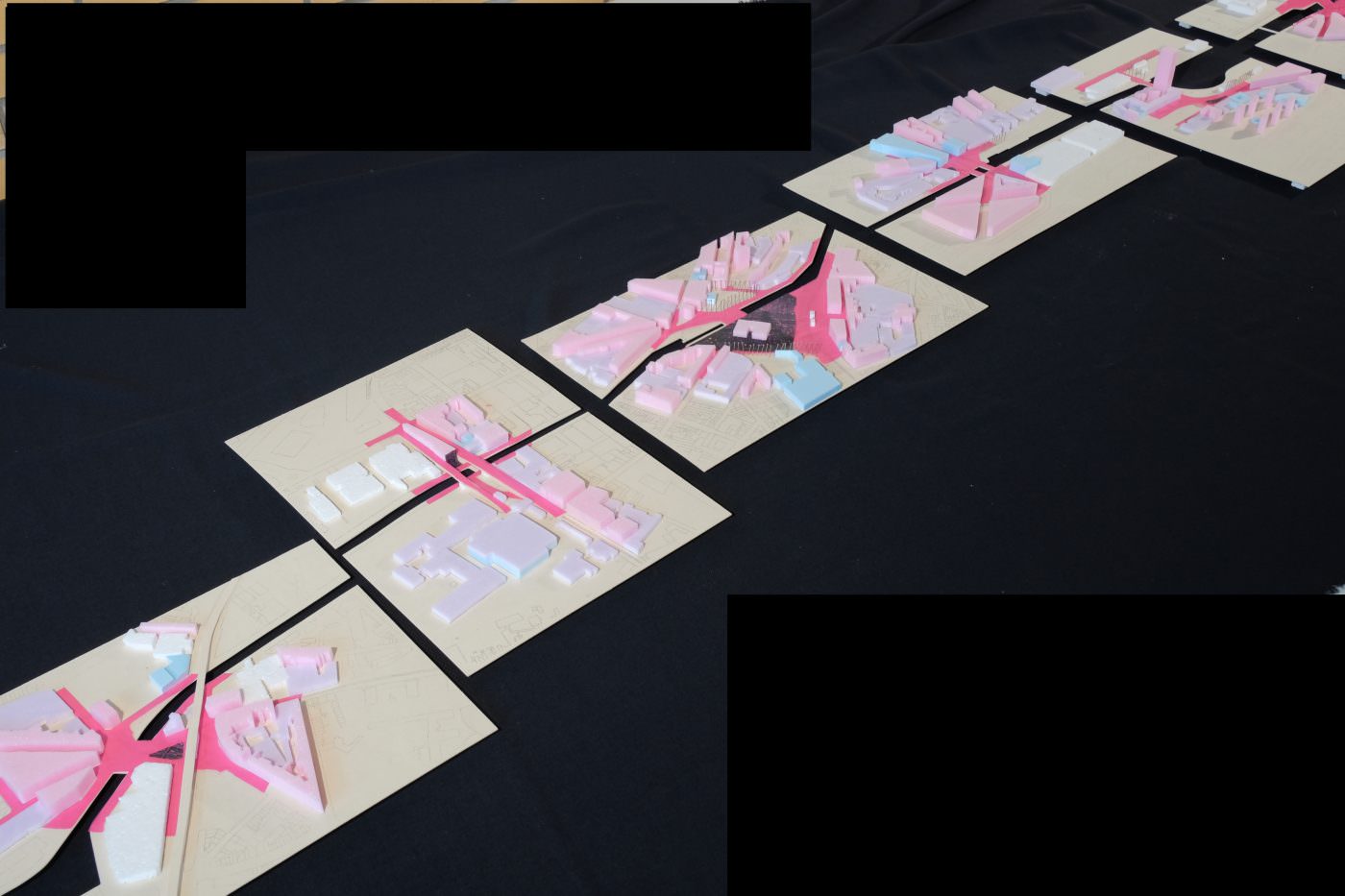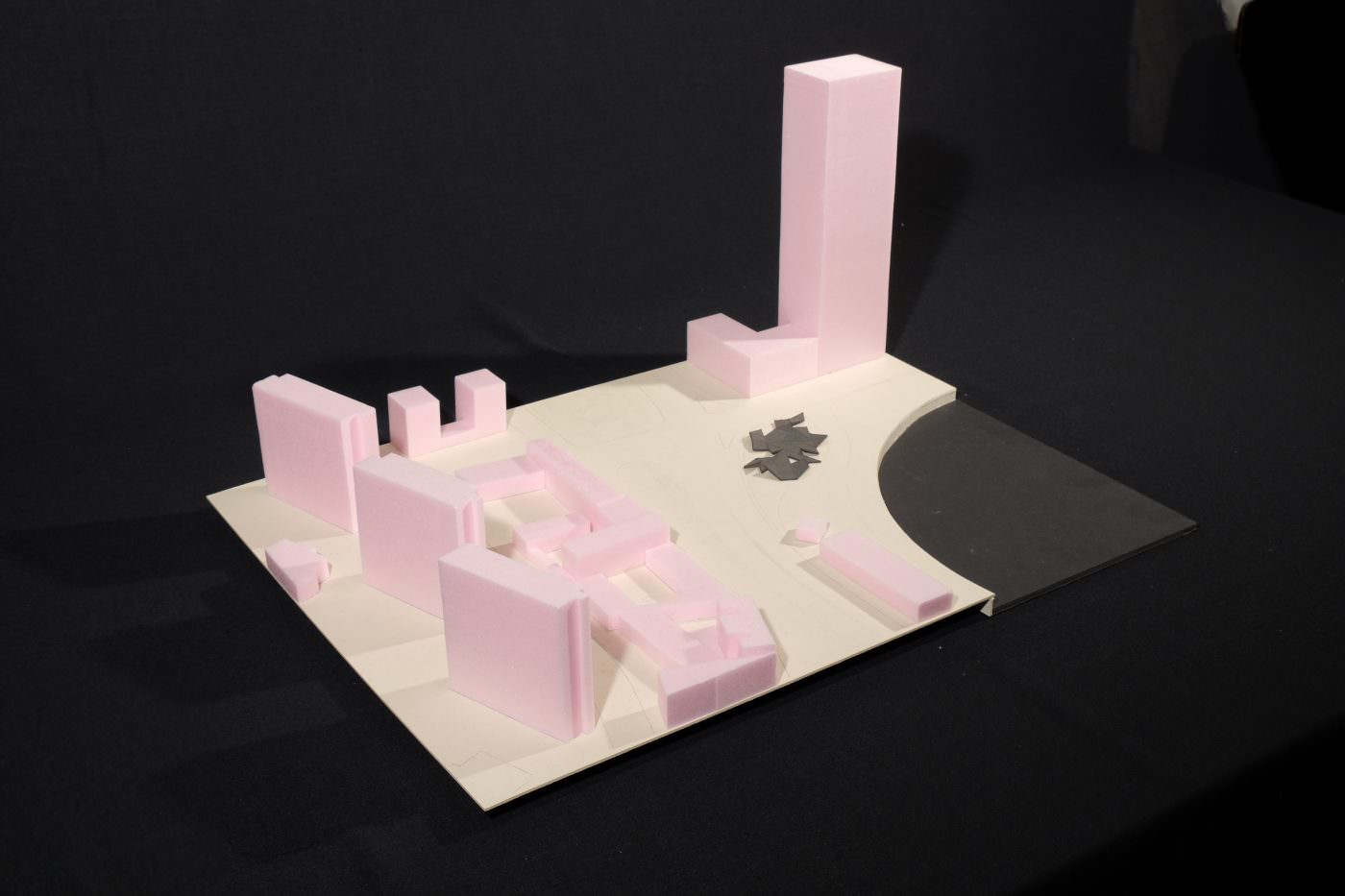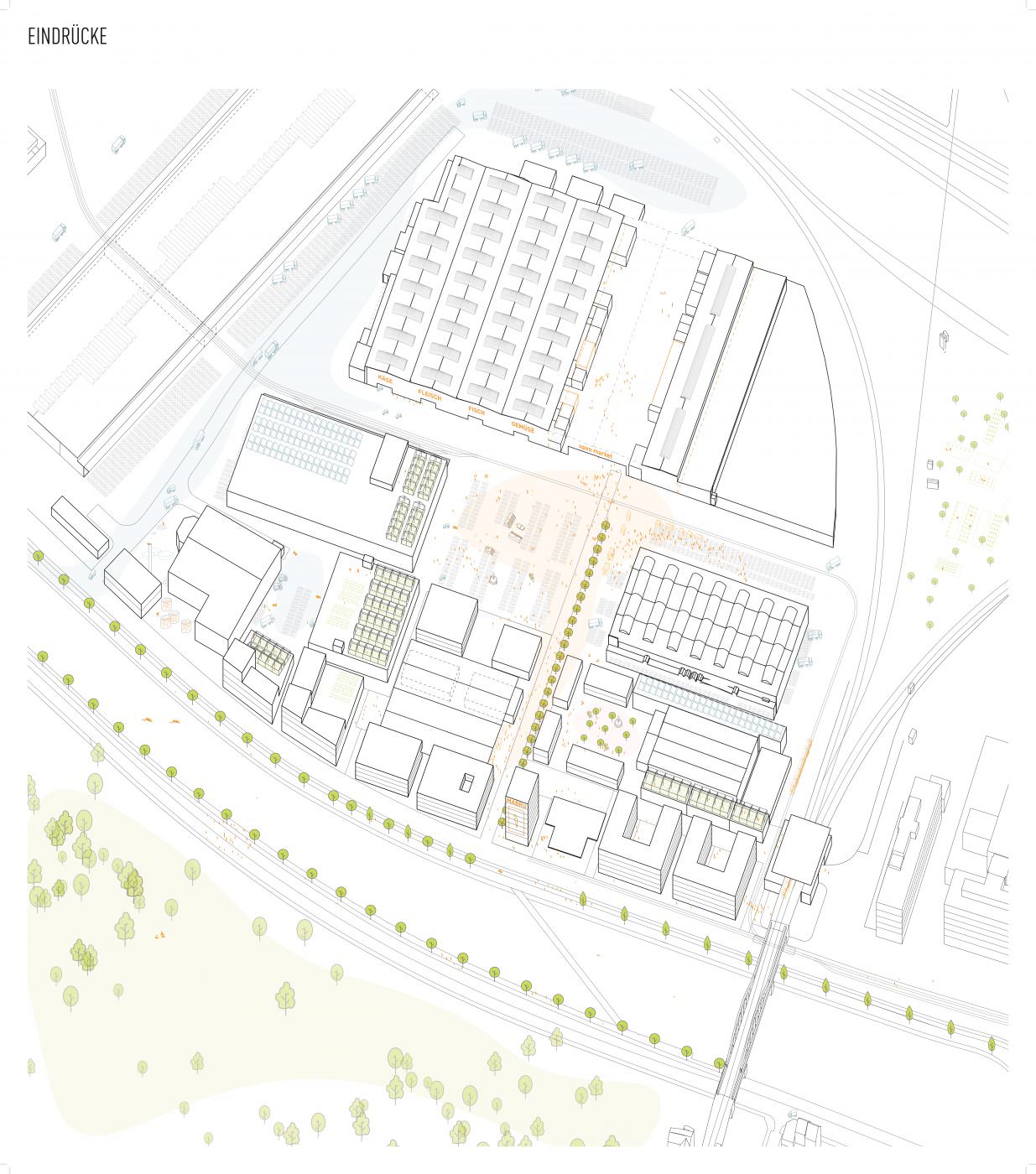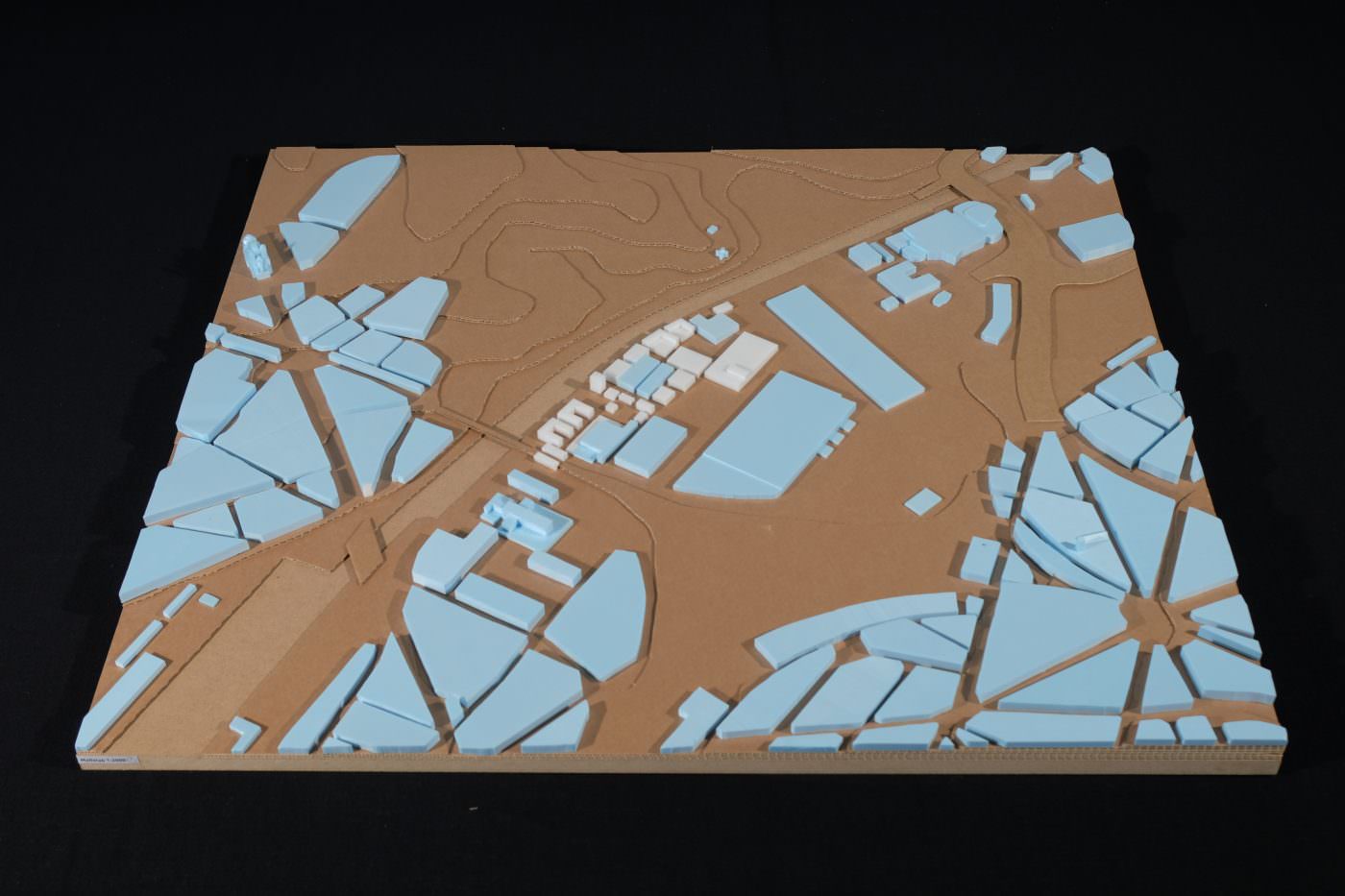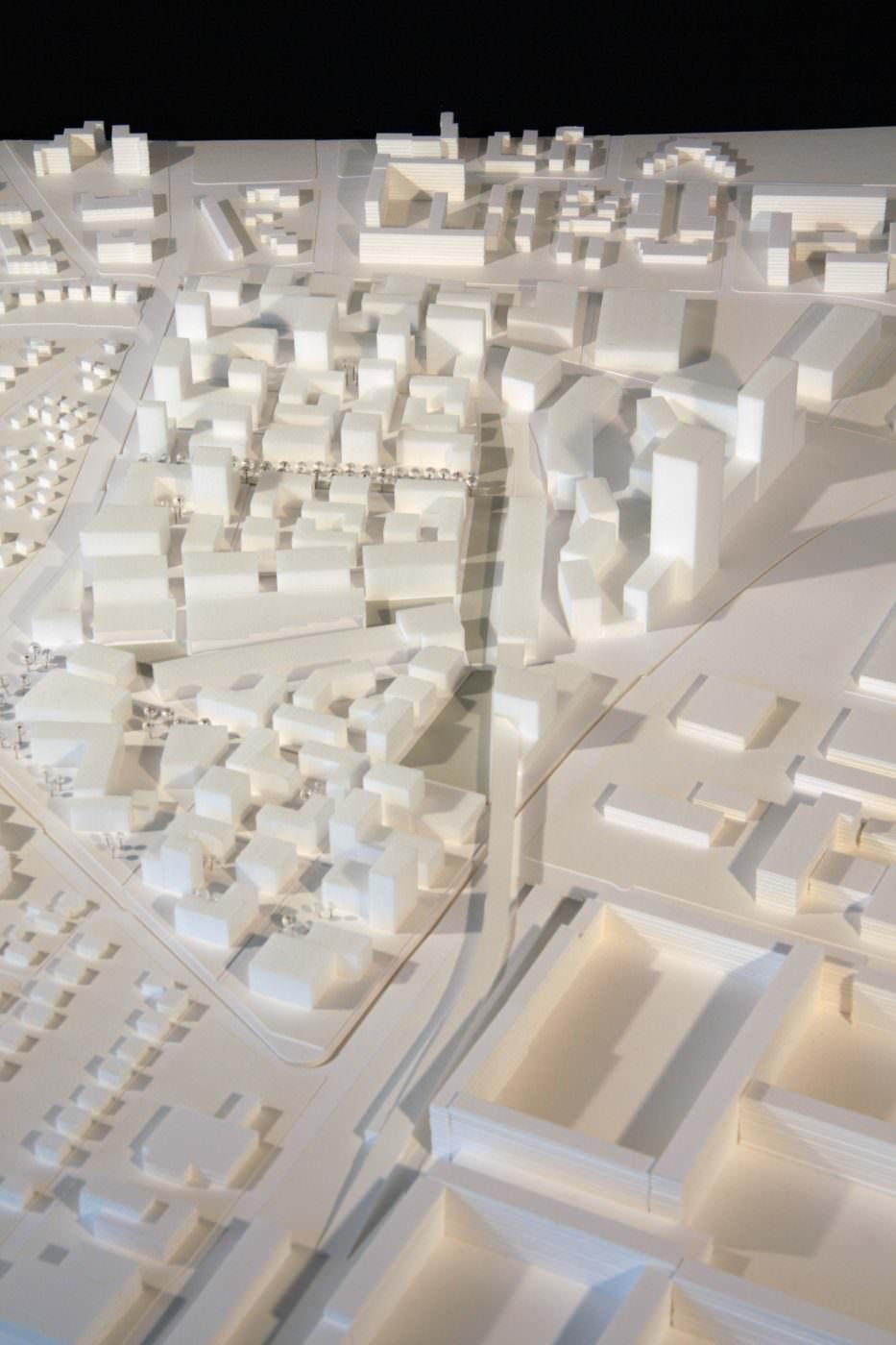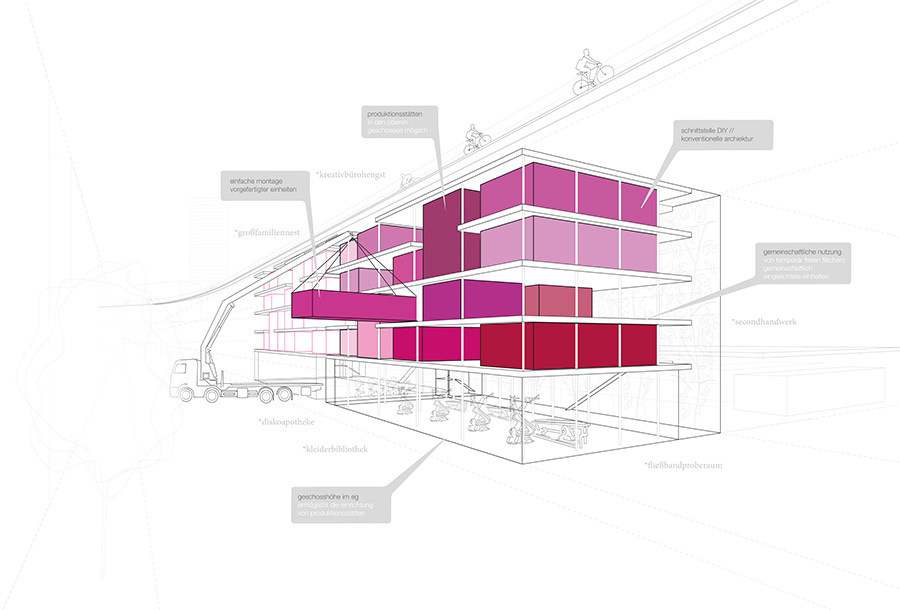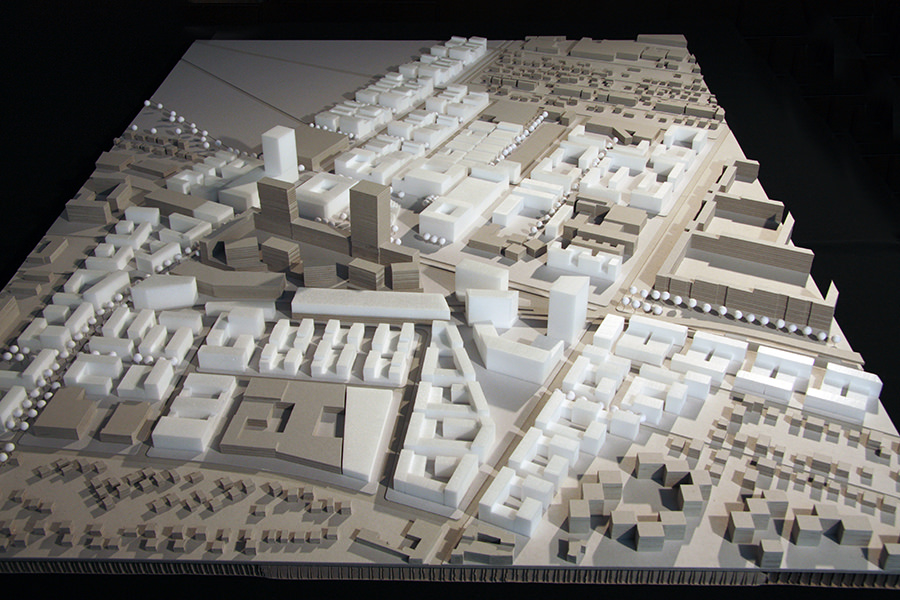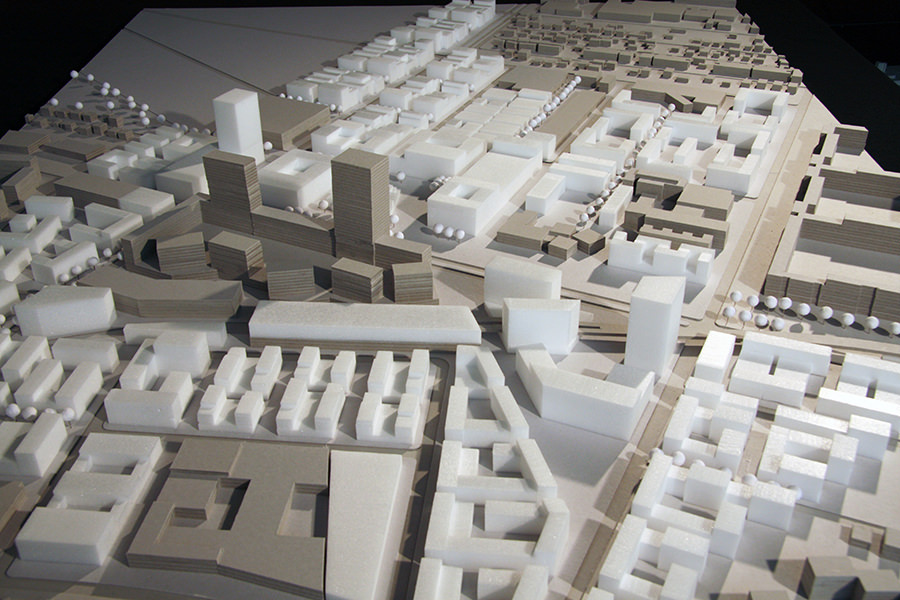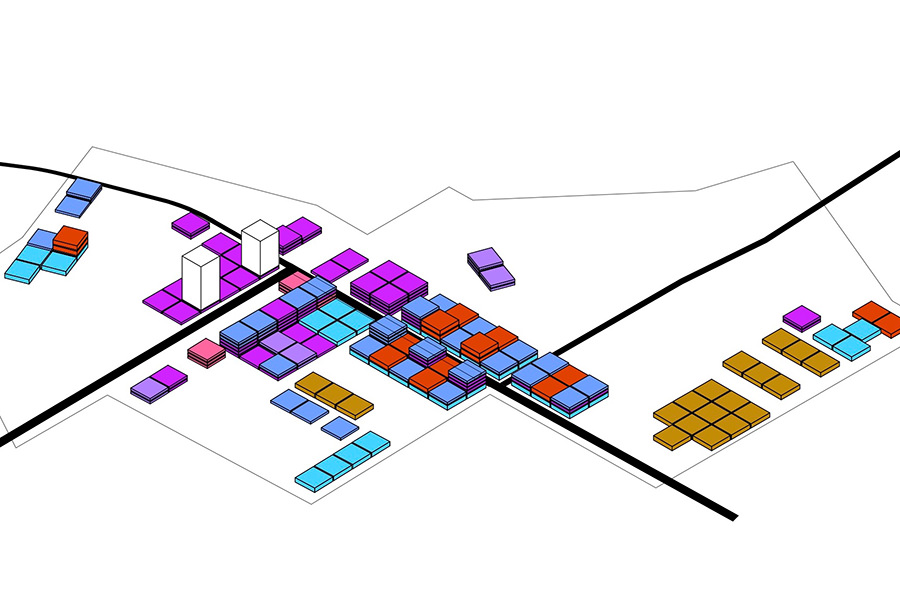EXROTAG
Entwürfe
Die Tabakfabrik
Im Südwesten von Karlsruhe zwischen Daxlanden,Oberreut, Rheinstetten, Beiertheim-Bulach, der Süd-weststadt,Weststadt und Mühlburg liegt der 1668 gegründete und 1909 in Karlsruhe eingemeindete Stadtteil Grünwinkel. Der stark gewachsene Stadtteil teilt sich heute in Alt-Grünwinkel, Hardecksiedlung,Albsiedlung und die Alte sowie Neue Heidenstückersiedlung. Eine heterogene Nutzungsmischung ausWohnen, Kultur und Gewerbe kennzeichnen den Ort. In unmittelbarer Nähe zum Westbahnhof zwischen Zeppelinstraße im Norden, Hardeckstraße im Osten, Stulzstraße im Süden und dem Areal des Briefverteilzentrums der Deutschen Post im Westen befindet sich
im Gewerbegebiet Grünwinkel das rund drei Hektargroße Areal der Alten Tabakfabrik (ROTAG). Das Areal
ist gekennzeichnet durch ein Konglomerat an unterschiedlichen Gebäuden, die zwischen 1910 und 1999 erbaut wurden. Der Zustand der Gebäude ist bemerkenswert „original“, was jedoch auch bedeutet, dass hier seit Jahren keine Unterhalt getätigt wurde. 1910 bis 1911 erbaute die 1838 gegründete Firma Billing & Zoller AG für Bau- und Kunsttischlerei auf dem Grundstück ihr neues Firmenareal. Für die Herstellung von Fensterrahmen, Bau- und Kunsttischlerarbeiten, Möbeln und Beschlägen wurden nach Plänen des Karlsruher Architekten Bernhard Josef Braun ein Fabrikgebäude mit markanter Sheddachhalle, die als Beitrag der architektonischen Moderne des 20. Jahrhunderts gezählt werden kann, sowie ein zweigeschossiges historisierendes Verwaltungsgebäude mit Wohnungen (Direktorenvilla) errichtet. Diese beiden Bauwerke stehen heute unter Denkmalschutz. Durch den Ersten Weltkrieg verzeichnete Billing & Zoller große wirtschaftliche Einbußen, Aufträge mussten zurückgestellt werden und die Bauindustrie ging weitgehend zurück. Ab 1933 wurde das Areal durch die Rohtabakvergärungs- A.G. (ROTAG) zur Einlagerung und weiteren Verarbeitung von Rohtabak genutzt. Nach verschiedenen Firmenübernahmen und Fusionen ist ROTAG des Areals erweiterte ROTAG den Gebäudebestand im Laufe der Jahre um diverse Produktions- und Lagergebäude. Das auffälligste Bauwerk davon ist eine 80 Meter lange, sechsstöckige Fermentierungshalle, die
1960 fertiggestellt wurde und den Abschluss des Areals nach Südwesten bildet. Entworfen vom Architekturbüro
Backhaus und Brosinsky, zählte die Halle damals zu den größten Bauwerken dieser Art in Karlsruhe. Nach
Südosten wurde 1999 noch eine Leichtbauhalle an das Fabrikgebäude angebaut. Die Produktion in Grünwinkel wurde 2018 eingestellt und konnte Mitte 2019 von der städtische Tochtergesellschaft Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG erworben werden.
Der kleinstmögliche Eingriff
Unter dem Aspekt des kleinstmöglichen Eingriffs
soll der öffentliche Raum sukzessive aufgewertet und
die Belebung des Gewerbegebiets unter Beachtung der
Anforderung der geplanten Nutzungen vorangetrieben
und, wo möglich, nachverdichtet werden. Mit einer
verkehrlichen Neuordnung und dadruch mögliche
Flächenentsiegelung können ökologische Korridore
und Durchgrünung des Gebiets erreicht werden. Eine
besondere Bedeutung kommt der Aufwertung des
Westbahnhof- Areals und der Schaffung einer neuen
Quartiersmitte zu.
Die neuen Orte sind unter den Gesichtspunkten der
Kohabitation, des Wassermanagements, der Energie-
gewinnung und der Anpassung des Klimas entstehen.
Die Sanierungsziele sind als Grundlage der Entwurfs-
arbeit zu betrachten und kontinuierlich zu überprüfen.
Es sollen Projekte entstehen, welche umsetzbar und
realisierbar sein können.
Lehrteam SuE
Prof. Dr. Martina Baum
Vertr. Prof. Markus Vogl
Julia Berger
Nicole Ottmann
Lehrteam IBK
Prof. Jens Ludloff
Patrick Sander
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Wohnkomplex Zukunft
Entwürfe
Die Stadt Schwedt im Nordosten Brandenburgs, erlangte durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine europaweit große Aufmerksamkeit. Seit 1963 versorgt die Erdölpipeline Druschba (dt.: Freundschaft) die Raffinerie des PCK (Petrolchemischen Kombinats) mit Erdöl aus Russland. Eine großangelegte städtebauliche Entwicklung zu Zeiten der DDR ließ die Kleinstadt auf ca. 55.000 Einwohner*innen anwachsen. Nach der Wiedervereinigung konnte das PCK als eines der wenigen ostdeutschen Unternehmen bis heute erfolgreich weiterwachsen. Die Zahl der Beschäftigten sank jedoch rapide, weshalb die Stadt Schwedt die Hälfte ihrer Einwohner*innen in den 1990er Jahren verlor. In der Folge wurden die städtebaulichen Typologien der DDR schrittweise zurückgebaut und einige ehemalige Wohngebiete in Waldflächen umgewidmet. Heute steht Schwedt erneut vor großen Herausforderungen. Der Weiterbetrieb der Raffinerie mit kasachischem Öl ist vorerst gesichert. Langfristig soll das PCK in Schwedt grünen Wasserstoff mit Wind- und Solarstrom aus der Uckermark und klimaneutrale Kraftstoffe für den Flugverkehr produzieren. Für diese Transformation werden in Schwedt schätzungsweise 2000-3000 neue Jobs im Kontext des PCK entstehen. Während im Umland von Schwedt die Bevölkerung schrumpft wird Schwedt in Zukunft womöglich wieder wachsen.
In Zweiergruppen entwerfen Sie einen Wohnkomplex der Zukunft für Schwedt im Kontext der anstehenden ökologischen und ökonomischen Transformationen des PCK. Über das Medium des Modellbaus verschaffen Sie sich zu Beginn ein genaues räumliches Verständnis über die vorgefundene Situation. Präzise Beschreibungen durch Text werden Ihnen helfen, eine Problemstellung zu formulieren. Das Lehrteam unterstützt Sie bei der Themenfindung und vermittelt Entwurfsstrategien, die Ihnen helfen, Ihre Ideen umzusetzen. Ziel des Studios ist das Erarbeiten eines konkreten räumlichen Entwurfs, in welchem städtebauliche, architektonische, freiräumliche und gesellschaftliche Themen integriert verstanden und geplant werden. Sie haben die Möglichkeit, Lehrinhalte aus dem Grundstudium weiter zu vertiefen und darüber hinaus wichtige Kenntnisse über architektonische und städtebauliche Theorie, konzeptionelle Entwurfsmethoden und Darstellungstechniken zu erlangen.
Lehrteam
Vertr.-Prof. Dipl.-Ing. Markus Vogl
Anna Ludwig
Phillip Deilmann
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Urban Code Brussels
Entwürfe
Komplexe Blöcke und politische Agendas
Im Sommersemester werden wir uns mit der städtebaulichen Typologie des Blocks im Kontext der Region Brüssel auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, inwiefern sich der Block als Baustein eignet, um den aktuellen globalen Herausforderungen zu begegnen. Durch die Analyse von bestehenden internationalen Beispielen und die Auseinandersetzung mit einem spezifischen Block in Brüssel sollen Qualität und Aktualität des Typus diskutiert werden. Wir nutzen die Methode des erforschenden Entwerfens an der Schnittstelle von Stadtplanung und Architektur im Städtebau. Das heutige Stadtbild des Zentrums der europäischen Union ist geprägt von Heterogenität und komplexem Aufeinandertreffen und Überlagern von unterschiedlichsten räumlichen Strukturen und Anforderungen. Zu dieser ästhetischen Verschiedenheit trägt ebenfalls bei, dass sich die Region Brüssel aus 19 recht autonom agierenden Gemeinden zusammensetzt. Parzellierte gründerzeitliche Blockstrukturen aber auch globalisierte Typologien der Nachkriegsmoderne und Hochhausstrukturen prägen die Morphologie der Stadt und schreiben den heutigen urbanen Code Brüssels. Mechanismen, die diese räumlichen Entwicklungen stark beeinflusst haben, sollen erkannt, verstanden und weiterentwickelt werden. Das Phänomen der „Brüsselisierung“ beispielsweise veränderte durch eine Liberalisierung des Planungsrechts zugunsten privatwirtschaftlicher Akteur*innen den urbanen Code der Blöcke und damit der Stadt maßgeblich. In Zweiergruppen entwickeln Sie einen Block der Großstadt Brüssel vor dem Hintergrund aktueller architekturtheoretischer Überlegungen weiter. Um die unterschiedlichen Ebenen des Codes der Blöcke zu entziffern, werden verschiedene interdisziplinäre Themen über Inputvorträge vermittelt und gemeinsam diskutiert. Über das Medium des Modellbaus verschaffen Sie sich ein genaues räumliches Verständnis über die vorgefundene Situation. Präzise Beschreibungen durch Text werden Ihnen helfen, eine Problemstellung zu formulieren. Ziel ist die Erarbeitung eines städtebaulichen Entwurfs zum Umgang mit Ihrem Block. Das Lehrteam unterstützt Sie bei der Themenfindung und vermittelt Entwurfsstrategien, die Ihnen helfen, Ihre Ideen umzusetzen. Sie haben die Möglichkeit, Lehrinhalte aus dem Grundstudium weiter zu vertiefen und darüber hinaus wichtige Kenntnisse über architektonische und städtebauliche Theorie, Entwurf und Darstellung zu erlangen.
Impressionen Exkursion
Arbeiten der Studierenden
Sarah Hettrich und Hannah Switala
Ausgehend von unserer Analyse verstehen wir das Gebiet als ein komplexes Gefüge, bei dem man die Auswirkungen eines großen Eingriffs nur schwer absehen kann. Deshalb haben wir uns gegen eine großflächige Umstrukturierung und für punktuelle Maßnahmen entschieden. Um diesem gerecht zu werden, sehen wir eine prozesshafte Vorgehensweise als notwendig an. Diese soll es ermöglichen, möglichst viele Bewohner abzuholen, die Räume in ihrem Interesse zu gestalten und langfristig eine soziale Nachhaltigkeit zu erreichen. Durch eine vorangegangene Ortsanalyse haben wir Handlungsbedarf vor allem an drei Orten in unserem Gebiet gesehen. Zum einem die im Gebiet gelegene Metro-Station, den Bereich vor und hinter den beiden Zeilen, sowie den Zirkus. Der Prozess wird über die einzelnen Orte hinweg durch einen Bauwagen begleitet, der als Ausgangspunkt für unterschiedliche Maßnahmen dient. Kuratiert wird dieser durch die Planer*innen in Zusammenarbeit mit einer lokalen sozialen Einrichtung. Das Vorgehen im Prozess folgt immer demselben Prinzip. Zunächst wird die Erschließung ermöglicht, anschließend folgt die Strukturierung des Freiraums und zuletzt folgt eine Setzung.
Alice Bussei und Rodrigo Moctezuma
Die Intervention auf der Rue de la Loi möchte mit einem kleinen Eingriff die Gestaltung der Allee radikal verändern. Das Projekt erstreckt sich über 1322 m auf Rue de la Loi vom Parc du Cinquantenaire bis zur Rue de la Toisson d’Or. Unter der Straße verläuft eine in den sechziger Jahren angelegte zweistöckige Tiefgarage, deren Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird. Durch die Verlegung des Verkehrs auf die obere der beiden unterirdischen Ebenen entsteht die Möglichkeit, die wiedergewonnene Fläche der Straße für verschiedene Aktivitäten zu nutzen. Das Ziel ist es, diese Hauptstraße in Brüssel für alle zugänglich zu machen, nicht nur für die umliegenden gewerblichen und institutionellen Nutzungen, sondern auch für die Bewohner des nahe gelegenen Wohngebiets. Die geplante städtebauliche Intervention auf Rue de la Loi in Brüssel verspricht eine radikale Veränderung und eine lebendige Neugestaltung des Viertels. Durch die Umwandlung der vierspurigen Straße in eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Zone sowie die Schaffung von Grünflächen, Arbeitsbereichen und öffentlichen Plätzen wird die Allee zu einem attraktiven und nachhaltigen Raum für Bewohner und Besucher.
Wiebke Stadtlander und Lisa Steinmayer
Der Entwurf zeichnet sich durch einen behutsamen Umgang mit dem Bestand und den Einsatz kleiner, präziser Eingriffe auf allen Maßstabsebenen aus, die eine möglichst hohe Diversität im Block ermöglichen. Das Arbeiten mit flexiblen Grundrissen, die sich den wechselnden Bedürfnissen einer sich wandelnden Gesellschaft anpassen, die Wohnraumerweiterung durch vorgesetzte Balkone und die neue Transparenz der Erdgeschosszone erhöht die Lebensqualität im Block. Die drei Höfe, die im Freiraum entstehen, stärken darüber hinaus die Identifikation der Bewohner:innen mit dem Quartier. Der grüne Hof lädt die umliegende Nachbarschaft zum Verweilen ein, während der neue Gewerbehof einen Weg ermöglicht, die hohe Arbeitslosigkeit zu reduzieren und das für Brüssel typische Handwerk und Kleingewerbe im Block zu manifestieren. Der von der Kita bespielte Hof fungiert als Scharnier zwischen dem gründerzeitlichen Quartier und den sozial geförderten Wohnungsbauten. Er verzahnt die Quartiere, kreiert einen Ort der Begegnung und bringt Bewohner*innen und Besucher*innen zusammen.
Ha-Nhi Trinh und Tamara Wagemann
Ein wichtiges Ziel für uns ist es, einen verbindenden Schulcampus zu schaffen, an dem die Bewohner*innen des Viertels, die Schüler*innen und Eltern aller umliegenden Schulen miteinander in Kontakt treten können. Um dies zu ermöglichen, wird eines der fünf Häuser entfernt. An dieser Stelle entsteht eine große Plattform in Verbindung mit Walkways zu den restlichen vier Häusern. Wir haben uns auch mit den Bestandsgebäuden auseinandergesetzt. Zwischen den privaten Wohnräumen soll Platz für gemeinschaftliche Flächen entstehen und geschossübergreifende Community Spaces generiert werden, in denen Gemeinschaft und soziale Interaktion gefördert wird. In den zwei unteren Geschossen der Bestandsbauten, stellen wir uns verschiedene öffentliche Nutzungen vor, die temporär umgenutzt werden können, für Workshops, Bars oder Kunstgalerien.
Simon Volk und Yuewen Ding
Our approach is to change as little as possible but as much as necessary and to provide the residents with opportunities for their everyday life as well as the creation of a resilient block community, which can also consist of many small communities. With the help of these communities, it can later be possible to guide the development of the block itself. But we also want to keep the places that are so popular with the residents today – like the garden with the graffiti of the residents. We see the potential for creating the community spaces with diverse functions in unused spaces within the buildings or between the buildings or in the unused underground parking. For the creation of such places we do not want to displace people from their apartments. In order to increase the daily interaction of the residents and the exchange of experiences, we are opening up the first floor zone, so that the block, which consists of two courtyards, can also be used by the neighborhood and can be better accessed. To increase the supply of apartments for large families, we are adding a compact new building in place of the abandoned concrete skeleton. The prominent residential tower with its 5 staircases can offer a variety of large and small apartment types through small interventions.
Entwurf – Urban Code Brussels
Lehrteam
Vertr.-Prof. Markus Vogl
Ann-Kathrin Ludwig
Philipp Deilmann
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Typologien Transformieren
Entwürfe
Foto: Philipp Deilmann
Mit der Gestaltung ihrer gebauten Umwelt verfolgen Menschen das Ziel, sich eine auf sie zugeschnittene lebenswerte Umgebung zu schaffen. Zumeist zerstören wir dadurch Flora und Fauna und folglich auch unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wenn wir unser Land zukünftig gerecht, ökologisch und produktiv weiterentwickeln möchten, müssen gerade die räumlichen Disziplinen neue Ansätze diskutieren und entwerfen. Die drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung – Soziales, Umwelt, Wirtschaft – bilden den gesellschaftlichen Rahmen für dieses Entwurfsstudio.
Dabei gilt: Suffizienz muss vor Konsistenz, Konsistenz vor Effizienz stehen!
Anhand des Modellbaus näherten wir uns den spezifischen Typologien des ländlichen Raums und ihrer Situierung und haben dadurch verschiedene Gebäude-, Freiraum- und Infrastrukturtypologien in ihrer Eigenlogik verstehen gelernt um Möglichkeiten aus dem Bestehenden heraus für anstehende Transformationsprozesse aufzuzeigen. Hilfsmittel für den Entwurf, welcher sowohl den städtebaulichen als auch den architektonischen Maßstab einschloß, sind neben Zeichnungen die (Modell-) Fotografie und die Collage. Ziel war es, die Typologien neu und zukunftsweisend zu interpretieren, zu transformieren, zu hybridisieren und so Architekturen und ihre Einbettung in ihrem spezifischen Kontext zu entwerfen, welche unsere gebaute Umwelt positiv beeinflussen und Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit suchen.
Eine fünftägige Exkursion nach Ilshofen in Baden-Württemberg zeigte uns die gebaute Realität auf und war die Ausgangsbasis für unseren Entwurfsprozess. Das Entwurfsstudio war eingebettet in das Forschungsprojekt „Baukultur im Ländlichen Raum in Baden-Württemberg“, gefördert vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, welchem die Ergebnisse abschließend präsentiert werden.
Impressionen der Exkursion
Fotos: Jonas Malzahn
Bestandsmodelle
Fotos: Frank Dölling
Impressionen Rundgang
Fotos: Frank Dölling
Arbeiten der Studierenden
Tina Todorovic und Mathis Lehna
Marie Fischer und Jasmin Kast
Marc Escher und Gary Papke
Lehrteam
Vertr.-Prof. Dipl.-Ing. Markus Vogl
Richard Königsdorfer
Jonas Malzahn
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Unplanning the Planned – Madrid
Entwürfe
Madrid ist mit mehr als sieben Millionen Einwohner*innen eine der faszinierendsten Metropolregionen Europas. In den letzten hundert Jahren haben lokale Politik, Verwaltung und Planung eine breite Palette zur Lösung des Stadtwachstums und der Wohnraumfrage entwickelt, die mit unterschiedlichem Erfolg bis zum heutigen Tag die Stadt in ihrem Zusammenleben prägen. Die jüngeren Stadtentwicklungsgebiete zeigen jedoch die Grenzen der klassischen Planungsinstrumente auf und verdeutlichen, dass die ökologischen und sozialräumlichen Konflikte maßstabsübergreifend andere Zugänge einfordern, die den Eigenlogiken des Ortes, der Natur, der Kultur nachhaltig Rechnung tragen.
An unserem Entwurfsort trifft die jüngste großmaßstäbliche Stadterweiterung, die in Madrid als PAU (Proyectos de Actuación Urbanística) bezeichnet werden, auf eine lineare informelle Siedlung, die sich entlang einer traditionellen Viehroute – der ‚Cañada Real Galiana‘ – entwickelt hat. Diese Route ist Teil eines Netzes von Viehtransportwegen, die seit 1273 den Norden und den Süden der Iberischen Halbinsel miteinander verbinden. Diese Viehkorridore mit einer ursprünglichen Breite von 72 Meter wurden 1975 zum Allgemeingut erklärt, um die Flächen und ihre ursprüngliche Funktion langfristig zu sichern. An den Rändern ist es allerdings möglich, kleine provisorische Gebäude zu errichten, um den Wanderhirten Unterschlupf zu gewähren. Dieses „Baurecht“ wurde aber dahingehend ausgenutzt, dass im Einzugsbereich der Städte die Korridore dauerhaft mit Häusern bebaut wurden.
Wir arbeiten im Entwurfsstudio in einem Raum, in dem das Geplante auf das Ungeplante trifft, wo das Landwirtschaftliche und das Städtische koexistieren, wo periphere Infrastruktur sich in den Landschaftsraum einschreibt; ein Raum, der sich als Laboratorium für die Komplexität städtischer Entwicklungen präsentiert. Im Verständnis der Inter-Disziplin Städtebau und mit unseren entwerferischen maßstabsübergreifenden Werkzeugen wollen wir die formellen wie auch die informellen städtischen und landschaftlichen Logiken ergründen und der bloßen Koexistenz von Strukturen räumliche Strategien entgegenzusetzen, die eine resiliente Kohabitation von Menschen mit Flora und Fauna ermöglichen.
Der Entwurf erfolgte über das Semester hinweg in engem Austausch mit Studierenden des Entwurfsstudios von Prof. Luis Basabe und Prof. Luis Palacios der ETSAM Madrid.
Impressionen von der Exkursion
Impressionen aus dem Studio
Gäste: Luis Basabe und Luis Palacios, Christian Salewski und Simon Kretz, Paola Viganò
Arbeiten der Studierenden
Lucas Apfelbacher und Kim Bache
Villagisation
Unser Vorschlag basiert auf der Idee, eine neue, bessere und nachhaltige Art des Zusammenlebens zu schaffen. Wir sind der Meinung, dass es in der Nähe des Zentrums von Madrid bessere Orte gibt, um die versprochene Anzahl von Wohnungen zu bauen. Deshalb werden in El Cañaveral alle zukünftigen Bauvorhaben gestoppt und wir kümmern uns nur um die bestehenden Gebäude. Um diesem Teil der Stadt mehr Qualität zu verleihen, werden wir ein „Dehesa“-Ökosystem wieder einführen, das an dieser Stelle seit dem 13. Jahrhundert als Steineichenwald von Vallecas existierte. Das geplante Projekt sollte eigentlich eine Stadt werden, doch die Bebauungsdichte ist so gering, dass wir unser Projekt „Villagisation“ nennen. Durch „villagizing“ erreichen wir eine Vielzahl von Vorteilen für die Menschen, sowie Flora und Fauna. Wir identifizierten räumlichen Potenziale des Standorts und haben das bebaute Territorium in kleinere Dörfer aufgeteilt. Wir verbinden die Bewohner*innen wieder mit ihrem Territorium, indem wir gemeinschaftlich genutzte „Huertas“ anbieten, die Gemeinschaft und ökologische Sensibilisierung schaffen. Die neu geschaffene, produktive Landschaft bietet ein enormes wirtschaftliches Potenzial und eine bereichernde Lebensweise in Koexistenz mit Schafen, Hühnern und Schweinen. Dabei geht es nicht nur um den landwirtschaftlichen Aspekt, sondern auch um die Entwicklung nachhaltiger, lokal erzeugter Produkte auf natürlicher Basis. Daher schlagen wir Forschungs- und Produktionseinrichtungen vor, um vorhandenes und neu geschaffenes Wissen über die „Dehesa“ und ihre Produkte wie iberische Marmelade, Wolle und Korkprodukte zu vermitteln. Die überdimensionierten Alleen werden als Raum für Dorfkerne genutzt, in denen soziale, produktive, kommunale und marktbezogene Einrichtungen zu finden sind. Das Erdgeschoss der höheren Gebäude wird für landwirtschaftliche und kommunale Zwecke genutzt. Die Straßen werden „unplanned“. Einige von ihnen bieten Platz für die neue Gebäudeinfrastruktur, einige für die neuen Mobilitätskonzepte, andere werden für die Wassergewinnung genutzt und die meisten von ihnen werden entfernt.
Juliane Eichinger and Laura Junginger
Hidden Values
In der Umgebung der Cañada Real gibt es viele großartige Orte und Wege. Leider sind die meisten von ihnen hinter Mauern oder Zäunen versteckt. Es ist nicht viel nötig, um sie für die Öffentlichkeit zu öffnen und sie in attraktive Orte zu verwandeln, die verschiedene Möglichkeiten der Zusammenkunft bieten. Um die Cañada Real, El Cañaveral sowie die Planung von Los Cerros gleichwertig zu behandeln, sollten die Veränderungen so minimal wie möglich ausfallen. Um die Plätze zu aktivieren, müssen sie identifiziert und analysiert werden, damit die bereits vorhandenen Werte im Rahmen einer behutsamen Behandlung gestärkt werden können. Durch die Bereitstellung dieser kleineren Räume erhalten die Bewohner die Möglichkeit, sie sich anzueignen. Daher sollten die Instrumente zur Bereitstellung dieser Räume zur Verfügung gestellt werden, z. B. das Öffnen von Mauern, das Anlegen von Wegen oder die Restaurierung von Gebäuden. Dabei soll die Aneignung ein Prozess der Menschen sein, der offen für Veränderungen ist, um den Bedürfnissen der Bewohner zu entsprechen. Die Aushandlung der Nutzung, die Verbindung zu diesen Orten sowie die Interaktion in diesen Bereichen sollten die drei Parteien zusammenbringen und eine belebte Nachbarschaft mit einer aufgeschlossenen Haltung zueinander schaffen.
Um diese Ziele zu erreichen, schlagen wir eine langfristige Strategie vor, die aus drei Schritten besteht. Der erste Schritt besteht darin, die bereits vorhandenen Elemente an den Orten zu identifizieren und umzuwandeln, die für die Einleitung eines Beteiligungsprozesses erforderlich sind. Diese „Initiatoren“ sollen Interesse wecken, zeigen, was mit minimalen Eingriffen möglich ist, und Akzeptanz für den weiteren Prozess schaffen. Anschließend kann der Prozess der „Initiatoren“ auf ähnliche Orte übertragen werden, so dass sie die bereits entwickelten Situationen nachahmen. Langfristig wäre der letzte Schritt eine Ausbreitung dieser Orte auf die Straße der Cañada Real und ihre Umwandlung in Räume, die die verschiedenen Orte miteinander verbinden, um einen öffentlichen Weg zu schaffen, der die verschiedenen Bereiche in menschlichem Maßstab miteinander verbindet.
Elzbieta Kmita and Lisa Lerche
Symbiosis: Connection Through Typology
Die Verdichtung, die Nutzung unbebauter Flächen und die Erhaltung bestehender Gebäude sowie die Schaffung von Stadtvierteln mit unterschiedlichem Charakter sind die Kernaspekte des Projekts „Symbiose“. Der Begriff Typologie bezieht sich auf die Untersuchung von Typen und Klassifizierungen sowie auf die Aspekte von Gebäuden oder städtischen Standorten in Bezug auf ihre Nutzung. Die Morphologie wiederum klassifiziert die Gebäude nach ihrer Form und Gestalt. Das Ziel des Projekts ist es, einen fließenden Übergang zwischen Canada, El Canaveral und Los Cerros zu schaffen, indem verschiedene Typologien und Morphologien in verschiedenen Teilen des Viertels miteinander verbunden werden. Das Projekt führt unterschiedliche Typologien auf den verschiedenen Ebenen des Stadtgebiets, der Nachbarschaft, des Gebäudes und der einzelnen Einheit ein. Durch das „Unplanning“ der geplanten Entwicklung des Geländes wir ein neues Erscheinungsbild und eine neue Atmosphäre des Ortes geschaffen. Entsprechend der form- und nutzungsbasierten Klassifizierung sowie der differenzierten Dichte wird das Viertel in fünf Bereiche mit jeweils eigenen Merkmalen und Funktionen gegliedert. Die Gebiete sind nach Qualitäten wie Gebäudehöhe und -breite, Hofgrößen, Abstände der Gebäude zueinander und zur Straße, Landschaftsmerkmale, Straßennetz, öffentlicher Raum usw. gruppiert.
Annabelle Schneider and Lisanne Triebold
Fusionar Lo Existente
Die moderne Art, Städtebau zu betreiben, respektiert oft nicht den Kontext des Ortes und folgt nur der Zweckmäßigkeit und Einfachheit einer Rasterstadt. Genau das ist in El Cañaveral der Fall, das an den seit langem bestehenden Viehtriebweg und heutige informelle Siedlung Cañada Real angeschlossen ist. Auf der anderen Seite der informellen Siedlung ist ein vergleichbares Gebiet namens Los Cerros geplant. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wollen wir mit unserem Projekt den modernen Städtebau kritisieren. Um einen Austausch zwischen den Bewohnern der Cañada Real und el Cañaveral zu schaffen, wollen wir das Geplante von Los Cerros „entplanen“ („unplan“). Deshalb war es uns wichtig, uns auf die organischen, bestehenden Strukturen zu konzentrieren, anstatt auf das strenge Raster von el Cañaveral und los Cerros. Da die vorhandenen Wege von den Menschen angelegt wurden und diese für die Topographie und die Nutzung die sinnvollsten Routen gehen, haben wir beschlossen, diese Wege als Grundstruktur beizubehalten. Der natürlichste Teil des bebauten Gebiets ist die Cañada Real. Daher haben wir beschlossen, ihre Struktur als Grundlage für die neue städtebauliche Struktur zu nehmen. Die so entstandenen Blöcke schaffen die Voraussetzungen für das Wachstum einer Gemeinschaft. Die inneren Teile sind Freiräume, die je nach Bewertungskriterien unterschiedlich genutzt werden. Außerdem werden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass alle Bewohner*innen des Gebietes das gleiche Recht auf Freiraum haben und dieses Recht auch wahrnehmen können.
Lehrteam
Vertr. Prof. Markus Vogl
Alba Balmaseda Dominguéz
Harry Leuter
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Habitando Cosechas
Entwürfe
Temporäre Humansiedlungen in Huelva, Spanien.
Habitando ist ein spanisches Wort, das vom lateinischen Verb ‘habitare’ häufigste Form von habere ‚haben, halten, besitzen‘ abstammt. Doch, habitando kann auf sehr unterschiedliche Weise verstanden werden: dwelling, wohnen, living, leben, inhabiting, bewohnen, appropriating, feeling, bauen, usw. Darüber nachzudenken, was dieser Begriff bedeutet und unsere eigene Definition an einem konkreten Ort dafür zu finden, wird ein grundlegender Teil dieses Entwurfsstudios sein.
Cosechas sind die Früchte und das Gemüse, die man anbaut und erntet. Cosecha wird sowohl für den Prozess der Landbewirtschaftung als auch für das, was man als Ergebnis erhält, verwendet. Sich bewusst zu machen, was die Ernte für unser Ökosystem, unsere Wirtschaft und unsere soziale Struktur bedeutet, ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
Der Standort des Studios befindet sich in der Nähe der Gemeinde Lepe in Huelva, im Süden Spaniens. In den letzten Jahren sind in diesem Gebiet parallel zum exponentiellen Wachstum der Monokultur temporäre Humansiedlungen entstanden, weil die Arbeiter*innen saisonal zur Ernte kommen. Der Höhepunkt des Zuzugs liegt zwischen Januar und Mai, zeitgleich mit der Beerenernte. Beeren erfordern eine große Anzahl von Arbeiter*innen, da die Früchte von Hand gepflückt werden müssen und sehr empfindlich sind.
Infolge des intensiven Zustroms von Menschen sind in diesem Gebiet verschiedene informelle und formelle Lösungen für die Unterbringung von Saisonarbeiter*innen entstanden. Deshalb gibt es verschiedene nicht geplante und geplante Siedlungen. Diese Unterkünfte und Siedlungen unterziehen wir einer intensiven Untersuchung als Basis für neue Entwurfsansätze in Städtebau und Architektur.
Das Ziel des Studios war es, gemeinsam einen Vorschlag für eine temporäre Siedlung auf einem definierten Grundstück zu entwerfen. Es sollte ein realistisches, standortspezifisches und robustes Projekt entstehen, in dem die verschiedenen Realitäten nebeneinander bestehen und das Know-how und die vor Ort entdeckten Möglichkeiten umgesetzt werden konnten.
Besonderer Dank gilt den ‘habitantes‘ Fatima, Salim, Osman, Ana und Youssef; dem Stadtrat von Lepe; dem multikulturellen Verein von Mazagon und ASNUCI; den Unternehmen Lepeplas, Polisur und Flor de Doñana; dem Technologiezentrum der Agrarindustrie ADESVA und der Stiftung United Way Spanien für die finanzielle Unterstützung.
Foto: Alba Balmaseda Dominguez
Kontext
Grundstück
Impressionen aus dem Studio
Skizzen
Arbeiten der Studierenden
Der intensive Anbau von Beeren und insbesondere von Erdbeeren in der südspanischen Region Huelva ist ein eindrucksvolles Beispiel für das globale System der Massenproduktion, das auf der Ausbeutung von Arbeitnehmenden und Umwelt beruht. Der fehlende Schutz der Rechte von Wanderarbeitenden führt zu einer alarmierenden sozialen Situation der Saisonarbeitenden, die nicht nur mit der Dürre und der Umweltverschmutzung zu kämpfen haben, unter denen die Region ohnehin leidet, sondern auch in selbstgebauten Lagern aus Abfällen verharren müssen.
Dieses Phänomen findet seinen räumlichen Ausdruck in Form des Chabolismo, der als Reaktion auf dieses nachteilige politische und wirtschaftliche System betrachtet werden kann. Auch wenn es bemerkenswert intelligente architektonische Lösungen und urbane Strukturen gibt, ist die Wohnsituation dennoch prekär. Das Projekt zielt darauf ab, ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Analyse dieser komplexen Siedlungen und
der Versuch, ihre Systeme zu abstrahieren, bildeten die Grundlage unseres Entwurfsprozesses, während wir gleichzeitig unsere eigene Haltung als Planende ständig hinterfragten.
Für Saisonarbeiter*innen und Migranten*innen, die keinen festen physischen Lebensraum haben, ist der Begriff Heimat eher ein relationales als ein räumliches Phänomen. Daher steht die Stärkung der Vernetzung und Gemeinschaftsbildung unserer Habitantes im Mittelpunkt unseres Entwurfs. Indem wir Architektur nicht als Produkt, sondern als einen Prozess mit offenem Ausgang betrachten, schafft das Projekt Raum für das Ungeplante. Ein wichtiges Ziel ist daher die Integration potenzieller Wachstums- und Umbauprozesse unter Beibehaltung wichtiger räumlicher Qualitäten wie Innenhöfe, Gemeinschaftsräume und Zugänglichkeit.
Unter Berücksichtigung des architektonischen Diskurses über strukturalistische Ansätze entwickelte das Projekt eine eigene Perspektive auf diese Bewegung, die sich auf die Beziehung zwischen Menschen und einer Struktur konzentriert, die Ausdruck sozialer und funktionaler Zusammenhänge ist. Dieser ganzheitliche und transskalare Ansatz betrachtet sowohl die einzelnen Elemente als auch den gesamten Organismus. Der Fokus liegt nicht nur auf den Komponenten selbst, sondern auf deren Beziehung zueinander, die auch dann erhalten bleibt, wenn diese ausgetauscht werden.
In der Tradition von Denkern wie Herman Hertzberger haben wir eine spezifische Architektur entworfen, die eher ein Möglichkeitsraum ist, der mit Inhalt, Werten und Bedeutung gefüllt werden kann, als eine endgültige Form. Angesichts dieser robusten Struktur mit langer Lebensdauer kann sie mit den sich ständig verändernden Lebenszyklen der Habitantes belebt werden. All dies geschieht in einem dialektischen Prozess zwischen der Struktur und den Habitantes, zwischen Konstantem und Variablem. Die Architektur bietet den Nutzenden konkrete räumliche Optionen und Inputs und fördert so einen Prozess der Aneignung, anstatt nur flexible Räume zu implizieren, die möglicherweise nie einer bestimmten Nutzung dienen. Gleichzeitig schaffen diese Qualitäten eine Vielfalt an polyvalenten Räumen, die lebendig werden können. Durch die sorgfältige Platzierung der Struktur auf dem Gelände in Übereinstimmung mit der Topografie, den klimatischen Bedingungen und den lokalen Ressourcen fördert diese das Zusammenleben zwischen Menschen, Flora und Fauna. Die Architektur mit ihrem geringen Platzbedarf sowie die Materialwahl, die das Denken in Lebenszyklen einbezieht, tragen dazu bei. So werden auch die lokalen Arbeitskräfte berücksichtigt und den Bewohnern die Möglichkeit gegeben, sich am Bauprozess zu beteiligen.
Durch das Upcycling von anfallenden Kunststoffabfällen besteht die Möglichkeit, die lokale Landwirtschaft mit den Bauprozessen zu verbinden und diesem Material eine neue Wertigkeit zu geben. Gleichzeitig garantiert der modulare Grundriss das Minimum für alle Habitantes: Sicherheit, ein Bett und Stauraum. Darüber hinaus haben alle Zugang zu Gemeinschaftsräumen und die Möglichkeit, den Raum zu erweitern, anzupassen und umzugestalten.
Giuliana Fronte, Luis Frisch, Leo Ritter, Kim Bache, Isabella Patricolo
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Alba Balmaseda Dominguez
Harry Leuter
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Land denken
Entwürfe
Zur Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums in Baden-Württemberg
In diesem Semester haben wir einen künstlerischen Blick auf den ländlichen Raum geworfen. Wir haben uns bezogen auf Baden-Württemberg einen Überblick über die Charakteristika des Ländlichen verschafft und im konzeptionellen Entwurf Antworten auf die Frage gesucht: Wie kann man das Land in die Zukunft denken?
Wir haben uns damit beschäftigt, welche Wirkungen menschengemachte Handlungen haben, die das Herstellen unserer gebauten Umwelt betreffen und somit unsere Lebensweise und unser Verhalten – unsere Kultur – prägen. Die Bedeutung des Begriffs „Baukultur“ wurde in diesem Zusammenhang intensiv diskutiert und neue Ausrichtungen wurden verfolgt. Vorschläge aus unterschiedlichen Richtungen, welche ein radikales Umdenken des Bausektors fordern, betonen oftmals „die transformative Kraft der Städte“. Doch wie ist es um die transformative Kraft der ländlichen Räume bestellt?
Im Studio haben wir uns damit beschäftigt, welche Strukturen diese Räume in Baden-Württemberg prägen und wie es um deren Zukunftsfähigkeit steht. Nach einer breit gefächerten Auseinandersetzung mit Themen wie Baustilen und Gebäudetypen, Infrastrukturen, Landschaften, Ressourcen und Materialitäten bis hin zu dem Klischee der unberührten Idylle fokussierte sich die entwurfliche Beschäftigung auf die Auswirkungen räumlicher Manifestation unserer Kultur des Bauens im ländlichen Raum.
Die Studierenden entwickelten in Zweierteams eigene Positionen zum Thema und wählten eigenständig den Fokus ihres Projekts. Um jeweils den Inhalt unterstützende Präsentations- und Inszenierungsweisen für die Arbeiten zu finden, wurde dazu ermutigt, mit Medien abseits des klassischen architektonischen Plans zu experimentieren. Nicht allein das Erstellen des Endprodukts stand im Vordergrund, sondern auch Szenografie und Präsentationsweise des Projektes wurden integral mitgedacht und geplant.
Weitere Informationen
Der Entwurf fand in engem Austausch mit dem Forschungsprojekt „Baukultur im ländlichen Raum in Baden-Württemberg“, beauftragt vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, statt und bildete den Auftakt einer Reihe von drei Entwürfen.
Studio Impressionen
Fotos: Frank Dölling
Studierdenen Projekt: Pfaff, Kiesel
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Ann-Kathrin Ludwig
Harry Leuter
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
New York
Entwürfe
New York – Parallelwelten
Aufbauend auf das Seminar „Parallelwelten – New York in Film und Literatur“ haben wir uns im Entwurfs-Studio der Stadt New York entwurflich weiter genähert. Im Entwurf arbeiteten die Studierenden an der Schnittstelle zwischen sehr widersprüchlichen Orten, die von den Studierenden selbständig gefunden wurden. Diese Parallelwelten stellten den Ausgangspunkt der jeweiligen Eingriffe dar. So sind Projekte im Zwischenbereich zwischen Architektur und Städtebau entstanden. Es wurde maßstabsübergreifend, mit Fokus auf die selbst definierten Themen gearbeitet und Konzepte entwickelt, die die vorhandenen speziellen Eigenschaften der Räume und Atmosphären herausarbeiteten und weiterentwickelten.
Durch die Unmöglichkeit zu reisen in Zeiten der Pandemie lernten wir im Seminar die Stadt über Film und Fernsehen, Romane und Fachliteratur kennengelernt, sind ihr über Google Streetview, Plakaten, Fotos, Videos, Zitaten und Textpassagen kennen.
Wir sind also auf eine Reise nach New York gegangen, ohne in das Flugzeug zu steigen. Von Harlem über die Upper West Side, durch den Central Park hinüber zur Upper East Side und wieder zurück zum Columbus Circle, weiter in den Theater District und hinunter zur Lower East Side.
Gäste:
Sharon Zukin, City University of New York
David Grahame Shane, Columbia University
Tobias Armborst, Interboro
Ute Meyer, Hochschule Biberach
Impressionen aus dem Studio
Arbeiten der Studierenden
Andrea Irion und Thomas Lesch
Amsterdam Depot
West Harlem
An der Schnittstelle zwischen der Upper West Side und Harlem wurde das Amsterdam Depot als Entwurfsort identifiziert. Das 1882 für die Lagerung von Straßenbahnen erbaute Depot nimmt einen ganzen Block ein. 1947 wurde das Straßenbahndepot stillgelegt und durch ein Busdepot ersetzt. Dafür wurde das Gebäude erweitert. 2010 wurde das Busdepot stillgelegt und wird seither als Werkstatt- und Lagergebäude für die Oldtimer Busse der MTA genutzt. Diese Nutzung füllt nur einen Bruchteil des vorhandenen Platzes, weshalb das das Depot der perfekte Ort für eine Nutzungserweiterung ist.
Antagonist
Um die Bewohnerschaft Harlems einzubeziehen hat die Columbia University „The Forum“ entwickelt. Dieses Forum soll für alle zugänglich sein und dem Viertel etwas zurückgeben, wird dieser Zweck allerding nicht gerecht. Es hat nur zu den offiziellen Öffnungszeiten der Uni offen und bietet außer einem großen Foyer nur anmietbare Veranstaltungsräume zu hohen Preisen. Wir planen, diesem Forum ein Gegenüber und somit Harlem ein Gesicht zu geben. Das Depotgebäude wird zu einem offenen, gemeinschaftsorientierten Kultur und Freizeitgebäude umgebaut, welches öffentlichen Raum neu definiert.
Entwicklungsdruck
Die unmittelbare Umgebung des Busdepots ist bereits einem starken Wandel aufgrund von Entwicklungsdruck und damit verbundenen Neubauten ausgesetzt. Die gewohnte Umgebung verschwindet Stück für Stück und muss großen meist generischen Gebäuden weichen. Deshalb setzt der Flachbau des Amsterdam Depot eine klares Zeichen und symbolisiert das bauliche Erbe West Harlems.
Sichtbarwerden
Die derzeit im Busdepot gelagerten Oldtimer Busse können vom Depot als Aushängeschilder in der Umgebung genutzt werden. Sie können beispielsweise als Wärmebusse, Impfbusse, Foodtrucks oder Konzertbusse an verschiedenen Orten in Harlem stehen und der ansässigen Bevölkerung Kultur- und Hilfsangebote näher bringen und auf das Depot aufmerksam machen.
Nutzungsaddition und -verteilung
Durch die Nutzungsverschiebung von bestimmten Freizeiteinrichtungen auf das Dach des Depots werden dort mehrere Nutzungen überlagert, wodurch das Depot dem Entwicklungsdruck trotzen kann. Außerdem werden Flächen frei, welche der Öffentlichkeit zugeführt werden können. Der Großteil des Gebäudes ist auf schnelle und flexible Nutzungsänderungen ausgelegt. Es lebt durch die Bespielenden und passt sich an sie an. Somit können sich im Laufe des Tages verschiedene Nutzungen aneinanderreihen und überlagern. Durch diese Nutzungsüberlagerungen kann die Fläche optimal genutzt und verschiedensten Bedürfnissen gerecht werden.
Porosität
Das untergenutzte Bestandsgebäude hat aufgrund seiner früheren Nutzung viele großflächig öffenbare Tore. In Kombination mit flexibel nutzbaren Räumen können große Teile des Gebäudes in Zukunft dem öffentlichen Raum zugeschrieben werden. Das Gebäude gewinnt an Porosität und Flexibilität.
Viktor Metz und Timo Wendschuh
Parallelwelten
Die Stadt New York ist für viele der Inbegriff einer Weltstadt. Als solche besitzt sie eine Vielzahl von nebeneinander existierenden, sich gegenüberstehenden und gegenseitig beeinflussenden Welten. Diese Parallelwelten können städtebaulicher, architektonischer, sozialer und sogar kultureller Natur sein. Ein Ort, an welchem sich Parallelwelten räumlicher Natur auftun, ist das im Süden Manhattans gelegene Quartier „Two Bridges“. Das ursprüngliche Quartier, ein gewachsenes Einwandererviertel, wurde und wird in Teilen durch gesellschaftliche Prozesse und Baustrukturen anderer städtebaulicher Leitbilder räumlich überformt. Diese durch die Überformung entstandene Heterogenität der Räume gepaart mit der Nähe zu Downtown Manhattan sind grundlegend für die städtebaulich und architektonisch interessante Atmosphäre des Quartiers. Eine weitere Folge der Überformungen sind zudem kulturelle und soziale Wechselwirkungen, die sich in den unterschiedlichen Altersstrukturen und kulturellen Hintergründen der Bewohner:innen von Two Bridges ausdrücken. Unsere Beschäftigung erfolgt nicht nur auf Grund der städtebaulich-architektonischen Parallelwelten, sondern auch, da es momentan im Fokus teils großmaßstäblicher Umgestaltungen und Entwicklungen steht.
Konzept
Der Ansatz unseres Entwurfs entstand aus der strategischen Überlegung, wie man „Two Bridges“ als ein Ganzes sehen kann. Hierbei verstehen wir die räumlichen Gegebenheiten, bestehend auf der einen Seite aus dem historischen und dicht bebauten „Tenement“ und auf der anderen Seite aus dem sozialen Wohnungsbau der „Al-Smith Houses“, als eigenständige Entitäten. Indem wir die vorhandenen Stärken und Schwächen getrennt voneinander herausarbeiten, versuchen wir in einem ersten Schritt, die jeweiligen Entitäten in sich zu stärken. Als nächsten Schritt betten wir diese in ein übergeordnetes Konzept ein, welches sowohl auf der Quartiersebene als auch darüber hinaus die Entitäten in den Flickenteppich von New York einbettet. Abschließend definieren wir an der Grenze zwischen den Entitäten eine neue Zone, welche wir als Schnittstelle zwischen den Beiden transformieren.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Lorenz Brugger
Harry Leuter
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Robust
Entwürfe
Robust. Lebensräume weiterdenken.
Wie sieht der Lebensraum der Zukunft aus? Wie können wir die gebaute Umwelt (radikal) weiterdenken, um resiliente Zukunftsvisionen für die Anpassung an den Klimawandel zu entwerfen? Was lässt sich planen, was bleibt ungeplant?
Robust, von robur (Hartholz, Eichenholz) abgeleitet, bedeutet für uns eine Umgebung – sei es ein Bauwerk oder eine städtebauliche Struktur – die mit einem Baum vergleichbar ist: tief in den Standort und Kontext verwurzelt, durch lokale Ressourcen genährt, langsam wachsend, stark im Stamm und flexibel in den Zweigen, resilient und damit fähig sich an verschiedene Situationen anzupassen. Robuste Gebäude sind immer ein Teil vom größeren Ökosystem und somit am Ende ihrer Lebensdauer recyclebar und fähig etwas an den Kreislauf zurückzugeben.
In unserem Studio erforschten die Studierenden im Kontext Schwarzwald, was der Begriff „Robust“ beinhaltet und beschäftigen sich mit regionaler Baukultur,
Kreislaufwirtschaft, Naturräumen im Klimawandel sowie Kohabitation von Mensch, Flora und Fauna. Es sollen Visionen für ein sozialgerechtes und klimaneutrales Planen und Bauen entstehen.
Unser Entwurfsort war Herrenschwand diesem hat es in den letzten Jahren Anstrengungen gegeben, sich durch das Angebot hochwertiger Kur- und Wellnessangebote auf die Zukunft einzurichten. Die Dorfgemeinschaft wirbt für sich als „eines der letzten typischen, malerischen Schwarzwalddörfer“. Der Ausgangspunkt unserer Entwurfsarbeit war der im Ort bestehende Schlepplift und die dazugehörige Skihütte an einem etwa 850 m langen Skihang sein.
Während des Semesters hatten wir Xu Tiantian (DnA Design and Architecture), Prof. Nadja Häupl (Fachbereich 3 – Architektur, Facility Management and Geoinformation, Hochschule Anhalt), Prof. Dr. rer. nat. Leonie Fischer (Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart), als Gäste begrüßen zu dürfen.
Besonderer Dank gilt dem Biosphärengebiets Schwarzwald, derWaldfrieden naturparkotel, Lignotrend und Wildling Blumen.
Entwurfsorte
Impressionen aus dem digital-analogen Studio
Arbeiten der Studierenden
Giuliana Fronte und Manuel Riedlinger
NATURECULTURE
Der Begriff geht auf die Philosophin und Autorin Donna J. Haraway zurück. und beschreibt den Menschen als jemanden der die Welt nicht beherrscht, sondern die er mit anderen Lebewesen in wechselseitiger Abhängigkeit bewohnt.
Deutschlands Wälder sterben! Besonders augenscheinlich wird ihr, durch die Klimakatstrophe bedingtes Ableben bereits seit Jahrzehnten in den Wäldern Bayerns oder im Harz. Doch auch in Teilen des Schwarzwalds sind die Auswirkungen von Trockenheit, steigender Temperaturen und Schädlingsbefall immer häufiger zu beobachten. Der radikal vom Menschen veränderten Kulturlandschaft dieser Region droht ein massives Absterben ihrer Fichtenmonokulturen. Das Fichtensterben, die damit einhergehende Ausdünnung von Waldstücken sowie die Verschiebung von Waldkanten werden aus planerischer Perspektive neue räumliche Situationen schaffen. Diese Veränderung birgt dadurch sowohl aus ökologischer, als auch aus gestalterischer Sicht ein enormes Potenzial. Der Entwurf setzt sich ausgehend von der Dystopie des Waldsterbens mit diesen Veränderungen auseinander und entwickelt eine Vision für Herrenschwand. Kanten werden neu definiert, Blickbeziehungen gestärkt und die vorgefundenen, unterschiedlichen Räume und ihre Verbindungselemente aktiviert.
Es wird ein Rahmenwerk aus polyvalenten Räumen und Verbindungselementen geschaffen. Zudem wird die Chance genutzt dem Skilift im Ort eine langfristige Perspektive zu geben, indem er zum verbindenen Element zwischen dem Vorderdorf und einem neuen Dorfteil am Südhang des Hochgescheidts wird.
Das Projekt gliedert sich somit in unterschiedliche zeitliche Abschnitte mit unterschiedlich starken Interventionen, die zum einen die Zusammensetzung der Landschaft aus verschiedenen Flächentypen und deren räumliche Verteilung betreffen, aber auch die Umwandlung der Waldes in einen resilienten Mischwald. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den artenreichen Übergangs- bzw. Sukzessionszonen zwischen den Flächen für Siedlung, Offenland und Wald.
Isabella Patricolo, Lisa Reichenecker und Simona Schnizer
BE GREEN GO FARM!
BE GREEN GO FARM! is an interscalar project that responds to current local problems in the village of Herrenscwand in the southern Black Forest with solutions rooted in the past. By reintroducing the activity of agriculture and animal husbandry, the face of the village could change offering a resilient and sustainable scenario. We used past practices and present conditions as guidelines to define areas for the different forms of farming. The animals are kept together on pasture and only spend the winter months in the stable. Depending on the feed growth the size of the pastures and paddocks has to change, but it needs to be said that these animals not only serve the purpose of maintaining the open landscape and sustaining the local meat demand. In fact, the organic recycling of dung as manure for cultivation increases the nutritional characteristics of the soil in order to reintroduce agriculture for local needs, to robust the soil and thus have a better-quality harvest. While BE GREEN GO FARM! operates on a territorial scale that accommodates the practices listed above, it also needs to operate on an architectural and human scale. The project includes outer weather stables for goats and cows, a warehouse for machines, equipment and for storing food, a small farm shop with an office for the farmers, and a center for agricultural research and experimentation called AgroLab. The project is positioned to the north of the village, due to the absence of a slope and because it is located near the cultivation fields, and especially close to the village. Thus, the new design should be part of the village, not only providing local products but also strengthening the sense of community. As the valley station of the ski lift is being given a new function, we would like to reuse the ski lift structure as a “climbing field”. In conclusion, the project is sensitive to the climate and environmental issues of recent years and stands as a resilient solution to the changes to come, but taking a cue from the past, so, BE GREEN GO FARM!
Muriel Beringer und Luzie Geißler
Zwischenwelt
Zwischen Tradition und Moderne
Bücher wie ‚architecture without architects‘ lehren uns, wie man mit lokalen Materialien und einfachen Bauweisen sowohl den lokalen Herausforderungen entgegentreten kann, als auch über das Weitertragen von Generation zu Generation sich zum identitätsstiftenden Element entwickelt.
In Herrenschwand finden wir Überbleibsel des engen Miteinanders: Hausbäume dienen als natürlicher Witterungsschutz und die Typologie des Schwarzwaldhauses an sich war Multihabitat für Mensch, Flora Fauna mit integriertem Stall und Platz für Futter.
Doch so wie Flora und Fauna aus dem Haus, verschwindet auch die regionale Vielfalt an Flora und Fauna. Wir blicken auf den
Ausgangspunkt für Herrenschwand, den die Entfremdung von Mensch, Tier und Umwelt mit sich trägt: Ein viel zu warmes Klima, Waldsterben, Artensterben, kaputte Böden, Grundwasserknappheit, und Schneeunsicherheit. Wo ist diese einst so enge Verbindung zwischen Mensch, Tier und Umwelt hin?
Zwischen Mono- und Multihabitat
Der Entwurf thematisiert die Wiederherstellung des Mensch-Tier-Umwelt-Verhältnisses – Es entstehen Multihabitate, Räume der Kohabitation. Die Effekte? Robuste Lebensgrundlagen: Die Wiederherstellung einer regionalen Vielfalt und eines wasserspeicherfähigen Bodens. Über die Auswahl von Zielarten und Anknüpfen an alte und neue Traditionen können lokale Herausforderungen, gemeinsam mit Flora und Fauna, bestritten werden.
Die Transformation beginnt am Skiliftgebäude, welches seine Nutzung durch die Schneeunsicherheit nach und nach verliert. Von hier aus werden Räume und Elemente der Kohabitation erprobt: Der Skilift wird zum Multihabitat für Mensch, Flora und Fauna. Das Gelände entlang des Lifts wird zum Testfeld: Der Boden wird durch das Einarbeiten von kompostiertem Vogelkot wasserspeicherfähig. Alternativen zu monofunktionalen Einfriedungen begrenzen das Testfeld: Sie kombinieren das persönliche Bedürfnis des Menschen und bilden Habitate und Lebensgrundlage für andere Arten.
Chiara Keim und Alina Mykhaylova – Bachelorarbeit
A Conversation with…
Animals
Herrenschwand ist ein kleines idyllisches Dorf auf einem Hochplateau im Südschwarzwald mit Blick auf die umliegenden Berge und Täler. Bei nur hundert Einwohnern ist meist nicht viel los, sodass man außer ein paar Kühen nur Touristen trifft, die zum Wandern, Skifahren und zur Erholung hierherkommen. Auf den ersten Blick merkt man nicht, dass dieser Ort aufgrund des Klimawandels mit großen Problemen konfrontiert ist. Die Natur leidet bereits unter diesen Problemen. Wie Bienen, deren Zahl weltweit rückläufig ist. In den letzten Jahren ist ihre Zahl durch Krankheiten und von Lebensraumverlust um Milliarden Jahre zurückgegangen. Die Menschheit muss ein Schritt zurück machen und ihre gesamten Verhältnisse und Beziehungen zu den Tieren überdenken. Gerade wenn man sich das im modernen Vergleich anschaut, wie zum Beispiel in unserer früheren engen Konversation mit Flora und Fauna im Schwarzwaldhaus. Dort haben Menschen und Tiere unter einem Dach zusammengelebt und Kühe waren wie ein vollwertiges Familienmitglied und auch beteiligt an der Ernährung des Hauses. In Herrenschwand und im Skiliftgebiet sehen wir das Potenzial, dass man dieses Konzept vom Schwarzwaldhaus im ganzen Dorf einbringt.
Die Konversation mit Flora und Fauna befindet sich am damailigen Skiliftgebiet. Drei Bereiche entstehen: Die Kuhstübli, der Berg und das Bienenhaus in der Bergstation. In dem Bereich zwischen der Bergstation und dem Kuhstübli, werden punktuelle Duftstellen angelegt. Wiesen welche Pflanzen tragen, die den Bienen die Möglichkeit zum Eintrag von Pollen bieten. Die Talstation des Skilifts ist ein wichtiges Gebäude in der Einwohnergemeinschaft von Herrenschwand. Viele haben hier ihre Kindheit verbracht und somit viele Erinnerungen an diesen Ort. Hier haben wir ein riesiges Potential den traditionellen Gedanken der Kuh im Haus wieder Anklang finden zu lassen. Die Kuh wird in das Dorfleben integriert, durch den Umbau des Skistüblis zum Kuhstübli.
Manuel Kramm und Alex Schumacher
Herrenschwand 2045 – Ein Handbuch für die notwendige Transformation
Wie äußert sich Klimaschutz in der räumlichen Planung? Wie lässt er sich im ländlichen Raum integrieren? Wir haben uns mit dem Dorf Herrenschwand beschäftigt, mit seiner Architektur, der Geschichte und aktuellen Themen, dem Tourismus, dem Naturraum, der Demografie, dem sozialen Miteinander und wie all diese Dinge mit dem Klimawandel zusammenhängen. Welche Risiken besten? Was hat und was wird sich verändern? Was für Anpassungen sind in Herrenschwand notwendig, damit wir alle als Gesamtgesellschaft in Deutschland 2045 klimaneutral leben können? Welche Herausforderungen und Chancen bestehen dabei?
Es gibt nicht nur eine Lösung für die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Die Dorfgemeinschaft hat die Möglichkeit, den für sie passenden Weg zu suchen und die Identität von Herrenschwand bei der notwendigen Transformation bestmöglich zu bewahren. Wir haben heute die Technologien, die notwendigen Ideen und das Know-How zur Umsetzung. Aber wie lässt sich dies in der Praxis umsetzen? Unsere Erkenntnisse haben wir dazu in einem an die Bewohner des Dorfs gerichteten Handbuch zusammengefasst, um sie auch zum Handeln aufzufordern. Wird rechtzeitig und selbstständig gehandelt besteht die Chance, einen immensen Einfluss auf Gestaltung und Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen zu haben und das ohne Angst, die Kontrolle über die eigene Umwelt abgeben zu müssen. Die Bewohner haben heute die Chance, die Zukunft Ihres Dorfes zu gestalten!
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum,
Alba Balmaseda Domínguez
Ksenija Zujeva
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum,
Porosität
Entwürfe
Porosität – Betrachtungen der performativen Stadt am Beispiel Stuttgart
Was ist Porosität? 1925 definierten Walter Benjamin und Asja Lacis in ihrem Text „Denkbilder Neapel“ den Begriff neu: „Porosität begegnet sich nicht allein mit der Indolenz des südlichen Handwerkers, sondern vor allem mit der Leidenschaft für Improvisieren. Dem muß Raum und Gelegenheit auf alle Fälle gewahrt bleiben. Bauten werden als Volksbühne benutzt. Alle teilen sie sich in eine Unzahl simultan belebter Spielflächen. Balkon, Vorplatz, Fenster, Torweg, Treppe, Dach sind Schauplatz und Loge zugleich.“
Was im Text als subjektive Wahrnehmung beschrieben ist, wurde in jüngster Zeit stärker erforscht und als Agenda in die Stadtplanung eingeführt. Wir können es als Antwort und Gegenposition zur Denkweise der Moderne verstehen. Als Ausdruck eines radikalen neuen Denkansatzes versuchte die Moderne mit den Mitteln der Massenproduktion die Stadt in ihre Bestandteile zu zerlegen, zu strukturieren, zu standardisieren und zu trennen. Doch wir wissen heute längst, dass dadurch die Lebendigkeit und die Vielfalt des Stadtraums in großen Teilen zunichte gemacht wurde.
Die poröse Stadt im Gegenzug wird über das Undefinierte, das Unbestimmte, die Mehrdeutigkeit, die Vielfalt und die Koexistenz von Elementen geprägt, so wie die Stadt in der vormodernen Zeit. Gehen wir also den Schritt zurück und gleichzeitig den Schritt nach vorn, versuchen wir aus monofunktionalen Stadträumen, polyfunktionale Orte zu schaffen, Grenzen aufzubrechen und Schwellen einzuführen sowie Rahmenbedingungen zu setzen, in denen Entwicklungen stattfinden können, die nicht vorhersehbar sind: „Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht, keine Gestalt behauptet ihr »so und nicht anders«.“ (Benjamin, Lacis, 1925)
Unser Ziel war es, Topografien der Porosität zu entwerfen, die von der suggestiven Erzählung von Walter Benjamin und Asja Lacis ausgehen. Darüber hinaus haben wir über die Auswirkungen auf unseren Lebensstil und die Folgen für Stadtplanung nachgedacht und haben versucht diese in einem Entwurf zu verdeutlichen: Wie können Gesellschaft, Kultur, Klima und unser Lebensalltag den öffentlichen und privaten Raum neu definieren? Wie können wir von anderen Ländern, Kulturen, Religionen und Mentalitäten lernen, den statischen, steinernen Stadtraum zu einem dynamischen, aufgebrochenen Ort, zur porösen Stadt zu machen?
Für dieses Thema war die Auseinandersetzung mit dem Ort fundamental. Die Anwesenheit in Stuttgart war Voraussetzung für die Teilnahme am Entwurf und wir haben die Innenstadt von Stuttgart bereist und dabei ganz neu entdeckt.
Eine internationale Gruppe von Studierenden aus Italien, Russland, Türkei, Spanien, Portugal und Frankreich formulierten in Absprache mit dem Lehrteam ihren eigenen Entwurfsschwerpunkt und Vertiefungsmaßstab. Wir ermöglichten das Entwerfen über alle Maßstäbe hinweg und ermutigten, schnell und direkt in den Entwurfsprozess einzusteigen und dabei parallel die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema zu suchen.
Für den Entwurf konnten wir unserem Partner des CURRENT Festivals (http://www.current-stuttgart.de/ ) zusammenarbeiten beteiligten Künstlern zusammen das Thema erörtern und uns mit ihnen austauschen.
Während des Semesters hatten wir die Freude Prof. Dr. Sophie Wolfrum, Dr. Elenio Cicchini, Haseeb Ahmed, Benjamin Frick, Julien Fargetton and Christian Zöhrer als Gäste begrüßen zu dürfen.
Fotos: Entwurfsorte
Fotos: Impressionen aus dem digital-analogen Studio
Fotos: CURRENT collaboration
Arbeiten der Studierenden
Mathilde Josse und Maria Inês Pires Reis
Die Definition von städtischen Bereichen ist immer eine sensible Angelegenheit. Sie ist jedoch von Natur aus etwas Unvermeidliches. Die Städte, in denen wir heute leben, sind eine endlose Aneinanderreihungen von Territorien. Die dort lebenden Nachbarn verbinden die unterschiedlichen Lebensstile, kulturellen Erziehungsweisen und Kommunikationsformen miteinander. Verschiedene Möglichkeiten, die sich auf unvorhersehbare Weise vermischen: Bereiche voller Widersprüche, ständiger Turbulenzen und Ambivalenzen. Manchmal sorgen diese mehrdeutigen Linien für Klarheit im Raum, sie können aber auch Chaos auslösen. Diese schmalen und empfindlichen Grenzen sind es, die es uns ermöglichen Porosität und ihre Durchlässigkeit zu erkennen.
Das Dazwischen in der Paulinenstraße 50, im Herzen der Stadt spricht für uns genau diese Themen an. Eine zentrale Narbe in einem so anregenden Gebiet, das für alle zugänglich und offen ist, aber dennoch still zu sein scheint und wenig Aktivität stattfindet. Selbst die wenigen Anzeichen von Leben in seinem inneren Kern sind für die Augen der Passanten so subtil, dass sie auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar sind. Drei Wohnblöcke, Werkstätten für Druck und Grafikdesign (ProLab) und eine technische Hochschule (DHBW) stoßen aufeinander und kämpfen um ihr eigenes Stück annehmbares Territorium. Vielleicht liegt in diesem Aufeinanderprallen und der Dualität der Lebensstile das Problem, vielleicht ist es aber auch der Motor zur Steigerung von Leben. Die Koexistenz gegensätzlicher Programme macht den Reichtum und die Möglichkeit der Durchlässigkeit dieses Ortes aus.
Mit dieser teils widersprüchlichen Komplexität umzugehen war keine leichte Aufgabe: Von daher war das Verständnis der vielen unterschiedlichen Qualitäten des Raumes hier ein Ausgangspunkt für die Intervention. Unser Vorschlag könnte als etwas beschrieben werden, das mit dem Vorhandenen schlicht in Interaktion tritt und subtile Veränderungen vorzunehmen versucht, sodass die ursprüngliche Atmosphäre nicht zerstört wird. Es ging immer darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Alltäglichen und dem Intimen, dem Außen und dem Innen, dem Geschlossenen und dem Offenen, dem Zugänglichen und dem Undurchlässigen. Neben diesem Ausloten von Grenzen geht es auch immer darum, den „gesichtslosen“ Rhythmus der städtischen Masse zu durchbrechen und die Fassaden in übergangslose, wechselnde Elemente des Austauschs zwischen Nutzern, Gemeinschaften, Fußgängern und der Stadt zu verwandeln. Folglich wird sich das Leben in den Höfen verändern. Diese Etappen werden andere Geschichten erzählen und neue Verbindungen zwischen den verschiedenen physischen Dimensionen und städtischen Realitäten herstellen.
Irene Calero Pagés, Àngels Cañellas Genius, Diego de la Guardia Fontes und Miquel Virgili Mártinez
Die Welt wird nach der Covid-19 Pandemie eine andere sein. Sie verändert die Art und Weise, wie wir Städte und Räume nutzen. Dies führt dazu, dass Flächen für den Einzelhandel, das Einkaufen oder das Parken aufgegeben werden und eine neue Vorstellung von Wohnen entsteht.
Durch die Beobachtung der aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen haben wir eine Hypothese aufgestellt: 30 % der bebauten Fläche in der Stuttgarter Innenstadt werden in den nächsten 10 Jahren aufgrund der neuen Gewohnheiten des Home Office und des Online-Shoppings nicht mehr genutzt werden. Wir haben für unseren Vorschlag einen großen städtischen Block mit Einzelhandels- und Parkflächen vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof ausgewählt und für diesen Standort zwei verschiedene Strategien entwickelt, die unserer Hypothese entsprechen: Die eine besteht darin, den potenziell verlassenen Raum mit temporärem Wohnraum zu füllen, die andere darin, den Raum leer zu lassen und die Baustruktur in ein weniger kompaktes, gemischt genutztes öffentliches Programm umzuwandeln. Das Konzept der Porosität war die treibende Kraft bei beiden Projekten, die als Wiederverwendung und Anpassung verstanden werden.
Studentenwohnheim Mitte
ZEITGENÖSSISCHES STUDENTEN-NETZWERK
Stuttgart hat in den letzten Jahren unter einem Wohnungsproblem gelitten, das es fast unmöglich macht, eine Wohnung in der Stadt zu mieten, da die Preise besonders für junge Menschen zu hoch sind. In dieser Vision schaffen wir in dem bestehenden Gebäude temporären Wohnraum für Studenten, der erschwinglich ist und zudem mit wichtigen
wie dem Hauptbahnhof oder dem Universitätscampus Punkten der Stadt verbunden ist. Dieses Programm wird in der Stadt ein anderes Umfeld schaffen, in dem sich das studentische Leben und das Leben im Stadtzentrum besser vermischen können.
Weinvorplatz
STUTTGART MIT WEINBERGEN VERBINDEN
In der heutigen Zeit sind Grünflächen in Großstädten Mangelware und deshalb sehr wertvoll neben der unbestrittenen Notwendigkeit für ein gutes Mikroklima. Das Ziel dieses Projekts ist es, das teilweise leerstehende Gebäude mit unterschiedlichen Grünstrukturen zu füllen und ein Erlebnis für die Menschen zu schaffen, die sie besuchen. Der Entwurf beinhaltet die Nutzung des lokalen Wissens über den Weinanbau, der in dem Gebäude implementiert wird. Alle Nutzungen werden miteinander vermischt, einschließlich des Anbaus der Trauben, der Produktion des Weins und eines Weinmarktes, auf dem dieser und Wein aus der Region verkauft werden kann. Das Erdgeschoss wird zu einem öffentlichen, durchlässigen Raum wodurch nicht nur ein Mehrwert für die Bewohner der Stadt geschaffen wird, sondern auch ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt werden kann.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Alba Balmaseda Dominguez
Lorenz Brugger
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Urbane Symbiosen
Entwürfe
Zukunftsvisionen an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Gewerbe, Produktion und Wohnen, Stadt und Land
In diesem Entwurfssemester machten wir uns auf die Suche nach neuen Paradigmen für produktive Quartiere, beschäftigten uns mit der Wechselwirkung von Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnen, um innovative Lösungen für reale Herausforderungen zu entwickeln.
Die Stadtregion Stuttgart ist einerseits geprägt durch eng vernetzte Siedlungsflächen mit vielfältigen Produktionsstandorten und andererseits weitläufige Frei- und Erholungsräume mit gleichzeitig oft intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Um diese spezifische stadträumliche Struktur nachhaltig weiterzuentwickeln, muss auf Grund der Flächenkonkurrenzen und Wohnraummangel über neue Möglichkeiten der Kombination, Überlagerung, Verdichtung und Veränderung der unterschiedlichen Funktionen nachgedacht werden.
Das Rahmenthema für den Entwurf bildete die nutzungsgemischte Produktive Stadt, die sowohl in der neuen Leipzig Charta als auch der IBA 2027 – der Internationalen Bauausstellung StadtRegion Stuttgart – eine wichtige Rolle spielt. Noch fehlt es an mutigen Visionen und Vorbildern, die bestehende Konflikte lösen und widerstrebende Interessen versöhnen helfen.
Der Entwurf wurde in Kooperation mit der Stadt Fellbach durchgeführt – diese entwickelt im Rahmen der IBA 2027 auf einem 110 Hektar großen Gebiet das Projekt „Agriculture meets Manufacturing“. Hier treffen an der Schnittstelle zu Stuttgart Wohnen, Landwirtschaft und Gewerbe räumlich direkt aufeinander und es besteht somit die Chance wichtige Fragen zu thematisieren: Welche Rolle wird die stadtnahe Versorgung in Zukunft spielen? Wie können wir gleichermaßen lebenswerte und produktive Quartiere schaffen? Kann eine neue, urbane Form der Landwirtschaft das Grüne in das Grau der Gewerbegebiete bringen? Und welchen konkreten Mehrwert hat dies für die Stadt Fellbach, die gesamte Region Stuttgart und darüber hinaus?
Luftbild Entwurfsgebiet: © Stadt Fellbach
Gäste digitale Diskussionsrunde:
Frank Gwildis: Amt für Stadtplanung und Wohnen, Stuttgart
Gerhard Hauber: Ramboll, Studio Dreiseitl
Mark Zahran: Yasai, Zürich
Prof. Dr. Andreas Ulbrich: Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Hochschule Osnabrück
Gastkritik:
Prof. Sonja Nagel, IRGE, Universität Stuttgart
Prof. Ulrike Böhm, SI, Freiraumgestaltung, Universität Stuttgart
Ulrich Dilger, Abteilungsleiter Stadtentwicklung, Stadt Fellbach
Entwurfsgebiet
Impressionen aus dem Studio
Arbeiten der Studierenden
Claire Oswald
Acker der Zukunft
Im Fellbacher Westen stoßen Stuttgart und Fellbach aufeinander. Dabei wird die Grünzäsur immer weiter zurückgedrängt und ergibt sich dem Wachstumsdruck der
Gewerbegebiete und dem Flächendrang der Landwirtschaft, die ohnehin durch wachsende
hat. Flurgrenzen haben sich über die Generationen entwickelt oder wurden nach Nutzung
willkürlich gezogen. Sie sind nicht direkt sichtbar, äußern sich jedoch durch räumlich ausgeprägte Grenzstrukturen. Besonders deutlich ist dieser Unterschied zwischen den Flurstücken der landwirtschaftlich genutzten Flächen und denen der Gewerbeflächen. Durch die Analyse der Grenzen ist das Bewusstsein für dreidemensionale Grenzräume gewachsen. Sie zeigen ein Raumpotential auf, das wenig Beachtung in der heutigen Gesellschaft findet. Mit dem Entwurf ACKER DER ZUKUNFT soll ein visionäres Zukunftsbild aufgezeigt werden, wie die aggressive Grenzausbildung durch eine Symbiose mit der urbanen Landwirtschaft neu entworfen wird.
Das Quartier soll Impulsgeber und Pilotprojekt für eine neue Sichtweise der Stadtlandschaft sein. Durch die Symbiose mit dem III. Akteur, die Landwirtschaft der Zukunft, soll der Bestand aktiviert und belebt werden. Die Unternehmen vor Ort werden durch ein neues grünes Netzwerk miteinander verbunden und erfahren eine Bereicherung durch die Interaktion im Grenzraum sowie neuen Freiraum. Die gewachsene Struktur gliedert sich in unterschiedliche Nutzungsbereiche, die durch den Weg der Landwirtschaft entstanden sind. Die konkreten Nutzungen unterteilen sich in:
– experimentelle Anbauflächen auf Dächern, kleinen Räumen und hohen Elementen
– Transportwege auf Stegen
– Logistikzentrum in einem brachliegenden Bestandsgebäude mit Lagerhalle, Verwaltung und Vertrieb
– Dachcafé mit Mittagstisch für die Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen
– Informationszentrum mit Lehrgarten für die Öffentlichkeit
Durch dieses Projekt soll auch das Bewusstsein für den Anbau regionaler Lebensmittel angeregt werden und mit welcher Mühe wie sie angebaut werden.
Christian Nopitsch
Grenzräume – gemeinsam handeln!
Im Fellbacher Gewerbegebiet kommt es zu einem Konflikt zwischen den Wachstumsdruck des Gewerbes und der Zurückdrängung der Landwirtschaft. Eine Lösung dieses Konfliktes ist das Erkennen von Flächenpotentialen im Bestand, um den Flächendruck von einer weiteren Expansion des Gewerbegebietes zu nehmen. Zum Schaffen von Raum rückten Grenzen in den Fokus der Forschung. Sie weisen große ungenutzte Raumpotentiale auf. Der zentral im Gewerbegebiet gelegene Block ist sehr von den verschiedensten Grenzen geprägt. Die Fläche besteht aus vielen Flurstücken von unterschiedlichen Eigentümern. Der Block ist geprägt von großen Parkierungsflächen, einer offenen Bebauung mit einfachen Gewerbebauten unterschiedlicher Größen und einer geringen Bebauungsdichte.
An den Grenzen brechen sich die Interessen der Grenzparteien. Sie müssen an solchen Standorten die vielfältigsten Aufgaben erfüllen. Warum also nicht die Grenzen als Raum sehen und nutzbar machen? Der entstehende Raum trägt dem Wachstum des Gewerbestandortes Rechnung. Die Grenze bleibt keine lineare Abtrennung zweier Parteien, sondern wird gedacht als ein nutzbarer Raum, der einen wertvollen Beitrag zur Bereitstellung von neuen Flächenpotentialen an wachsenden Gewerbestandorten liefert.
Dafür werden drei Typologien an Grenzräumen erkannt, die repetitiv in Gewerbegebieten auftreten. Dadurch können typologische Antworten gefunden werden, die auch in anderen Kontexten anwendbar sind. Diese drei Typologien sind der Zwischenraum, der Hinterraum und der Nebenraum.
Clara Pflug und Jona Schulte
Landwirtschaftliche Stadt – Städtische Landwirtschaft
Die Vision eines Miteinanders von landwirtschaftlicher Produktion und alltäglichem Leben in einem Baukörper wurde in diesem Entwurf auf dem Iba-Gelände Fellbach getestet. Raumsparend und trotzdem platzschaffend soll der Baukörper dem Flächendruck im Wohnungsmarkt, in der Landwirtschaft und auf der Grünzäsur einen Lösungsansatz entgegenkommen. Auf den 1900m2 sollen ca. 80 Bewohner untergebracht werden und
ein landwirtschaftlicher Ertrag, dem eines 1900m2 großen Feldes entsprechend, geerntet werden können. Das Gebäude hat 4 Geschosse.
Die Nutzungen im Gebäude sind heterogen angeordnet. Zu den Bewohnern und landwirtschaftlichen Flächen gesellen sich Flächen für soziale Angebote, wie ein Vereinsheim und ein Veranstaltungsraum. Hierdurch werden Kommunikationsräume für die
verschiedenen Akteure geschaffen. Eine gemeinsame Erschließung im Gebäude fördert dies zusätzlich. Das Angebot an Wohnungen ist ebenso divers und reicht von großen Maisonettewohnungen, über kleinen Einheiten in Clusterzusammenschlüssen und barrierefreien 2-Zimmer Wohnungen.
Der landwirtschaftliche Anbau ist im ganzen Baukörper präsent. Ob in Hochbeeten oder in einem angeschlossenen Vertical Farming, für Besucher und Bewohner ist er immer sichtbar. Die Flächen sorgen für eine Begrünung und Auflockerung im Gebäude. Die Freiflächen um das Gebäude sind unterschiedlich bepflanzt, um hier verschiedene Anbaumethoden testen zu können. Dieses Flächen richtet sich nicht nur an die Landwirte, sondern können auch teilweise von Bewohnern genutzt werden.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Harry Leuter
Ksenija Zujeva
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum,
Moloch Stadt, Idylle Land?
Entwürfe
Entwurfsbasiertes Forschungsstudio
Moloch Stadt, Idylle Land? — Versuch einer Interpretation
Was ist Stadt? Was ist Land? Gibt es diese Polarität heute noch? Oder wird sie in Zukunft sogar wieder verstärkt? In einem entwurfsbasierten Forschungsstudio widmen wir uns als kleine Studiogemeinschaft diesen Fragen.
Die aktuelle globale Pandemie macht besonders deutlich, dass trotz der Renaissance der Städte der letzten Jahre, der ländliche Raum wieder verstärkt zum Sehnsuchtsort geworden ist. Die Ursprünglichkeit, Ruhe, Abgeschiedenheit, Ortsverbundenheit und das gesunde Leben auf dem Land werden der potenziell gefährlichen, lauten, verdreckten und dichten Stadt gegenübergestellt.
Im Forschungsstudio hinterfragen wir diese Zuschreibungen und Narrative und verarbeiten die Erkenntnisse in konzeptionell künstlerischen Entwürfen zu Stadt und Land.
Mit Mitteln der Fotografie konstruieren wir in einem ersten Schritt durch idealisierte Bilder den klaren Gegensatz von Stadt und Land. Anschließend de-konstruieren wir diese Bilder und hinterfragen, was hinter diesen Bildwelten steht und welche komplexen, oft widersprüchlichen Zusammenhänge die Realität kennzeichnen. In einem letzten Schritt rekonstruieren wir die vielfältigen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Stadt und Land – sie werden neu entworfen und in die Zukunft gedacht.
Hierzu begeben wir uns in intensiven physischen Austausch mit unserer unmittelbaren Umgebung. Von der Stuttgarter Innenstadt führen unsere Expeditionen hinaus auf das Land, in die Gemeinden des Rems-Murr-Kreises. Im Spannungsfeld zwischen den vermeintlichen Gegensätzen urban-rural, findet unsere Feldforschung statt.
Foto: Ciro Miguel, www.ciromiguel.com
Impressionen aus dem digital-analogen Studio
Gäste: Erieta Attali, Dr. Sue Barr, Ciro Miguel
Arbeiten der Studierenden
Phase 1: Klischee
Phase 2: Realität
Phase 3: Vision
Anna-Maria Rieg, Mahnaz Shahriyari, Julius Stark
Haushoch Grün.
Die neuen Ausgleichsräume in der Stadt kontrastieren die bunte, laute, reizüberflutete Stadt voller Möglichkeiten und Alternativen. Diese Grünräume bringen vor allem eine Qualität des ländlichen Lebens mit sich: die Einfachheit.
Hier muss man nichts entscheiden, muss nichts sehen, keinen anderen Personen ausweichen oder irgendwelchem Verlangen widerstehen. Hier kann man einfach nur sein. In seiner eigenen Natürlichkeit und in der Natürlichkeit seiner Umgebung.
Die Verortung auf den Dächern bringt Abstand zur Erdgeschosszone und eine direkte Loslösung vom Trubel. Hinzu kommt der automatische Perspektivenwechsel, der unmittelbar mit einer Erweiterung des Sichtfelds verbunden ist. Dennoch befinden sich diese Orte unmittelbar in der dichten Stadtstruktur. Die neuen Flächen sorgen somit nicht für einen Verlust an urbaner Dichte, sondern erhalten städtische Qualitäten.
Schließlich ist ein weiteres Argument die flächendeckende Verbreitung von Flachdächern, gerade im innerstädtischen Kerngebiet, und somit die Verfügbarkeit des notwendigen Raumes.
Das neue Land. Jana Dörr, Vivienne Mayer
Was macht das dörfliche Leben aus?
Menschen schätzen am Landleben vor allem die Nähe zur Natur, das Gefühl von Gemeinschaft und das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Doch was ist davon noch übrig? Was in der heutigen Zeit von Bedeutung? Wie viel Gemeinschaft verträgt unsere hoch individualisierte Gesellschaft überhaupt? Und wie viel braucht sie? Der folgende Entwurf untersucht die Potentiale des ländlichen Raums an Hand konkreter Interventionen in Hößlinswart, einem Ortsteil der Gemeinde Berglen, Baden-Würrtemberg mit 759 Einwohnern.
Wir betrachten sowohl die räumlichen als auch die sozialen Komponenten und verknüpfen diese miteinander. Die Bestandsentwicklung ist geleitet von Umnutzung, Umbau und Sanierungsfragen, um Leerstand und Abriss zu verhindern, sowie Nachverdichtungsstrategien für unbebaute Grundstücke und Restflächen. Erst wenn die Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Dorfstrukturen voll ausgeschöpft sind, kommt es zum Neubau. Die Strategie Neubau muss Hand in Hand mit räumlicher und sozialer Vernetzung gehen. Es wird eine engmaschige räumliche Vernetzung geschaffen, indem Wegeverbindungen und Treffpunkte zwischen dem Bestandsdorf und dem Neubaugebiet etabliert werden. Im Neubaugebiet selbst werden – wie im ursprünglichen Dorfkern auch – gemeinschaftliche Funktionen und Nutzungsmischung integriert. Die neuen Funktionen sind gesellschaftsübergreifend und barrierefrei nutzbar, stärken die Gemeinschaft und bieten eine Plattform für Austausch und Dialog; nicht nur zwischen neuen und alten Dörfler*innen, sondern auch zwischen Stadt und Land.
Muster und Inseln. Viviana Merz, Viktor Metz, Jana Nolting
Stadt und Land befinden sich im stetigen Veränderungsprozess. In den letzen Jahrzehnten haben sich vermehrt monofunktionale und unstrukturierte Ortschaften in den unbebauten Raum ausgebreitet. Dies betrifft die Städte und Dörfer in gleichen Maßen. Vielfältige Ursachen wie hohe Bodenpreise, räumlichen Trennung von Funktionen oder die Expansion des Automobils haben die Zersiedlung stark gefördert. Die Kulturlandschaft wird vom Siedlungsrand verdrängt und zunehmend durch Bebauung und Versiegelung zerstört. Zusätzlich gilt der Siedlungsrand als Resterampe mit geringen räumlichen Qualitäten.
Das Konzept sieht eine Umgestaltung der Siedlungsränder vor. Der Übergang zwischen Siedlungsfläche und Kulturlandschaft wird mit dem aus der Landwirtschaftsökologie entlehnten Begriff des „Ökotons“ neu bewertet. Innerhalb des Ökotons soll die Siedlungsfläche wirtschaftlich ausgenutzt werden und mit besonderen ortsspezifischen Qualitäten eine Alternative zum urbanen Kern bilden. Die weitere Zersiedlung soll durch präzise städtebauliche Interventionen beendet werden, ohne Stadt und Land voneinander zu trennen.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum,
Harry Leuter
Ksenija Zujeva
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum,
REPARARE
Entwürfe
Entwurfsbasiertes Forschungsstudio
In unseren Städten manifestieren sich die gesellschaftlichen Diskurse und Bedürfnisse auch räumlich im Städtebau, der Architektur und im Freiraum. Bestimmte Akteure in der Stadtentwicklung – gerade auch in Stuttgart – führen diese Diskurse über den Abriss und Neubau von Gebäuden, während sich andere ein historisierendes Bild von Stadt konstruieren, welches es so nie gegeben hat. Wir setzen diesen Positionen eine andere Perspektive gegenüber: das Bestehende wird zur Grundlage und konkreten Ausgangsbasis für das Gegenwärtige und Zukünftige. Authentizität und ein bewusster Umgang mit Stadträumen und Stadtarchitektur bedeuten für uns die Weiterentwicklung zu wieder aktiven Bausteinen des Stadtalltags.
Im entwurfsbasierten Forschungsstudio beschäftigten wir uns mit Strategien im Umgang mit Bestehenden auf städtebaulicher und architektonischer Ebene. Die Anerkennung des Wertes des Vorhandenen bildete die Basis für die Entwicklung einer Haltung des Umgangs damit. Reparatur bedeutet in diesem Sinne ein tiefgehendes Verständnis zu entwickeln, die Zusammenhänge dadurch zu begreifen und durch dieses Verständnis neue Zugänge zum Entwerfen zu erlangen.
Ort unserer Entwurfsforschung ist das Bahnhofsgeviert in Bad Cannstatt mit der Schwabenbräu-Galerie. Wir haben uns mit der Entwicklungsgeschichte des Ortes, den Narrativen zum Ort und seiner semantischen Bedeutung, aber auch intensiv mit der baulichen Struktur, den Materialien und deren Zukunftswert sowie auch dem Baurecht kreativ auseinandergesetzt.
Die Analyse bildete die Grundlage für eine tiefgreifenden und intensive Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner Umgebung. Nicht nur aktuelle Plangrundlagen und historische Fakten und Dokumente boten aufschlussreiche Einblicke und Auskünfte über die Gebäude und das Areal sondern auch Geschichten, Erinnerungen, Meinungen und Fundstücke formten einen aufschlussreichen Pool an Informationen.
Mittels handwerklicher Workshops haben wir unseren Entwurfsprozess befruchten. Aus dem eigenen handwerklichen Arbeiten konnten konzeptionelle Ansätze für unser städtebauliches und architektonisches Entwerfen in und mit der gebauten Alltagswelt abgeleitet werden. Diese Workshops wurden unterstützt durch Gespräche mit Gästen aus verschiedenen entwerfenden Disziplinen.
Das Studio förderte eine eingehende Reflektion über die Haltung im Umgang mit dem Bestand. Aus der reellen Erfahrung des Reparierens wurde eine Haltung zum Bestehenden entwickelt, um diese dann auf den Entwurfsstandort in Stuttgart anzuwenden.
Bildnachweis: Gordon Matta-Clark – Conical Intersect, 1975, Paris, Foto: Jane Crawford
Impressionen aus dem digital-analogen Studio
Gäste: Dr. Julia Feldtkeller, Kiyomi Okukubo, Paola Sakr, Werner Sobek,
Reparare Workshops
Arbeiten der Studierenden
Giuliana Fronte
Grenzräume.
Marina Kuhn
Liebe auf den zweiten Blick.
Tina Todorovic
Schwabenbräu.
Sarah Serve
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Sascha Bauer
Alba Balmaseda Domínguez
Jonas Malzahn
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Studio Täglich
Entwürfe
Die aktuelle Lage schafft eine neue Dimension der Nähe und der Distanz, der Dichte und der Beengtheit. Wir erleben und betrachten die Stadt jetzt viel mehr aus dem Inneren unserer Wohnräume heraus und es wird deutlich, welche Möglichkeiten des öffentlichen Raums in all seinen räumlichen Facetten nun nicht mehr Teil unseres Alltagslebens sind.
Mit dem Studio Täglich reagieren wir auf diese Situation und nutzen sie als Chance, in einer kompakten Gruppe aus Studierenden und Wissenschaftlern die Gedanken des Täglich weiterzuführen.
Wie sieht öffentlicher Raum als Gebäude aus?
Der Mensch braucht den Bezug zu anderen Menschen, für den Austausch in jeglichen Verhältnissen. Durch diesen Austausch lernen wir voneinander und lernen miteinander umzugehen. Jeder Mensch hat die gleichen Freiheiten, wie alle anderen. Die Öffentlichkeit sollte dieser Ort sein, an dem sich jeder wohlfühlen kann, weil jeder die Berechtigung hat diesen Ort zu nutzen.
Wir haben in dem Semester das Bauliche und das Theoretische parallel und gleichwertig betrachtet und haben versucht architektonische Situationen zu entwickeln, die sowohl Bedingungen als auch Berechtigungen mit sich bringen, und die vor allem für das Gemeinschaftliche und Öffentliche sensibilisieren.
Das Semester endete in einer dreitägigen Ausstellung in Bad Cannstatt in der Nähe des Wilhelmsplatz. Zwischen dem Cannstatter Bahnhof und dem Wilhelmsplatz befindet sich die Schwabenbräu-Passage, die sich hervorragend als ‚Täglich‘ anbieten würde.
Das ‚Täglich‘ kann ein Sehnsuchtsort für alle diejenigen sein, die Gemeinschaft lieben, die es lieben im Geschehen zu sein, zu beobachten, die sich zeigen wollen, quatschen und lästern, die Kontakt oder aber die Einsamkeit suchen. Für die, die sich auch mal verstecken müssen und Ruhe brauchen, ungestört liegen, zwanglos tanzen oder konzentriert lernen wollen – ein Raum für die individuelle Emanzipation.
Studioimpressionen
Kontext - die Schwabenbräu Passage in Bad Cannstatt
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum,
Sascha Bauer
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum,
In Kollaboration mit
Walter Gropius Lehrstuhl (UBA,FADU – DAAD)
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires
Prof. tit. Markus Vogl
Meine Stadt, Mein Zuhause
Entwürfe
Grenzen, Schwellen, Übergänge
Schwellen — auch als Metapher für die heutige Zeit — sind der Ausgangspunkt unserer Diskussion über die städtebauliche Dimension des Wohnens.
Die aktuelle Lage schafft eine neue Dimension der Nähe und der Distanz, der Dichte und der Beengtheit. Es wird deutlich, welche Möglichkeiten des öffentlichen Raums in all seinen Facetten nicht mehr Teil unseres Alltagslebens sind. Wir betrachten und fühlen die Stadt jetzt viel mehr aus dem Inneren unserer Wohnräume heraus. Die Schwellensituationen — Fenster, Balkone, Loggien, Dachterrassen, aber auch Treppenräume und Eingänge — werden verstärkt zu Orten der Aneignung und des sozialen Austausches.
Neben den konzeptionellen Überlegungen zu den Schwellenräumen beschäftigen wir uns mit der Frage wie wir zukünftig zusammenleben wollen. Wie viel Raum brauchen wir als privaten Raum? Was können wir teilen? Welche Rolle spielt der öffentliche Raum?
Das Studio „Meine Stadt, mein Zuhause“ ist weder ein klassischer Architekturentwurf noch ein klassischer Städtebauentwurf. Wir sind zusammen dem Rahmenthema auf der Spur und sammeln, testen, evaluieren Ideen, Konzepte und räumliche Aspekte.
Die Studierenden formulieren in Absprache mit dem Lehrteam ihren eigenen Entwurfsschwerpunkt und Vertiefungsmaßstab. Wir ermöglichen das Entwerfen über alle Maßstäbe hinweg.
Entwurfsorte
Impressionen aus dem digital-analogen Studio
Arbeiten der Studierenden
Jeremy West
Im WOHNEN spiegelt sich unser Verhältnis zur Gesellschaft. Begriffe wie Individualität und Identität lassen sich auf die Frage wie wir Wohnen zurückführen.
Vom raschen Bevölkerungszuwachs der Städte vorangetrieben und von pragmatischen Prinzipien neuer Bautechnologie dirigiert, wird der GENERISCHE RAUM zum erfolgreichen Massenprodukt unserer Zeit. Er begünstigt das Ausleben eines zeitgenössischen Individualismus, die Beschäftigung mit dem Selbst. So wird das Bauen und Bewohnen zur Trendfrage und beschränkt sich heute auf die eindimensionale Ebene der Möblierung, Dekoration, Oberfläche. Wir verdanken diesen Zustand auch dem Anspruch der Moderne, die das Wohnen vom Arbeiten zu trennen, gar als widersprüchliche Tätigkeitsorte zu betrachten wusste. Obwohl Produktivität und Regeneration heute wieder am selben Ort denkbar sind, bleibt Wohnraum nicht zuletzt wegen wachsender Mobilität und Vernetzung ein austauschbares Gehäuse.
Diesem entgegen steht der SPEZIFISCHE RAUM als architektonische Urform. Als gebauter Ort beruht seine Existenz auf dem Prinzip der Tektonik, spricht mit Symbolen von seiner Verortung, den Geschichten seiner Erbauer und Bewohner. Heute wird der spezifische Raum als abstraktes Konzept verstanden und auf einen Formalismus reduziert. Wir vergessen dabei sein enormes Potenzial zur Stimulierung von Identitäts- und Gemeinschaftssinn, welches aus seiner starken Bindung an Ort und Zeit hervorgeht. Doch vor allem für die Befriedigung sozialer und kultureller Bedürfnisse, die über die Beschäftigung mit dem Selbst hinausgehen, ist er unabdingbar.
Die Arbeit hinterfragt die Vernachlässigung der spezifischen Architektur und bietet sie als identitätsstiftenden Ort der sozialen Interaktion an. Das MITEINANDER von generischem und spezifischem Raum, kann unseren Wunsch sowohl nach Individualität als auch Identität vereinen. Die Wohnfrage muss sich zwangsläufig der notwendigen Balance beider Modelle widmen, und eine neue Baukultur als konkrete Verräumlichung dieser Konzepte verstehen.
Dalya Ortak
Ausgangspunkt meiner Überlegungen war meine eigene Situation während des Lockdowns mit dem einseitigen Erleben des Öffentlichen aus dem Privaten heraus. Wir wurden zurückgeworfen auf unseren privaten Raum und somit auf das was wir per se als die eigenen vier Wände bezeichnen. Wie wenig Zeit ich tatsächlich unter normalen Umständen in meiner Wohnung verbringe, wurde mir erst durch diese Situation bewusst. Für mich ergaben sich daher folgende Fragen: wie viel privaten Wohnraum benötige ich tatsächlich? Wofür gebe ich mein Geld aus? Und wie nutze ich meinen Wohnraum in dieser Situation?
Die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit verwischen und das Wohnen findet nicht mehr nur in der privaten Sphäre statt. Es dehnt sich aus und findet den Hochpunkt im kollektiven Zusammenleben des Schwellenraums – zwischen Privat und Öffentlich. Nach Jan Gehl fördern genau diese notwendigen Aktivitäten (wie bspw. Schlafen, Essen, Hygiene) Begegnungen und stellen die Basis für das Entstehen von sozialen Kontakten dar. Zudem ermöglicht das Teilen der ausgelagerten Wohnfunktionen, dem Bewohner die Möglichkeit nur für den Raum zu zahlen, den er tatsächlich als sein Zuhause definieren wird. Die Einpersonenhaushalte werden zu einem Haushalt zusammengeschlossen, welcher sich über das gesamte Gebäude zu einem Gemeinwesen hin entwickeln wird.
Dieses Verschwimmen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum wird durch das Weglassen einer umhüllenden Fassade in der typischen Form von Außenwänden betont. Es gibt keine räumliche Trennung des Haushaltes zum Stadtraum hin. Somit ist das dort stattfindende Leben vom öffentlichen Raum her einfach erschließbar und sichtbar. Während die Plattformen gleichmäßig oben abschließen und sich in der Höhe an die bestehende Bebauung anpassen, treten die Grundfunktionen als Solitäre aus der oberen Ebene heraus.
Das Wohnen findet in dem „Dazwischen“ statt, im direkten Kontakt mit dem Stadtraum. Die Bewohner werden dadurch integrativer Bestandteil der Stadtgesellschaft.
Julius Lutterbüse und Philipp Deilmann
Neue und saubere Technologien ermöglichen es uns Infrastrukturen zurück in die Stadt zu bringen. Diese Strukturen werden dadurch nicht nur wahrnehmbar, sondern sollten auch so gestaltet werden, dass sich ein sozialer und räumlicher Mehrwert für den spezifischen Ort ergeben kann. Die aktuelle Diskussion beläuft sich leider häufig auf sogenannte smarte Anwendungen, die Nachhaltigkeit und technische Innovationen in unser zu Hause und damit in unsere Städte bringen. Antworten aufdrängende soziale, ökologische und räumliche Fragen können diese Anwendungen jedoch nicht liefern. Die soziale und ökologische Frage wird unser Zuhause wie wir es heute kennen in Zukunft maßgeblich bestimmen.
Unsere Strategie den eben beschriebenen Phänomenen zu begegnen läuft darauf hinaus, neue infrastrukturelle Technologien zu etablieren und den großzügig vorhandenen Raum im Stuttgarter Stadtteil Hallschlag in Orte zu transformieren, die Identifikation ermöglichen, die in der Lage sind auf unterschiedlichen Ebenen mit ihren Bewohnern zu kommunizieren. Die von uns eingebrachten Strukturen sind spezifisch auf den Ort zugeschnitten und diskutieren in unterschiedlichen Maßstäben eine sozial und ökologisch verträgliche Produktion, damit die Menschen den Hallschlag als Ihren Kiez, als Ihr Viertel wahrnehmen, indem sie Verantwortung übernehmen, in dem eine aktive Bürger*innengesellschaft den Stadtteil prägt. Die eingebrachten Interventionen sollen am Beispiel des Hallschlags aufzeigen, wie wir unsere Städte in Zukunft ganzheitlich verändern können.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Alba Balmaseda Domínguez
Ksenija Zujeva
Alexander Richert
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
In Kollaboration mit
Walter Gropius Lehrstuhl (UBA,FADU – DAAD)
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires
Prof. tit. Markus Vogl
Quartiere und Widersprüche
Entwürfe
Konzeptioneller Entwurf einer Stadterweiterung
Städte sind die bauliche Interpretation einer Stadtgesellschaft und derer politischer, kultureller und wirtschaftlicher Entwicklung. Basis hierfür ist die Dichte, Vielfalt und Mischung an Menschen, Nutzungen und Räumen. Durch diese Dichte wird Stadt aber auch zum enormen Ressourcenverbraucher an Energie, Gütern und Arbeitsleistung und zum Ort an dem Unterschiedliches aufeinandertrifft, Unterschiede deutlich sichtbar und Konflikte erlebbar werden. Stadt ist geprägt von dieser Ambivalenz.
Vor diesem Hintergrund entsteht beim Entwurf „Quartiere und Widersprüche“ ein Stadtteil der Gegensätze. Ein Gebiet am Rande von Stuttgart, wo Bad Cannstatt und Fellbach aufeinandertreffen, dient uns hierfür als Testfeld und wir kreieren ein Nebeneinander und Miteinander unterschiedlicher Quartiere. Das Programm der Quartiere wird von widersprüchlichen Interessen jeweils zweier Akteure bestimmt. Ziel ist es, für beide Parteien ein möglichst ideales Quartier zu schaffen, indem man Schnittstellen und Befruchtungsmöglichkeiten herausarbeitet und in einen räumlichen Entwurf übersetzt. Die verschiedenen Interessen einer Stadt werden dekonstruiert, neu zusammengesetzt und in der Gesamtheit aller Quartiere sichtbar gemacht. Ziel ist die Schaffung von Quartieren, die nicht der kleinste gemeinsame Nenner aller Akteure sind, nicht generisch, nicht bereinigt, nicht bequem. Sondern Quartiere, die anregen, inspirieren, die Reibung erzeugen und Interaktion anstoßen, aus der gesellschaftliches Leben und inklusive, produktive, urbane Städteräume hervorgehen.
Der konzeptionelle Entwurf entfaltet sich zwischen zwei notwendigen Ebenen in der Stadtwahrnehmung: der Prägnanz der städtebaulichen Raumbildung und dem Repertoire der Stadträume. Der Rahmenplan definiert die prägnante städtebauliche Raumbildung als Ausgangslage der Entwicklung. Hier werden die Leitlinien aber auch die Kapazitäten festgelegt. Das Repertoire der Stadträume hingegen bildet die Grundlage für den alltäglich gelebten Raum. Es besteht aus räumlichen Qualitäten, die zur Aneignung einladen und Gelegenheiten schaffen. Die Studierenden entwerfen im Maßstab des Städtebaus an der Schnittstelle zur Architektur.
Das Entwurfsgebiet
Impressionen aus dem Studio
Gastkritiker Michael Hirschbichler und Markus Vogl
Arbeiten der Studierenden
Leonard Mitchell und Viktor Metz – Bachelorarbeit
Individuell und Gemeinsam
Ziel des Entwurfs ist es ein möglichst ideales Quartier im Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinsamkeit zu schaffen, was durch die Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen sowie den draus resultierenden Baustrukturen, Finanzierungs- und Organisationsmodellen erreicht wird. Durch ein ausgeklügeltes Patchwork-System soll den verschiedenen Ansprüchen räumlich entsprochen werden. Dieses ist Ausdruck der Diversität die zwischen Individualität und Gemeinsamkeit hervorgebracht wird und Abbild der europäischen Stadt. Die städtebauliche Grundstruktur orientiert sich an der Parzellierung der ursprünglich ausschließlich agrarisch genutzten Bestandsflächen. Die sehr prägenden Obstbaumfelder werden erhalten und durch ein Netz öffentlicher Freiflächen miteinander verknüpft. Damit bilden sie einen Kontrast zur weitestgehend halbwöchentlichen und privaten Wohnnutzung. Die Kombination unterschiedlicher Wohntypologien auf engen Raum erfordert eine architektonisch sensible Umsetzung um den Ansprüchen des alltäglich gelebten Raumes gerecht zu werden. Hierfür wird besonders viel Wert auf die Übergangsbereiche zwischen Öffentlichkeit und Privatheit gelegt. Diesen Räumen wird mithilfe methodischer Planungsinstrumenten architektonischen Ausdruck verliehen. Ziel ist es variable, hierarchisch strukturierte Übergänge zu schaffen. Damit soll die Privatsphäre geschützt werden ohne die Wohnbebauung zu stark vom öffentlichen und halböffentlichen Raum zu trennen.
Clara Pflug und Jona Schulte
Feldstadt. Monokultur und Multikulti
Die Herausforderung des Entwurfes war es, den konträren Anforderungen des Akteurs Landwirtschaft, vertreten durch den Bauernverband, und der Migration, vertreten durch die Caritas und so fokussiert auf den Themenbereich Asyl, gerecht zu werden. Somit war es Ziel des Konzeptes einem zukunftsfähigen, ökonomischen Anbau von Agrarprodukten Raum zu geben und Asylsuchenden ein Umfeld zu schaffen, dass ihren Weg vom Ankommenden bis zum neuen Stuttgarter bestmöglich begleitet. Der in diesem Entwurf verfolgte Ansatz ist die horizontale und vertikale Durchmischung dieser unterschiedlichen Nutzungen in einer gemeinsamen Bautypologie. Die Bebauung orientiert sich an der bestehenden Feldstruktur und insbesondere an den schmalen „Stückle“ mit Baumbestand. Entlang und auf bestehenden Feldachsen mäandert die Bebauung aus langgestreckten, industriell anmutenden Baukörpern. Es bilden sich so kleinteilige Zwischenzonen für gemeinschaftliche Freiräume mit unterschiedlichen Anbau-und Freizeittypologien gegenüber von urbereinigten Feldflächen für den großmaßstäblichen, ökonomischen Anbauprozess. So werden Akteure in Kontakt gebracht, die im gesellschaftlichen Diskurs häufig nur aus der Distanz miteinander in Berührung kommen. Neben Wohnfläche, neuen und alten Anbaumethoden und integrativen Räumen ist so der Diskurs um eine (neue) gesellschaftliche Kohärenz im Fokus dieser Arbeit.
Matthias Krumbe und Behar Neziraj
Zwischen uns
Ist es möglich Raum ohne Gegensätze zu beschreiben?
Abgesehen von Atmosphäre und Emotionen, die sie schaffen, sind Räume eine rein physische Definition. Wir bestimmen was drinnen/was draußen, was offen/ geschlossen ist. Orte kommen uns groß/klein vor. Sie überlappen einander oder grenzen sich voneinander ab.
Die Konstruktion des Raums, wie sie uns erscheint, besteht aus kombinierten Gegensätzen. Die Existenz konträr zueinander stehender Eigenschaften ist eine Interaktion, die Raum entstehen lässt. Zwischen Räumen herrscht eine stille Kommunikation. Ein starrer Aushandlungsprozess von Relationen. Das aneinander Schmiegen, das Abwägen und Vergleichen von Gegensätzen ist die Sprache der Räume. Obwohl diese Gegensätze klare Verhältnisse schaffen, die wir benennen können, ist es unmöglich den Charakter eines Raumes nur räumlich zu beschreiben. Kommunikation zwischen Menschen lässt sich ebenfalls nicht nur durch gesprochene Sprache beschreiben. Räumliche Interaktion ist somit nicht viel weniger komplex als die Menschliche.
Was ist zwischen den Gegensätzen?
Raum als Ort der Gegensätze ist die Bühne menschlicher Kommunikation.
Wir zwängen uns in eine Welt, in der die Interaktion vom Minimalismus geprägt ist. Wir erfinden Regeln, Orte und Methoden um Kommunikation erklärbar und effizient zu machen. Sprache besteht aus Buchstaben, Wörtern und Grammatik. Häuser und Städte beherbergen uns. Wir nutzen digitale Geräte um zu kanalisieren und um den sprachlichen Raum Effizienter zu machen.
Was könnten die sprechenden Elemente sein ohne Sprache?
Was ist die Sprache des Unausgesprochenen?
Helena Harrer und Lorenz Engler
The next Level – die gemeinsame Stadt
Mit unserem Entwurf wollen wir eine Antwort auf die Frage geben, wie wir in Zukunft in Einklang mit der Natur leben können. Wie schaffen wir eine Stadt, in der Artenvielfalt und aktive Erholung einen nachhaltigen Pakt zwischen Menschen und Natur ausmachen? Wie können wir ein Zuhause für Menschen schaffen, die nach einer Lösung für ein besseres Zusammenleben mit der Natur suchen? Und wie können wir natürliche Lebensräume erhalten, das Wachstum von Pflanzen verbessern und Räume die von Menschen, Vegetation und Tieren genutzt werden vereinen? Unser Vorschlag für ein besseres Zusammenleben formuliert sich in einer Art Gerüst um die Bebauung. Es ist der Schnittpunkt, der die von uns definierten Naturarten, verbindet. Diese Naturarten sind: „Die Zimmerpflanze“ – dem von Menschen reguliertem Raum. Die „Partizipative Natur“ – sowohl vom Menschen als auch von der Natur beeinflusster Raum. Sowie die „Wildnis“- Vom Menschen nicht regulierte Natur. Das Gerüst löst die Grenzen auf. Es dient zur Beschattung, zur Erweiterung des Wohnraums, Raum für Vegetation und Tiere und als Erschließungsmöglichkeiten. So soll ein fließender Übergang zwischen den Naturformen und den konkreten Situationen, sowie neue räumliche und atmosphärische Charakteristika entstehen.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Harry Leuter
Ksenija Zujeva
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Studio Neubrunn
Entwürfe
Demnächst dürfte die Urbanisierung, wenigstens des Lebensstils, wohl auch den letzten Winkel des ländlichen Raums erreicht haben. Die Gegensätze zwischen Stadt und Land, Zentrum und Peripherie, Kultur und Natur schrumpfen. Der blasierte Blick des Städters auf das abgehängte Land hat sich zuweilen sogar verkehrt in eine romantische Idealisierung des ländlichen Raums, als Ort der Natürlichkeit, Ursprünglichkeit und des gesunden Lebens.
Trotz der neuen Aufmerksamkeit, die das Land dadurch bekommt, steht es vor erheblichen Herausforderungen, denn Stadtflucht, fehlende erreichbare Einrichtungen der Daseinsvorsorge, Leerstand und der sogenannte Donuteffekt (leerstehende Ortsmitten) schwächen viele kleinere Gemeinden. Durch den Wegfall kleinteiliger Versorgungseinrichtungen aus dem Ortskern fällt auch der Ort zur sozialen Begegnung und des Austauschs weg. Die Orte des Alltags verlagern sich aus dem Dorf hinaus und verhindern Begegnungen auf der alltäglichen Basis.
Welche Strategien und Instrumente stehen einem Ort wie Neubrunn in Franken zur Verfügung um mit den veränderten Herausforderungen umzugehen. Wo lassen sich Potentiale freilegen, die aus dem verschlafenen Dörfchen einen Pionier neuer ländlicher Urbanität werden lässt. Und welche Rolle spielen dabei Baukultur, Typologie und Bauweise.
Wir wollen konkrete räumliche und architektonische Vorschläge erarbeiten um die Ortsmitte Neubrunns zu reaktivieren und die Dorfgemeinschaft wieder neu zu entdecken. Dafür steht uns ein ausgedehntes Ensemble mitten in Neubrunn zur Verfügung, das einmal ein lebendiges Nebeneinander aus Wirtshaus, Tanzbar, Kegelbahn und Bierkeller gewesen ist. Man sieht den Räumen die rauschenden Feste noch an, die hier einmal stattgefunden haben. Welche Haltung können wir unter diesen vielschichtigen Voraussetzungen entwickeln um Neubrunn eine resiliente Zukunftsperspektive zu bieten und die Feste wieder stattfinden zu lassen?
Kurzexkursion nach Neubrunn und Coburg in den ersten Semesterwochen. Exkursionskosten voraussichtlich: 150 €
Der Entwurf ist eingebettet in das Forschungsprojekt „Intelligente Marktplätze“
Endabgabe: Mitte Februar
Die Studierenden entwerfen im Maßstab des Städtebaus an der Schnittstelle zur Architektur. Fundament der Lehre des Lehrstuhls Stadtplanung und Entwerfen ist Studiokultur. Entsprechend dieser arbeiten wir gemeinsam im Studio und verstehen uns als Lerngemeinschaft.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Andreas Beulich
Alexander Richert
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Studio Buenos Aires
Entwürfe
EinszuEins | Architektur als Social Design in Buenos Aires
Von der stadträumlichen Strategie zur Realisierung eines öffentlichen Gebäudes
Aktuelle soziale, ökonomische und ökologische Entwicklungen stellen die gebaute Umwelt vor große Herausforderungen. Die räumlichen Disziplinen sind gefordert, nicht nur die Auswirkungen dieser Transformationsprozesse auf städtische Gefüge zu untersuchen, sondern Lösungsansätze über Disziplingrenzen hinweg zu finden.
Buenos Aires ist mit seinen mehr als 14 Millionen Einwohnern ein idealer Studienfall für die Auswirkungen der aktuellen Herausforderungen auf das Stadtgefüge. Insbesondere in den Vorstädten – wie der von Deindustrialisierung stark überformten Vorstadt San Martin – ist der Bedarf an räumlichen Strategien besonders hoch.
San Martin weißt die größte Dichte informeller Siedlungen im Großraum Buenos Aires auf, liegt am Reconquista, dem mit am stärksten verschmutzten Fluss Südamerikas, und ist Standort der größten Mülldeponie vor Ort. Die schlechten Lebensbedingungen vieler tausend Menschen, die informell im Überschwemmungsgebiet des Reconquista leben, die Kontamination durch verschmutztes Flusswassers und Mülldeponie, die fehlenden sozialen und technischen Infrastrukturen, verlangen integrale, räumliche und nachhaltige Strategien der Stadtentwicklung über die Grenzen von Disziplinen und Maßstäben hinweg.
In Kooperation zwischen dem SI / SuE, dem IRGE, dem Walter-Gropius-Lehrstuhl (DAAD) der Universität Buenos Aires und anderen lokalen Partnern wollen wir uns dieser Aufgabe widmen und neben strategischen Überlegungen auf großmaßstäblicher Ebene konkrete Konzepte für räumliche Interventionen entwickeln.
Eine zweiwöchige Sommerschule in Buenos Aires vor Semesterbeginn bietet die Möglichkeit, die Situation vor Ort zu erfahren und sich mit lokalen Akteuren auszutauschen.
Arbeiten der Studierenden: Malte Didrigkeit und Anna Doerrig
Der Grundgedanke unseres Entwurfs möglichst viele Nutzungen auf minimalem Raum unter zu bringen wird durch ein Regal als Grundelement umgesetzt. Durch die Konstruktion aus genormten Teilen können einfache Änderungen vorgenommen werden. Alle Verbindungen von Regalen, Träger und tragender Konstruktion werden dabei durch Schraubbolzen erreicht, welche immer ein oder 2 Latten an eine Stütze klemmen
Basierend auf einem Grundmodul (1500/1500) bilden die Regale eine Einheit, welche verdreifacht eine Raumeinheit bildet (1500/4500). Aneinandergereiht entstehen so zwei Riegel zwischen denen die einzelnen Räume entstehen, diese sind durch die Konstruktion eines Ständerfachwerks überdacht. Die Nutzungen der Räume werden nur durch die Aufteilung und den Inhalt der Regale bestimmt, sodass auch andere Nutzungen in den Räumen stattfinden können und sie somit maximal anpassungsfähig sind.
Zwischen den Räumen innerhalb des Riegels befinden sich Innenhöfe, welche die Übergänge der Raumatmosphären bilden. Die Regale als flexible Elemente können so frei geöffnet und geschlossen werden und dienen auch als Vermittler zwischen Innen und Außenraum. So kann die Setzung als erster Schritt in einer Weiterentwicklung des gesamten Viertels zu sein.
Arbeiten der Studierenden: Annika Sieblitz und Cristina Estanislao Molina
Am Rande einer der am stärksten von Armut betroffen informellen Siedlungen – oder Villa – San Martin, befindet sich ein offenes Feld. Die einzige Freifläche in der gesamten Villa. Auf dem Papier gehört das Feld einer benachbarten Fabrik. Fragt man die Bewohner, würden sie sagen, dass es zu ihnen gehört.
Waldemar Cubilla, Ex- Häftling, Soziologe und Einwohner von La Carcova, sah vor Jahren die Gelegenheit, diesen Freiraum zu nutzen und beschloss, die erste „Biblioteca Popular“ des Bezirks zu eröffnen. Die Biblioteca Popular La Carcova ist viel mehr als nur eine Bibliothek, sondern Anstifter des sozialen Wandels in einem Bezirk, dessen Bewohner keinen Zugang zu grundlegenden Ressourcen oder Bildung haben. Unser Entwurf knüpft an Waldemars Gedanken an und greift den Ort als Bildungscampus auf. Über den Campus verteilen sich acht Elemente mit spezifischen Atmosphären. Durch die Anordnung der Elemente ergeben sich drei Bereiche des Parque Educativo. Im Norden der Sportbereich, im Osten eine ruhige Fläche und im Westen befindet sich der Platz für das Gemeinschaftsleben der Bewohner von La Carcova.
La Carcova braucht weder eine traditionelle Bibliothek, noch braucht es einen traditionellen Kindergarten oder eine traditionelle Sporthalle. Es braucht flexible Räume, die sich von den engen Räumen in den Häusern der Bewohner von La Carcova unterscheiden. Orte, die Neugierde wecken und zum Austausch und zur Bewegung anregen. Unser Entwurf soll eine Vision für die freie Fläche am Rand ihrer Siedlung geben, einem Parque Educativo, von dem auch Gise und Waldemar träumen.
Arbeiten der Studierenden: Nicole Müller und Clara Scherer
Nach unserem Besuch sind uns zwei Dinge im Kopf geblieben, die vor Ort sehr präsent sind. Auf der einen Seite das Streben nach Sicherheit, oft sichtbar durch Mauern, Zäune und Gitter an den Fenstern. Auf der anderen Seite, besonders in La Carcova, der hohe Stellenwert der Gemeinschaft und der Wunsch nach Räumen für Kommunikation und Interaktion. Unser Entwurf stellt sich bewusst mit einer offenen Struktur gegen das akute Bedürfnis der Abschottung auf Grund von Sicherheit. Mit unserem Entwurf wollen wir die These aufstellen, dass Sicherheit ein Resultat aus Partizipation, Identifikation und der daraus resultierenden sozialen Kontrolle ist.
Um Orte dieses Miteinanders zu schaffen, wählen wir eine Setzung die einen neuen Straßenraum ausformuliert, der von unterschiedlichen öffentlichen Gebäuden bespielt wird und eine aktive Aneignung durch die Bewohner fördern soll.
Als ein erster Baustein wurde von uns die „Neue Bibiliothek“ konkret ausformuliert. Maximal offene Strukturen sind flexibel nutzbar und können einzeln, sowie zusammengeschaltet bespielt werden. So wird das Gebäude vielen Alltagssituationen und besonderen Anlässen gerecht und bietet sowohl für ruhigere als auch für laute und aktive Unternehmungen Platz. Durch eine einfache Konstruktion kann auch im Bauprozess ein Miteinander entstehen und das Gebäude in die Nachbarschaft integriert werden.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Markus Vogl
Prof. Markus Allmann
Bettina Klinge
Spela Setzen
Sebastian Wockenfuß
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut in Kooperation mit dem IRGE
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Markus Vogl
IRGE Institut für Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens
Prof. Markus Allmann
Bettina Klinge
Spela Setzen
Sebastian Wockenfuß
Provisorische Architektur
Entwürfe
„Provisorische Architektur ist Medium für den Umbau unserer Städte, ist Ordnungsmittel und Großmobiliar, ist Koordinationselement für vorhandene Bausubstanzen und Prüfstand für öffentliche Meinung. Provisorische Architektur schafft die Möglichkeit, Wünsche und Vorstellungen der Stadtbewohner anhand vorgegebener Modelle zu konkretisieren, Verhaltensweisen in Erfahrung zu bringen.“ Ortner, Laurids (Haus-Rucker-Co) 1977.
Die Arbeiten des Entwurfs „Provisorische Architektur” gehen dem im vorhergegangenen Seminar beobachteten verzerrten Mobilitätsverhalten in Stuttgart auf den Grund und richten ihren Fokus gezielt auf die Situation am Österreichischen Platz, wo diese Realität im öffentlichen Raum sichtbar wird. Die Studierenden realisieren drei von einer Jury ausgewählte Realexperimente, welche dort in Form von provisorischen Architekturen umgesetzt werden. Sie dienen als Möglichkeit neue Ansätze, im Stadtraum zu testen, den Diskurs rund um eine neue Mobilitätskultur weiter anzustoßen und um neue Denkweisen zu kultivieren.
Der Entwurf „Provisorische Architektur” ist Teil des „Future City Labs Universität Stuttgart – Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur“ gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Ziel der Reallabor-Forschung ist, gesellschaftliche Experimentierräume für aktuelle Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft zu ermöglichen, um vom Wissen zum Handeln zu kommen. In Zusammenarbeit mit Stadtlücken e.V., der Stadtverwaltung und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen wird in der 2. Förderphase des Reallabors die kulturelle Dimension der nachhaltigen Mobilität in Stadtraum kooperativ erprobt. Das Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur dient dabei als Zukunftslabor und kooperative Plattform. Es bündelt erzeugtes Wissen, macht es zugänglich und diskutierbar: sowohl durch die digitale Vernetzung als auch durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Initiativen und Akteur*innen. Dabei geht es nicht nur um Technologien oder Strategien zur Verkehrsoptimierung, sondern vor allem um eine Kultur der Mobilität und Bewegung, die sich an einem erweiterten Wohlstandsbegriff orientiert, Gesundheit und sozialen Austausch fördert und neue Lebens- und Aufenthaltsqualitäten in der Stadt zu schaffen vermag.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Hanna Noller
Sebastian Klawiter
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Hanna Noller
Sebastian Klawiter
SESC in BC
Entwürfe
Bad Cannstatt ist geprägt von einer großen Vielfalt und enormen Gegensätzen. Stuttgarts größter Stadtbezirk kann auf eine lange Geschichte der Zuwanderung zurückblicken. Eine heterogene Bevölkerung lebt und arbeitet hier zusammen, in einer heterogenen Stadtstruktur.
Eine produktive und inklusive Stadt nutzt diese Vielfalt und Mischung, entwickelt daraus einen Nährboden auf dem Neues entstehen kann. Im Rahmen des Studios stellen wir uns die Frage nach den räumlichen Grundlagen für Interaktion und Austausch zwischen verschiedenen Gruppen in der Stadt. Wir reflektieren die Rolle des öffentlichen Raums in der europäischen Stadt und Stadtgesellschaft. Und wir entwerfen einen inklusiven und produktiven Ort für Bad Cannstatt.
Inspiration und Ausgangspunkt des Entwurfs sind die brasilianischen SESC-Zentren. Berühmtestes Beispiel: das SESC Pompeia von Lina Bo Bardi. Ein Ort offen für alle, der ein breites Angebot an Räumen und Nutzungen bietet. Kostenlose Sport- und Bildungsangebote werden hier ebenso angeboten wie Gesundheitsservice, Bibliothek, Kulturprogramm, Kinderbetreuung und last but not least erschwingliche Gastronomie oder einfach einen Ort zum Sonnen. Ebenso interessant die Finanzierung, getragen von den im Stadtbezirk ansässigen Gewerbebetrieben.
Im Entwurfsstudio sammelten wir interessante Konzepte für Gemeinschafts-, Sozial-, Kultur- und Bildungszentren weltweit. Wir diskutierten die Rolle eines solchen öffentlichen Ortes und die Potenziale für Bad Cannstatt. Wir erkundeten und analysierten den Standort im Umfeld des Wilhelmsplatzes und übertrugen die Erkenntnisse in Entwürfe.
Exkursion Ivry-sur-Seine am 26.11.18
Rundgänge mit Gastkritiken von Ciro Miguel, Charlotte Malterre-Barthes, Markus Vogl, Facundo Fernandez, Sabine Kastner
Arbeiten der Studierenden
Karla Bendele
Activating BC
Auf die Heterogenität des Stadtteils soll mit einem Zentrum reagiert werden, das sich auf mehrere Punkte am Wilhelmsplatz bezieht und mit den baulich bestehenden Strukturen arbeitet und sich somit in das Gefüge dieses Ortes mischt. Ein dezentral organisierter Ort der Gemeinschaft. An den verfügbaren Bestand, das Schwabenbräu, Parkhaus mit Kopfbau, König-Karl-Passage und Kaufhof werden so neue Gebäude, sogenannte Aktivatoren angefügt, die eine gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Funktion besitzen. Gebäude werden einfach nur hinzugefügt, Gebäudeteile werden ersetzt oder herausgenommen und Teile der Gebäude werden abgebrochen. Dies geschieht so, dass eine gute Zirkulation der Bewegung zwischen den einzelnen Gebäuden des Zentrums möglich ist und tote Zonen vor Ort durch die Setzung neuer Nutzungen aufgehoben werden. Jedes Bestandsgebäude bietet spezifische bauliche Voraussetzungen und so richtet sich die Zuteilung der Unterzentren nach der besten Eignung für das jeweilige dort geplante Geschehen.
Philipp Deilmann & Julius Lutterbüse
Public Monument
Die Heterogenität Bad Cannstatts führt immer wieder zu einem aufeinandertreffen unterschiedlichster Architekturen. An diesen Kollisionspunkten entstehen Vernetzungen, die sich wie ein Meer über das Stadtbild erstrecken. Die Lesbarkeit dieses Netzwerks ist nur durch Fixpunkte wie beispielsweise Bahnhof, Kursaal und Marktplatz möglich. Der Wilhelmsplatz bietet das Potenzial einen weiteren dieser Fixpunkte zu etablieren. Der monumental anmutende Baukörper bildet eine Insel, welche an die wichtigsten Stadtbausteine Bad Cannstatts anknüpft. Einzelne alltägliche Bausteine Bad Cannstatts wurden extrahiert und zu neuen Architekturen transformiert, welche die eigenständige Struktur Bad Cannstatts sichtbar werden lassen. Dies schafft eine Vertrautheit und Identifikation mit dem Neuen. Dabei geht es nicht um das Kopieren einzelner Elemente, sondern darum Bausteine sorgfältig zu kuratieren und neu in Zusammenhang zu bringen. Denn sowie die Stadt aus einzelnen Kompositionselementen besteht, ist auch das SESC IN BC in Fragmenten entworfen, welche sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Das neue SESC ist mit seinem Kontext verflochten: über eine unterirdische Passage, die Bahnhof und Altstadt miteinander verbindet, schlägt es seine Wurzeln in den Alltag Bad Cannstatts.
Ellen Scherr und Viviane Vu
Stadtrampe
Die multikulturelle Gesellschaft Bad Cannstatts bietet einen idealen Nährboden und hat das Potential einer überregionalen Vorbildfunktion für das Etablieren eines Gemeinschafts- und Kulturzentrums. Mit dem Ziel, das Bewusstsein für ein starkes Kollektiv wiederherzustellen, soll das Gemeinschaftszentrum Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebensstile vernetzen. Neben den Bewohner Bad Cannstatts als Hauptzielgruppe, steigert eine hohe Vielfalt an interessenübergreifenden Nutzungen auch die Attraktivität des Zentrums für nicht im Stadtteil Ansässige. Dabei wurde bewusst auf kommerzielle Nutzungen verzichtet. Unterschiedlichsten Funktionen und deren Nutzer werden in einem Gebäudekomplex bestehend aus dem Kulturkubus, dem Produktionsbau und dem sich dazwischen spannenden vertikalen Freiraum vereint. Dabei steht der Raum zwischen den Nutzungen in besonderer Weise im Fokus: Anstelle mehrerer punktueller Erschließungskerne zieht sich eine alles verbindende Erschließungsrampe durch den gesamten Gebäudekomplex, die es den Besuchern erst ermöglicht die unterschiedlichen Nutzungen wahrzunehmen. Die sich entlang der Rampe befindenden Möglichkeitsräume fördern spontane Begegnungen.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Maria Schiller
Alexander Richert
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Bad Gastein
Entwürfe
Bad Gastein – Zentrum einer temporären Stadt?
Der Diskurs über historische Zentren, deren Anziehungskraft für Besucher und die darum entwickelten, wilden Agglomerationen der heutigen Städte ist aktueller denn je. Die zukünftige Entwicklung von Städten ausgehend vom tatsächlichen Status Quo, der zersiedelten Landschaft, gilt es zu untersuchen und neue Denkansätze müssen formuliert werden.
Entlang des Gasteinertals entstand aus ursprünglich kompakten historischen Dorfkernen eine zersiedelte Landschaft. Bad Gastein bildet dabei den baulichen imposanten Endpunkt des Tals. Durch wöchentlich ebenso viele Touristen wie Einwohner kann die Gemeinde Bad Gastein saisonal als temporäre Stadt diskutiert werden.
Im Prozess der Zersiedelung wurde Bad Gastein im 19. Jahrhundert durch die einmalige Lage in dramatischer Landschaft zum beliebten Kurort für Wohlhabende. Die Trennung von Bediensteten und Touristen führte zu sozial und funktional getrennten Stadträumen, ähnlich einer topografisch manifestierten Gated-Community und manifestierte sich auch morphologisch zum heute typischen Stadtbild mit mächtigen Hotels der Belle Époque und der Trennung von schmalen Promenaden und steilen Funktionswegen als separierte Verbindung zwischen den unterschiedlichen Milieus.
Heute betrachtet der Tourist das historische Zentrum aus verspekulierten, leeren Hüllen und das Stadtleben hat sich längst entlang des Tals ausgebreitet – weniger fotogen in neuen provisorisch anmutenden Zentren.
Doch es scheint Bewegung in die Entwicklung zu kommen. Das Land Salzburg hat drei Hotels um den Straubingerplatz gekauft und einen Investor gefunden, der diese sanieren und wieder für Gäste erlebbar machen will. Der Bau eines Fußgängertunnels vom Bahnhof in das historische Zentrum wird geprüft und mehr und mehr ziehen kulturelle Veranstaltungen und Marketing- Events wieder ein jüngeres Publikum an. Inwiefern diese Projekte und Bemühungen jedoch der langfristig positiven Entwicklung dienlich sind, bleibt abzuwarten.
Trotz vorbildhafter Besucherzahlen stellt sich die allgemeine Frage unserer gebauten Umwelt: Kann Tourismus das letzte Allheilmittel historischer, innerstädtischer Zentren sein? Denn das Scheitern der räumlichen und ökonomischen Konzentration auf nur einen Aspekt hat zumindest in Bad Gastein gezeigt, wie anfällig eine solch monofunktionale Fokussierung sein kann, insbesondere bei einer externen Logik der Finanzierung.
Im Gegensatz zu der bislang einseitigen Entwicklung, arbeiten die Projekte der Studierenden unterschiedliche Aspekte heraus, die interessante Denkanstöße für Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen bieten. Von direkt umsetzbaren punktuellen Eingriffen über langfristige großmaßstäbliche Strategieplanungen bis hin zu einer völlig neuen Ausrichtung der Art des Zusammenlebens wird eine große Bandbreite an Möglichkeiten für Bad Gastein aufgezeigt. Die Beiträge und Vorschläge sollen neben der Diskussion im Sinne der Studiokultur am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart auch zum Weiterdenken vor Ort anregen.
Impressionen Rundgänge mit Gastkritiken von Marie-Theres Okresek, Markus Vogl und Daniel Schönle
Arbeit der Studierenden
Thomas Lesch und Jakob Schlipf
Stadt als Promenade
Bad Gastein zählt monatlich fünfmal mehr Touristen als Einwohner. Im Gegensatz zu anderen touristisch geprägten Orten gibt es jedoch keine Konflikte zwischen Bewohnern und Touristen, da es keine Schnittstellen gibt. Touristisch geprägte Orte wie Bad Gastein können jedoch nur funktionieren, wenn Bewohner und Touristen zusammenarbeiten und durch Synergieeffekte voneinander profitieren.
Mit einem verbindenden linearen Element soll das Zentrum neu definiert werden als lineares Zentrum. Eine Promenade als Zentrum, die die verschiedenen Zentrumsstrukturen miteinander verbindet. Die Promenade bezeichnet per Definition den Spaziergang und gleichzeitig den gebauten Fußgängerweg. Auf einer Promenade wird der Spaziergang regelrecht zelebriert, man geht nicht, sondern flaniert. Gleichzeitig stellt die Promenade auch eine Art Bühne dar. Sie ist ein Ort des Austausches und der Interaktion. Die Promenade bildet in dem Fall einen Ort, an dem Stadtöffentlichkeit sichtbar wird.
In Bad Gastein hat die Promenade eine kulturhistorische Bedeutung. Wegeverbindungen wie die Kaiser-Wilhelm-Promenade dienten dem damaligen Kur-Tourismus als Prachtmeile sowie als Treffpunkt. Diese Orte waren ausschließlich dem europäischen Hochadel vorbehalten, jedoch nicht der Bad Gasteiner Bevölkerung.
Die Exklusivität der Bad Gasteiner Promenade soll aufgebrochen werden, indem der Bad Gasteiner Bevölkerung eine Promenade als verbindendes Element gegeben wird. Diese soll Tourismus und Bewohner einen. Gleichzeitig sollen historisch funktional getrennte Bereiche, inklusiv miteinander verbunden werden. Die Monofunktionalität der einzelnen Bereiche wird dadurch aufgebrochen und verbindet unterschiedliche teils gegensätzliche Atmosphären. Sie verläuft dort, wo diese am intensivsten zu erfahren sind. Sie stellt eine Verbindung der grauen, urbanen, dynamischen Bereiche mit den grünen, ruralen, statischen Bereichen dar. Diese Gegensätzlichkeit erzeugt Spannungen wodurch Dynamik erzeugt werden kann. So definiert Lucius Burckhardt den Spaziergang als eine Sequenz, einer Perlenkette, aufgrund derer eine integrative Leistung vollbracht wird. Das Motiv ist nach Burckhardt der Übergang von der Stadt aufs Land. Dieser Übergang kann in einem kleineren Maßstab auch auf Bad Gastein angewandt werden. Der Übergang des urban-touristischen zum rural-sesshaften. Dieser Übergang wird begleitet vom Berg in der Mitte. Die Promenade führt ringförmig einmal um diesen herum. Wenn man die Promenade somit einmal entlang flaniert, kann man den Ort in seiner Gänze wahrnehmen.
Cristina Estanislao und Kathrin Schnell
Sorry guys I´m on retreat
Schon die Kaiser und Könige ahnten es: zu viel Stress tut nicht gut. Deshalb traf man sich in unregelmäßigen Abständen zur Sommerfrische in Bad Gastein. Das promenieren bei herrlichem Panorama verhalf dabei ebenso zur Linderung ihrer Zimperlichen wie die Anwendungen mit dem radonhaltigen Heilwasser. Die Stadt bot alles um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Heute bestimmen Hektik und Zeitdruck den Alltag. Es mangelt an geeigneten Räumen, Architekturen und Strukturen. Ein Burnout vorbeugen bevor es entsteht, allein oder mit der ganzen Familie auf Retreat, sei es für ein Wochenende oder gleich ein ganzes Jahr. Am besten spontan, in der Natur, nicht zu weit weg aber abgeschieden genug.
Wer in Bad Gastein aus dem Zug aussteigt und durch die Gassen hinab ins alte Zentrum läuft, spürt schnell warum dieser Ort seit Jahrhunderten eine hohe Anziehungskraft auf Besucher auswirkt. Zwischen mondänen Hotels aus einer anderen Zeit und umgeben von einem beeindruckenden Alpenpanorama stürzt sich tosend ein Wasserfall in die Tiefe.
Abgekoppelt von der Hektik des Alltags, bewegt man sich durch Bad Gastein wie in einer Seifenblase. Lebenskünstler und Ruhesuchende bilden schon heute eine inspirierende Symbiose.
Das leerstehende Kongresszentrum aus den 60er Jahren wird in seiner ehemaligen Funktion komplett transformiert. Die Konstruktion aus Fertigbetonteilen wird dabei größtenteils erhalten. Den neuen Bedürfnissen entsprechend bietet es im Herzen der Stadt fast alles, was temporäre und permanente Bewohner auf Retreat benötigen. Es dient sowohl im Sommer, als auch im Winter als umbauter Kurpark. Da die Schätze der Natur für alle zugänglich sein sollten, steht das radonhaltige Heilwasser zur freien Verfügung. Auch andere Annehmlichkeiten wie Ruhe- und Bewegungszonen in unterschiedlichen Dimensionen werden angeboten. Besucher treten in ein beruhigtes Ambiente und können sich ganz auf ihre Erholung fokussieren. Die Räume werden durch ihre Materialität definiert und laden so zur Nutzung ein. Um kein Überangebot zu schaffen, kann das Zentrum sukzessiv erweitert werden. Verschiedene Qualitäten, wie geschlossene, offene und gemeinschaftliche Räume wechseln sich ab.
Eine Reminiszenz an die alten Wandelgänge rundet den Entwurf ab und verwebt den Eingriff mit der Geschichte des Ortes.
Alina Gold
Nischen
Ehemals bekannt als Kurort für Wohlhabende, stellt sich Bad Gastein heute mit verspekulierten Gebäuden inmitten des Wintersportgebiets dar. Die Stadt regt Touristen und Bewohner dazu an, Nischen zwischen den verspekulierten Fassaden entdecken zu wollen. Im Gegensatz zum Kongress- und Straubingerplatz finden sich in Bad Gastein unzählige Nischenorte, die zwischen Image und Identität des Ortes vermitteln.
Im Entwurfsprozess wurden beispielhaft Nischen analysiert und auf ihre Eigenschaften untersucht. Das intrinsische Entwerfen fünf dieser Nischen im historischen Ortszentrum wurde durch das Erfassen der in den Nischen liegenden Anreize erwirkt. Die entstandenen Möglichkeitsräume intensivieren oder kontrastieren vorgefundene Atmosphären. Atmosphäre wird generiert durch das Schaffen von und Arbeiten mit den Sinnen Sehen, Hören, Riechen und Tasten sowieso die subjektive Erwartung an und das subjektive Gefühl für einen Ort.
Ginster Bauer
Vertierung Bad Gastein
Bad Gastein war in früheren Zeiten die ländliche Außenstelle und Nahrungslieferant von Salzburg. Mit meinem Städtebauvorschlag möchte ich zum einen die ländlichen Wurzeln herausarbeiten und zugleich die kleinstädtische Struktur wiederbeleben. Zum anderen möchte ich in meinem Vorschlag einen zeitgenössischen Diskurs über ein anderes Mensch-Tier-Verhältnis integrieren, um darüber zu einem neuen Besiedlungskonzept zu gelangen. Dieses kann als Modell für eine besondere Form der Nachverdichtung und Revitalisierung betrachtet werden.
Da Bad Gastein mit Leerständen zu kämpfen hat und nur Teilbereiche der Stadt saisonal belebt sind, soll der Ort durch Ansiedlung von Nutztieren und damit auch von Menschen wiederbelebt werden. Das Nutztier muss von Menschen gefüttert und gepflegt werden; und umgekehrt war und ist der Mensch auf Nutztiere als Nahrungs- und Materiallieferant angewiesen.
Die Ansiedlung der Tiere umfasst Schafe, Ziegen, Hühner, Kühe und Alpakas. Bei der Herausarbeitung der städtebaulichen Maßnahmen habe ich mich an den Bedürfnissen der Tiere orientiert. Als Vorbild für eine funktionierende Mensch-Tier-Infrastruktur wurde der Bauernhof genommen, der eine fast dörfliche Struktur besitzt. Bei „Vertierung Bad Gastein“ soll Tieren ein eigener Raum überlassen werden, den sie nach ihrem „Eigen-Sinn“ gestalten können. Die Umnutzung der zahlreichen Grünflächen kann nicht nur vielen Tierbewohnern einen neuen Lebensraum (beastly spaces) bieten, sondern auch zu einer anderen Form der Nachverdichtung und Umnutzung beitragen. Das Parkhaus wird zum Tierhabitat, Parkplätze werden zu Stallungen. Die nötigen Baumaßnahmen wären: Bau von Ställen, Bau von Vertrieben, neue Tier-Mensch-Habitate mit Nutzung der Abwärme von Tieren als Energieressource. Die Vertierung von Bad Gastein könnte auch für den Tourismus einen positiven Nebeneffekt haben: Landurlaub und Urlaub auf dem Bauernhof sind inzwischen bei Familien aus Großstädten ein beliebter Trend. Ein „vertiertes“ Bad Gastein würde innerhalb dieses Tourismusangebots eine Sonderstellung einnehmen, da eine ganze Kleinstadt mit Umgebung in die „Vertierung“ einbezogen wäre. Angebote für Familien zum Mitmachen bei der Tierpflege oder beim Melken, Füttern, Spaziergänge mit Ziegen, usw.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Sascha Bauer
Harry Leuter
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Valparaíso La Matriz
Entwürfe
Qualifizierung eines produktiven Stadtteils
Der Diskurs über eine inklusive Stadtentwicklung, die Qualifizierung bestehender Stadtquartiere und die Mischung von Nutzungen in urbanen Kontexten ist nicht nur in Europa, sondern weltweit und damit auch in Südamerika zu führen. Die Studierenden denken, entwerfen und diskutieren im Rahmen der vorgeschalteten Exkursion und der Sommerschule La Matriz Konzepte für die Stadt und Stadtgesellschaft, als konkrete Diskussionsbeiträge für die Verbesserung der Lebensbedingungen in zentralen und doch marginalisierten Stadtteilen. Architektur und Stadtplanung zeigen hierbei ihre Alltagsrelevanz und Bedeutung im Diskurs über die Entwicklung von Stadt als gemeinschaftlichen und inklusiven Lebensraum.
Im Anschluss an die Exkursion und die Sommerschule in Valparaíso sind die Entwurfsansätze in den einzelnen Hochschulen (Universität Stuttgart, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Universidad de Buenos Aires) in interdisziplinären Entwurfs-Studios vertieft worden. Anhand einer maßstabsübergreifenden Entwurfsanalyse im Kontext von La Matriz wurden individuelle Ansätze zur Entwicklung eines eigenständigen Konzeptes in Gruppen erarbeitet. Dabei lag der Fokus auf einer integralen Herangehensweise im näheren Umfeld des UNESCO Weltkulturerbes und der sogenannten Buffer Zone.
In den Stuttgarter Entwurfsgruppen wurde in unterschiedlichen Quartieren gearbeitet, welche sich vom Hafengebiet über die von starker Verkehrsinfrastruktur durchzogenen Ebene bis hin zu der Übergangszone um das Barrio La Matriz entwickelten. Somit konnte die gesamte Bandbreite des speziellen Kontextes in Valparaíso von der Hafenkante (El Plano) bis hin zur Avenida Alemania (Cerros) gedacht werden.
Die Eingliederung eines Konzeptes im städtebaulichen Maßstab wurde in den nächsten Schritten über den Architekturmaßstab gedacht, diskutiert und weiter entworfen. Kommend von einer übergeordneten räumlichen Strategie für die Stadt Valparaíso, entwickelten die Studierenden eine städtebauliche Setzung an von ihnen gezielt ausgewählten Orten. Eine Vertiefung erfolgte im Hinblick auf ein urban gedachtes Quartier, einer kontextuell angepassten programmatischen Diversität und insbesondere des Wohnbaus mit starkem Bezug zu den eigenständigen Blockkubaturen, welche neue Grundrisstypologien erforderten.
Ines Ehrenbach und Silva Maringele
Auf der städtebaulichen Ebene ist Valparaíso nach verheerenden Naturereignissen wie partiellen Bränden, Tsunamis und Erdbeben als Patchwork zu sehen.
Das Entwurfskonzept besteht darin, La Matriz als zentralen Flicken zu betrachten, von welchem aus sich die Stadt in die Cerros hinauf entwickelt hat.
Die Setzung in diesem Bereich soll die Verbindungen in die anderen Quartiere stärken und durch die gedachte Richtung vom Berg ins Tal, erhält diese erstmals eine Aufmerksamkeit durch die Stärkung der Gebäuderückseiten.
Auf der Quartiersebene betrachtet der Entwurf die Verbindungen zwischen öffentlichen Räumen durch Erweiterung der bestehenden Platzabfolge. Dem Netzwerk aus Plätzen werden neue hinzugefügt, welche die von den Hügeln kommenden Menschen in Empfang nehmen. Hierbei sind introvertierte Höfe nachbarschaftliche Verbindungsglieder dieser neuen Freiräume. Dies wird erreicht durch die Setzung neuer Bausteine in brachliegenden Flächen in einem heterogen bebauten Umfeld.
Im architektonischen Maßstab werden aus dem Motiv des Patchworks heraus verbindende räumliche Verknüpfungselemente im Wohnbau entwickelt. Dabei haben die Patiohäuser gemeinsame Eingangsbereiche, dem Laubengangtyp sind private Freibereiche angegliedert und bei den topographisch eingebundenen Townhäusern wurde mit fließenden Splitlevel eine Verbindung zum äußeren Kontext erschaffen.
Katharina Wackler und Phaea Korycik
Der Ursprung Valparaísos liegt am Hafen. Bis zur Eröffnung des Panama-Kanals war dieser der wichtigste Umschlagort Süd- und dem Westen Nordamerikas. Durch den rückläufigen Schifffahrtsbetrieb hat der historische Kern La Matriz an Bedeutung verloren. Leerstand und Brachflächen ergänzen den vernachlässigten Eindruck des Stadtteils.
Der Entwurf setzt am Wasser einen Impuls und stärkt die Angliederung an den Stadtteil mit einer Transformation der Uferkante und der Öffnung des aktuell geschlossenen Hafengebietes.
Der Hafen erhält ein baulich manifestiertes Gegenüber, wovon beide Seiten profitieren. Das entstehende Mischgebiet bleibt dem rauen, einfachen Hafencharakter treu. Auf den drei neu entwickelten Baufeldern wird das Wohnen mit den für die Stadt typischen Erdgeschossnutzungen kombiniert und unterschiedliche Raumangebote ermöglichen eine bunte Mischung – von kleinen Werkstätten bis hin zum Zeitungskiosk oder Obsthändler.
Die ausgearbeitete Gebäudetypologie ist eine Neuinterpretation der für Valparaíso typischen Blockbebauung von circa 30x30m. Um mit der großen Tiefe des Gebäudes umzugehen und eine ausreichende Belichtung zu ermöglichen, arbeitet der Entwurf mit einer Kombination aus Lichtschächten und Erschließungsplattformen und bietet zudem die Möglichkeit mit differenzierten Haushaltsgrößen umzugehen. An der prominenten, dem Wasser zugewandten Fassade, befindet sich ein Gemeinschaftsraum, der für alle Bewohner zugänglich ist und das für Valparaíso einmalige Hafengebiet im Stadtzentrum für eine weitere Entwicklung in den Fokus rückt.
Anna-Lea Rohrbach, Lisa Schmidt und Julian Lipp
Leitidee des Entwurfs „Stadt Quartier Nachbarschaft“ ist das Ermöglichen nachbarschaftlichen Lebens im derzeit unbelebten Stadtteil La Matriz durch die Neuinterpretation der vorhandenen Baustruktur. Diese bietet derzeit durch allseitig geschlossene Blöcke kaum nachbarschaftlich nutzbare Bereiche.
Im Entwurf wird Nachbarschaft auf mehreren Ebenen ermöglicht. Die Weiterführung des Stadtboulevards schafft Verknüpfungen auf gesamtstädtischer Ebene, die Verbindung von „Plano“ und „Cerro“ wird über eine neue, im rechten Winkel zum Stadtboulevard verlaufende, Hauptachse mit formeller und informeller Marktfunktion geschaffen. Nachbarschaft auf Quartiersebene wird durch verschiedene soziale und kulturelle Angebote gefördert. Über die Setzung der Gebäude entsteht ein Hof, der zur nachbarschaftlichen Interaktion von Haus zu Haus anregt.
Innerhalb der Gebäude werden neben stark ausdifferenzierten Wohngrundrissen gemeinschaftlich nutzbare Flächen und großzügige Erschließungsflächen mit Aufenthaltsqualität geschaffen. Sowohl herkömmliche Geschosswohnungen als auch experimentelle Wohnformen, wie Clusterwohnen und Großhaushalte sind in das neue Quartier integriert. So wird die Voraussetzung für eine soziale Mischung und für informelles Zusammentreffen der Hausbewohner ermöglicht.
Exkursion 19.-22. + 29.-31.3 und Workshop 23.-28.3.2018
Location: DUC La Matriz, Valparaiso, Chile
Organisation: Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile
University of Stuttgart, Faculty of Architecture and Urban Planning, Stuttgart, Germany
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Posgrado lnternacional en Urbanismo, Buenos Aires, Argentina
Partner:
Universität Stuttgart, Institut für Wohnen und Entwerfen (IWE), Stuttgart, Germany
Prof. Dr.-lng. Thomas Jocher mit Dipl.-Ing. Sylvia Schaden
Universität Stuttgart, Städtebauinstitut (SI), Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen, Stuttgart, Germany
Prof. Dr.-lng. Martina Baum mit MA Sascha Bauer und MA Maria Schiller
Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Departamento de Arquitectura, Valparaiso, Chile
Prof. Marcela Soto und Prof. Dr. Jorge Leon
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Posgrado lnternacional en Urbanismo, Buenos Aires, Argentina
Gast.-Prof. Markus Vogl, Walter Gropius Lehrstuhl (DAAD) mit Facundo Fernandez
Students from Stuttgart:
Ines Ehrenbach, Sabine Kastner, Phaea Korycik, Julian Lipp, Silva Maringele, Anna-Lea Rohrbach, Lisa Schmidt, Katharina Wackler
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Sascha Bauer
Maria Schiller
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Mi casa Mi ciudad
Entwürfe
Studio Buenos Aires
Mi Casa – Mi Ciudad
Neue typologische Ansätze an den Schnittstellen von Formalität und Informalität
Eine Kooperation des IBK 1 (Prof. Peter Cheret) mit dem SI (Prof. Martina Baum)
Die Stadtverwaltung von Buenos Aires unternimmt größte Anstrengungen, die Elendsviertel der Haupstadt zu urbanisieren. Im Büro des Wohnbaustadtrates von Buenos Aires herrscht eine große Expertise in der Arbeit in den sogenannten Villas Miserias, den informellen Siedlungen der Stadt. So sehr der Wohnungsbau als Programm einer Sozialen Stadtpolitik auch wieder Gehör findet, so erscheinen es nur Wiederauflagen alter typologischer Konzepte der Spätmoderne zu sein.
Das Entwurfsstudio stellte sich im Wintersemester den aktuellen Herausforderungen an das städtische Wohnen im metropolitanen Kontexten, fragte nach den Auswirkungen globaler Prozesse auf das städtische Umfeld, spürte räumliche Konflikte und Potentiale zwischen Informalität und Formalität auf, diskutierte und bewertete. Gerade dieses Spannungsfeld sollte uns auch die klassischen Trennungen zwischen Wohnen und Arbeiten hinterfragen lassen.
Welche Chancen bieten neue hybride Gebäudetypologien in innerstädtischen Kontexten für die Integration marginalisierter Gesellschaftsschichten? Wie muss das städtebauliche Umfeld beschaffen sein, damit diese neuen Stadtbausteine soziale, ökonomische und räumliche Zugänglichkeiten und Verbindungen begünstigen? Welchen Mehrwert können öffentliche Einrichtungen in den neuen Typologien bieten?
Das Studio förderte die integrale Debatte zwischen den Maßstäben, zwischen Konstruktion, Materialität bis hin zur städtischen Verflechtung, zwischen lokalem Potenzial und übergeordneter stadträumlicher Strategie und entwarf mit neuen Gebäude- und Freiraumtypologien Entwicklungsspielräume für eine soziale Stadt Buenos Aires. Dabei bedienten wir uns drei unterschiedlicher Ausgangssituationen: Dem leeren innerstädtischen Grundstück, der Integration mit einer bestehenden sozialen Einrichtung oder der Transformation industrieller Brachflächen.
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Prof. Peter Cheret (IBK1)
Marc Remshardt (IBK1)
Christiane Kolb
Studierende: Loff Victor, Stampoulidis Marina, Graf Vincent, Stobel Lena, Dirmeier Lea, Mezger Marlene, Schauder Pia, Jasmari Kastriot, Ratti Valentina, Schmidt Lisa, Ritter von Sporschill Maximilian, Bhowmik Dipayan, Von Rüdiger Philipp
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Entwurfsergebnis: Lea Dirmeier und Lisa Schmidt
Das Grundstück im Süden La Bocas liegt an der Spannungsgrenze zwischen Touristik, Kulissenarchitektur und der oft harten Alltäglichkeit der Bewohner. Durch die Wirtschaftskrise im Jahr 2001 waren viele Menschen in Buenos Aires, aber vor allem auch aus der Umgebung dazu gezwungen, ihr Geld durch das Sammeln von Müll zu verdienen. Die sogenannten Kartoneros sind fester Bestandteil des Logistik Buenos Aires und erfüllen somit eine wichtige Aufgabe. Durch ihre Arbeit werden 13% des Mülls der Stadt recycelt. Die Idee war es, auf dem ausgewählten Block eine Cartonero-Initiative anzusiedeln, die sich dem Papier annimmt. Jeder südlich anschließende Block könnte die Weiterverarbeitung eines anderen Materials, wie Metall oder Glas zu Thema haben.
Das räumliche Leitbild des Entwurfes war es, die unterschiedlichen charakteristischen Nachbarschaften in das Bebauungsgebiet einfließen zu lassen und den Charakter der jeweiligen Einkerbung zum Thema zu machen. Die südliche Eingebung dient als Umschlagplatz für Materialien, die westliche greift das Thema des Grünflusses auf. Die östliche Einkerbung beherbergt das öffentliche Zentrum des Blocks und bildet zugleich den Vorplatz der Bibliothek aus und stellt damit den zentralen Ort des Ankommens dar.
Entwurfsergebnis: Marlene Mezger und Pia Schauder
Partner:
Universität Stuttgart, Institut für Baukonstruktion und Entwerfen Lehrstuhl 1 (IBK1), Stuttgart, Germany
Prof. Peter Cheret mit Dipl.-Ing. Marc Remshardt
Universität Stuttgart, Städtebauinstitut (SI), Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen, Stuttgart, Germany
Prof. Dr.-lng. Martina Baum mit MSc Christiane Kolb
Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Departamento de Arquitectura, Valparaiso, Chile
Prof. Marcela Soto und Prof. Dr. Jorge Leon
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Posgrado lnternacional en Urbanismo, Buenos Aires, Argentina
Gast.-Prof. Markus Vogl, Walter Gropius Lehrstuhl (DAAD) mit Facundo Fernandez
Polyvalente Alltagsorte
Entwürfe
Die örtliche oder räumliche Aneignung ist eine im allgemeinen Sprachgebrauch geläufige Formulierung, welche in der Stadtforschung jedoch keinem theoretischen Konzept entspricht. Unter dem Leitbegriff „polyvalente Alltagsorte“ wollen wir uns auf die Suche machen, wie sich alltägliche Nutzungen architektonisch und städtebaulich verankern – wie vielschichtig und polyvalent solche räumlichen Organisationen an einem Ort sein können und wie sich diese womöglich aus früheren Anforderungen transformiert haben.
Diese Orte und Räume der Mehrdeutigkeit, Ambivalenz und Vielfalt bieten den Nährboden für zukünftige Wandlungsprozesse, anhand derer wir Beziehungen neu deuten und denken wollen. Sie suggerieren Stabilität durch die Anmutung des Unfertigen und werden oftmals als Konstante gepflegt und wahrgenommen. Über die Untersuchung dieser raumbezogenen Identifikationsprozesse hinaus greifen wir alltägliche Dynamiken und lokale räumliche Potenziale auf, um die spezifischen Qualitäten des Ortes herauszuarbeiten und neue Möglichkeitsräume für ein urbanes Quartier zu entwerfen.
Dabei arbeiteten wir an der Schnittstelle zwischen Architektur und Städtebau auf unterschiedlichen Maßstabsebenen von lokalen Situationen bis zu gesamtstädtischen Verflechtungen, dachten in ortsspezifischen Potenzialen und übergeordneten Strategien, entwarfen neue Gebäude- und Freiraumtypologien und wollten damit neue Entwicklungsspielräume für eine urbane Gesellschaft entwerfen.
Die Abgabeleistung umfasste eine theoretische Auseinandersetzung, einen konzeptionellen und experimentellen Atlas sowie eine Entwurfsleistung im städtebaulichen Maßstab.
Entwurf: Bauschelastizität Polyvalente Alltagsorte, Noha Ramadan und Jonas Mattes
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Sascha Bauer
Sebastian Klawiter
Thorsten Stelter
Studierende: Alkan Mustafa, Becker Johanna, Celik Elif, Heitz Joscha, Krumbe Matthias, Mattes Jonas, Misyuryaeva Elizaveta, Moldaschl Silke, Ramadan Noha, Sarovic Jelena, Thomas Selina, Wan Kang, Yunar Kübra
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Generation 21
Entwürfe
Urbanes Quartier Stuttgart Nord
Leitbegriffe wie „urbanes Quartier“ und „produktive Stadt“ thematisieren neue Kombinationsmöglichkeiten von Wohnen und Arbeiten. Sie skizzieren die Wiederentdeckung der Stadt als durchmischten und vernetzten Lebensraum einer vielschichtigen urbanen Gesellschaft. Durch die Industrie 4.0 verschieben sich Grenzen zwischen Typologien in Architektur und Freiraum und eröffnen auf Grund ihrer sauberen und effizienteren Produktionsabläufe und Wertschöpfungsketten neue Synergien mit dem Wohnen. Doch welches Bild von Stadt, welche Alltagsräume fördern Innovation und lassen Stadt wieder produktiv werden? Welche Rolle spielt dabei ein lebendiges und attraktives Umfeld und wie beeinflussen neuartige Firmenkonzepte die zukünftige Identität von Stadtquartieren?
Mit diesen Fragen befassten wir uns am letzten innerstädtischen Filetstück Stuttgarts – dem Gebiet um die Wagenhallen in Stuttgart Nord. Das durch die Planungen von Stuttgart 21 viel diskutierte Bahnareal bietet in seiner Mehrdeutigkeit, Ambivalenz und Vielfalt Chancen für die Entwicklung eines neu gedachten Quartiers. Dabei arbeiteten wir an der Schnittstelle zwischen Architektur und Städtebau. Zunächst entwarfen wir ein robustes städtebauliches Gerüst und näherten uns dann über die Typologie der konkreten Architektur, die dies ermöglicht.
SI | Städtebau-Institut – Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Christiane Kolb
Sascha Bauer
IRGE | Institut für Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens
Prof. Markus Allmann
Bettina Klinge
Studierende:
Ender Cicek, Leon Vohl, Philip von Rüdiger, Dipayan Bhowmik, Annemei Sofia Gerst, Theresa Huber, Anna-Lea Rohrbach, Johannes-Andreas Rau, Julian Lipp, Richard Königsdorfer, Paul Vogt, Stefan Keller, Luis Seider, Viviane Peiseler
Ergebnisse und Wettbewerb zum Entwurf Urbanes Quartier Generation 21 Stuttgart Nord
Preisgericht vom 27.07.2017
Ausgelobt von der
Robert Bosch GmbH, Stuttgart; Herr Dr. Michael Jantzer
in Kooperation mit den Instituten der Universität Stuttgart
SI | Städtebau-Institut – Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum, Christiane Kolb, Sascha Bauer
IRGE | Institut für Raumkonzeptionen und Grundlagen des Entwerfens
Prof. Markus Allmann, Bettina Klinge
Juryvorsitzender:
Prof. Andreas Quednau (Leibniz Universität Hannover)
Jurymitglieder:
Robin Bischoff (Vorstand Kunstverein Wagenhalle e.V., Stuttgart)
Albert Fischer (Robert Bosch GmbH, Stuttgart)
Matthias Hahn (Bürgermeister a.D. für Städtebau und Umwelt, Stuttgart)
Dr. Michael Jantzer (Robert Bosch GmbH, Stuttgart)
Olga Ritter (Ritter Jockisch Architektur, München)
Gerko Schröder (TH Treibhaus Landschaftsarchitektur, Hamburg)
Prof. Stefan Werrer (FH Aachen)
Beurteilungstexte der Jury und die Preisgerichtsentscheidung sind nachfolgend den einzelnen Projekten zugeordnet.
Projekt 001
Titel: Stadträume
Verfasser: Richard Königsdorfer und Paul Vogt
Preis: 1. Preis
Die Arbeit „Stadträume“ stellt auf den ersten Blick eine brutale Intervention und Setzung im Stadtraum dar, die jedoch beim genaueren Hinsehen subtil auf das Umfeld reagiert und sich durch eine clevere Ausarbeitung im Detail auszeichnet. Der harte Kontrast zwischen lebendigen Höfen und grünem Umfeld erscheint reizvoll wie fremdartig.
Die vorgeschlagene Typologie der in Reihe geschalteten, miteinander verknüpften Doppelhöfe erinnert an Berliner Gewerbehöfe und wird als ein innovatives, robustes Grundgerüst für die gewünschte Nutzungsmischung in einem urbanen Quartier gesehen.
Abschnitte mit unterschiedlicher Gebäudetiefe reagieren gut auf den Kontext und eröffnen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und Flexibilität. Durch die Öffnung des Rahmens an besonderen Anschlusspunkten zum Bestand, wie zum Trichterplatz oder an den Wagenhallen entstehen spannende Orte des Austauschs. Die wiederkehrenden, gleich großen Höfe bieten geeigneten Raum zur Aneignung, werfen jedoch Fragen hinsichtlich des Grads der Versiegelung sowie der Strukturierung von Öffentlichkeit, Gemeinschaftlichkeit und Privatheit auf.
Insgesamt wird die Arbeit als ein innovativer Diskussionsbeitrag für ein gemischt genutztes urbanes Quartier an einem besonderen Ort mit komplexen Rahmenbedingungen gewürdigt.
Projekt 002
Titel: Urbanes Quartier Stuttgart Nord: Pate 4.0
Verfasser: Julian Lipp und Johannes-Andreas Rau
Preis: 1. Preis
Der erweiterte Titel der Arbeit „Pate 4.0“ weckt die Neugier der Jury. Für die Entwicklung des neuen Stadtteils schlagen die Autoren ein „konzeptgebundenes Vergabesystem der Grundstücke“ vor, das in der Umsetzung der Ambivalenz des Titels gerecht werden könnte.
Die Beschäftigung mit den Akteuren und Prozessen von Stadtentwicklung wird begrüßt und führt zu einem eigenständigen Ansatz, der dem Ziel, ein modellhaftes Szenario für ein neues städtisches Quartier zu entwickeln, entspricht.
Grünräume entlang der alten Gleislinien umrahmen den neuen Stadtteil und verbinden ihn mit den benachbarten Parkanlagen – gleichzeitig wird die Insellage beibehalten, die die partikulare, introvertierte Struktur betont.
Die Fläche zwischen den ehemaligen Gleisanlagen wird von einem Pattern aus Plätzen und kompakten monolithischen Baukörpern bedeckt, die eine realistische, homogene bauliche Dichte erzeugen. Eine zentrale Erschließungsachse und Baufeld-gliedernde Querverbindungen zu den benachbarten Stadtteilen treten in den Hintergrund und überlassen Auto, Radfahrern und Fußgängern einen hierarchielosen „shared space“. Gemeinschaftsflächen im Erdgeschossbereich und auf Dachterrassen sowie gemeinsam genutzte Gästebereiche senken den individuellen Platzbedarf zugunsten sozialverträglicher Wohnkosten.
Die Gliederung und die differente Gestaltung der öffentlichen Bereiche, Höfe und Gebäude soll durch die Aneignung der Benutzer entstehen und in ihrer Vielfalt ein nachbarschaftliches Netzwerk abbilden.
Das „urbane Biotop“, das sich die Autoren für jedes einzelne Gebäudeensemble wünschen, hätte ein assoziativer Titel für die Arbeit sein können
Projekt 003
Titel: Heimat
Verfasser: Ender Cicek und Leon Vohl
Preis: Anerkennung
Das Projekt „Heimat“ fasziniert durch seine große Bandbreite von der Auseinandersetzung mit der Philosophie Adornos und ihrer Übertragung in einen Stadtbaustein für Wohnen und Arbeiten bis hin zur gelungenen Darstellung attraktiver räumlicher Atmosphären.
Über eine eigenständige Interpretation bekannter typologischer Elemente entsteht eine quadratische Blockfigur mit einem drei- bis viergeschossigen Rand für gewerblichen Nutzungen und einer mittig angeordneten fünf- bis sechsgeschossigen Wohnstruktur aus zusammengesetzten Kreisformen. In der Kombination mehrerer dieser Blöcke entstehen interessante kleinteilige Zwischenräume mit einer hohen Alltagstauglichkeit.
Auch wenn hinsichtlich der Maßstäblichkeit und insbesondere des Umgangs mit dem Ort durch die reine Addition der Blockfiguren Fragen bleiben, bildet die Arbeit dennoch einen sehr eigenständigen und offensichtlich mit viel Leidenschaft ausgearbeiteten Beitrag zu einem Quartier für die Generation 21 und regt so zur weiteren Diskussion nicht nur über mögliche spätere Aneignungsprozesse an.
Projekt 004
Titel: Stadthaus 2.0
Verfasser: Theresa Huber
Preis: Anerkennung
Die Verfasserin weist zwei sehr unterschiedliche Baufelder aus. Mit der Aufnahme des historischen Motives der Gleisanlagen wird ein nachvollziehbarer Bezug zum Ort geschaffen. Die daraus abgeleitete kleinteilige Stadthausstruktur mit den differenzierten Erschließungen für Fußgänger- und Fahrverkehr wird als Grundidee anerkannt, weist aber nicht in Richtung innovativer Ansätze im Umgang mit dem Thema. Sie führt bei der Zuordnung von Funktionen eher zu Zufälligkeiten, auch bei der Gestaltung der Außenräume.
Der Vorschlag einer großformatigen Hallenstruktur mit offenen Bereichen im Zusammenspiel mit den Wagenhallen ist nachvollziehbar. Die Zusammenführung der Hallenstruktur mit der kleinteiligen Stadthausstruktur ist in der geometrischen Ausformung gestalterisch jedoch nicht vollends befriedigend.
Insgesamt stellt der Beitrag vor allem einen interessanten Ansatz zur Auseinandersetzung mit dem Ort dar. Innovation wird allerdings vermisst.
Projekt 005
Titel: Habitat Nord
Verfasser: Philip von Rüdiger
Preis: Anerkennung
Die Arbeit „Habitat Nord“ zeichnet sich durch einen sensiblen Umgang mit der aktuellen Situation vor Ort aus. Anstatt der Aufgabenstellung zu folgen und ein urbanes Quartier mit entsprechend dichter Bebauung zu entwickeln, liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Qualitäten der Außenflächen und der vorgefundenen Nutzung oder Bebauung.
Sowohl informell angeeignete Räume durch Künstler oder Urban Gardening, das Waggon-Atelier-Projekt auf Schienen, die Container City der Künstler, Flächen die sich die Natur zurückerobert hat, das zurückgebliebene Betonwerk oder eine große Beton-Fläche finden Berücksichtigung in einem prozessual entwickelten Freiraum. Das Gebiet wird zu einem Freiraum und Experimentierraum, einem Arbeits- und Freizeitraum, einem Inspirations- und Werkpark. Vorgefundene Strukturen werden umgenutzt und zweckentfremdet, weiterentwickelt, transformiert und im großen Umfang angeeignet. In den heterogenen rauen Freiraum werden vier pavillonartige Gebäude integriert, die in einer um einen Hof angeordneten Laubengangtypologie Flächen zum Wohnen und Arbeiten bieten. Die Gebäude fügen sich durch das lichte Erdgeschoss gut in den Freiraum ein.
Bei einer immobilienwirtschaftlichen Betrachtung erscheint der Beitrag aufgrund der vorgeschlagenen Dichte an diesem Standort jedoch kaum realisierbar. Das vorgeschlagene „Habitat Generation 21“ ist dennoch ein innovativer Beitrag für die Stadt- und Freiraumentwicklung der Region und der Stadt Stuttgart.
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Prof. Markus Allmann (IRGE)
Bettina Klinge (IRGE)
Sascha Bauer
Christiane Kolb
Studierende: Ender Cicek, Leon Vohl, Philip von Rüdiger, Dipayan Bhowmik, Annemei Sofia Gerst, Theresa Huber, Anna-Lea Rohrbach, Johannes-Andreas Rau, Julian Lipp, Richard Königsdorfer, Paul Vogt, Stefan Keller, Luis Seider, Viviane Peiseler, Anna Frank, Claudia Deppe
Studio Amsterdam
Entwürfe
Urbanes Quartier Boven het IJ
Rem Koolhaas argumentierte schon im Jahr 2001 in seinem „Harvard Guide to Shopping“, dass Shopping wohl die letzte verbliebene Form einer öffentlichen Tätigkeit sei. Er erforschte dabei mit seinen Studierenden Räume, Techniken, Ideologien und Erfindungen, mit denen Shopping so drastisch zur Transformation urbaner Räume in unseren Städten beigetragen hat.
Im Wintersemester 16/17 nehmen wir das Shopping-Center „Boven´t Y“ am Buikslotermeerplein im Norden Amsterdams unter die Lupe, da der bislang vergessene Stadtteil nördlich des Flusses IJ seit Ende der Finanzkrise einem hohen Entwicklungsdruck ausgesetzt ist. Eine Investorengruppe will aufgrund der neuen Zentralität direkt an der neuen Nord-Süd-U-Bahnlinie das bestehende Shopping-Center nicht nur renovieren, sondern durch eine großmaßstäbliche Erweiterung zur größten Mall Amsterdams umbauen. Somit steht der lange Zeit unangetastete Stadtteil vor großen räumlichen, ökonomischen und sozialen Transformationsprozessen.
Aus diesem Grunde begeben wir uns auf die Suche nach den alltäglichen Dynamiken und den lokalen räumlichen Potenzialen in Amsterdam Noord, arbeiten spezifische Qualitäten des Ortes heraus und entwerfen neue Möglichkeitsräume für ein urbanes Quartier. Den wichtigen und neuen Themen einer sich stetig erneuernden europäischen Stadt soll Raum verschafft werden: den urbanen Allmenden, einer sozialen Ökonomie, einem sozialen Wohnen und Arbeiten in der Stadt, einer inkludierenden Stadt.
Anfang November haben wir zusammen mit lokalen Akteuren vor Ort im Shopping-Center gearbeitet:
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Lynn Mayer
Markus Vogl
Isabel Zintl
Studierende:
Yang, Qianzi
Bollow, Tillmann
Rückert, Stefan
Kühnle, Dominic
Schendel, Jonas
Dapperger, René
Bournigal, Pamela
Gierl, Melina
Mitchell, Leonard
Otarbayeva, Baktybala
Tolj, Emilija
Yang, Yi
Wan, Kang
Mas Verge, Iván
Schaugg, Philipp
Lillo Castanos, Adrián
Stamm, Jonas
Bhowmik, Dipayan
Silberzahn, Anne
Schauder, Pia
Özge, Yazici
Mezger, Marlene
Ahmed, Ezzat
Projekt 01: Melina Gierl und Emilija Tolj
Basierend auf einer anthropologischen Theorie des niederländischen Kulturhistorikers, Johan Huizinga, befasst sich das Projekt mit dem Homo Ludens, dem Modell eines zweckfreien, genügsamen Menschen. Zusammenfassend bezeichnet Huizinga das Spielen als das Heraustreten aus dem eigentlichen Leben in eine zeitweilige Sphäre von Aktivität mit eigener Tendenz.
Fasziniert von dem Gedanken, eine Theorie mit Wirklichkeit zu verbinden, inspirierte besonders der niederländische Künstler, Constant Nieuwenhuys, da er den Leitgedanken des Homo Ludens mit Architektur und Stadtplanung verbunden hat.
Bezogen auf das Boven Het IJ, hat uns die Ästhetik des Widerstandes fasziniert. Die Mall, als ein Ort des Arbeitens und des Konsums, bekommt einen Gegenspieler. Dieser wird durch die aneignende Leere und die Gleichzeitigkeit von Stadt und Wald geprägt.
Im niederländischen Kontext spielt die Künstlichkeit der Natur eine große Rolle. Deshalb befasst sich der Entwurf mit dem Anti Naturfetisch, der mit dem Hauptbestandteil des Spielens, der Inszenierung, gleichzusetzen ist.
In der Ausführung wurden vier verschiedene Interventionen, die den oben beschriebenen Gedanken verkäuflichen, ausgearbeitet. Dabei handelt es sich um die Linie, den Teppich, das Dach und die Struktur. Bei allen vier Varianten steht der Bewusstseinswandel der Gesellschaft im Vordergrund. Dabei soll das Individuum den Ort auf verschiedene Arten erleben – jeder darf sich darin verlieren und seine eigene Bühne finden.
Studio München
Entwürfe
Neue Typologien für die Urbane Mischung
Als ein Kennzeichen der historisch gewachsenen europäischen Stadt wird die Nutzungsmischung innerhalb eines Gebäudes, dem Block und im Quartier seit Jahren diskutiert. Bisher konnten jedoch, aufgrund fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen die entstandenen Konzepte vielfach nicht in die Umsetzung einfließen. Dies soll sich in den nächsten Jahren ändern. Das Studio untersucht und betrachtet, anhand des Planungsgebietes im Münchner Nordosten, architektonisch und städtebaulich Konzepte für die Koexistenz von Wohnen und Arbeiten im Quartier, auf einem Grundstück sowie im selben Haus. Die entwickelten Typologien, stehen in spannungsreicher, wechselseitiger Beziehung zu gewerblichen wie industriellen Einrichtungen, Arbeits-, Erholungs- und Begegnungsräumen.
Exemplarisch fragen wir:
Wie weit können verschiedene Nutzungen räumlich geschichtet und verwoben werden? Wie können auch alltägliche Nutzungen koexistieren und wo sind die Grenzen? Wie organisieren sich Gebäude und Quartiere, die Raum bieten für Mischung und Dichte? Wie adaptiv müssen bauliche Strukturen sein und welchen Beitrag leisten sie zur Urbanität? Wie kann ein Gebäude und Quartier als Arbeits- und Lebensort gleichermaßen attraktiv sein?
Lehrteam
Prof. Dr. Martina Baum
Lynn Mayer
Constantin Hörburger
Thorsten Stelter
Studierende: Alina Gold, Luka Kettering, Dorothee Limbach, Nicole Ottmann, Wiebke Richter, Tobias Seith
Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Projekt 01: Alina Gold
Der Entwurf entsteht aus der genauen Untersuchung und Definition des Begriffs Urbanität. Auf soziologische Ebene ist Urbanität Kultur und das Bildungsversprechen für jeden, soziale Heterogenität, demokratische Strukturen und der Umgang mit Erfahrung. Urbanität gestaltet sich vor allem durch Stadtidentität. Architektur für den spezifischen Ort München Nord- Ost wird durch Elektrizismus erreicht. Vorhandene identitätsprägende Elemente wie die aufgelockerte Bebauung, das Satteldach, die Weite, die Landwirtschaft, das Wasser und die Arkade werden aufgegriffen und neu zusammengesetzt. Ein weiterer wichtiger gestalterischer Aspekt für Urbanität ist die Funktionsmischung und die erkennbare urbane Nutzung im Sockelbereich. Auf städtebaulicher Ebene wird eine bewusste konzentrierte und punktuelle Setzung der entstandenen Typologien(gruppen) vorgenommen. Somit manifestiert sich das Thema der Enge und Weite auch auf städtebaulicher Ebene.
Projekt 02: Dorothee Limbach
El sur de Buenos Aires
Entwürfe
„Die Wirklichkeit liebt die Symmetrien und die leichten Anachronismen … Die Stadt hatte um 7 Uhr früh noch nicht das Aussehen eines alten Hauses eingebüßt, das ihr die Nacht zu geben pflegte; die Straßen waren wie lange Gänge, die Plätze wie Höfe. Dahlmann erkannte sie mit einem Gefühl von Glück und einem Hauch von Schwindel wieder; Sekunden bevor seine Augen sie entdeckten, erinnerte er sich an die Straßenkreuzungen, die Anschlagsäulen, an die bescheidenen Unterschiede im Stadtbild von Buenos Aires. Im gelben Licht des neuen Tages kamen alle Dinge zu ihm zurück. Jedermann weiß, daß der »Süden« jenseits der Straße Rivadavia beginnt. Dahlmann sagte immer, daß das keine bloße Redensart ist, daß, wer diese Straße überquert, eine ältere und festere Welt betritt.“ (Borges, J. L. (2013): Fiktionen, S.156)
Im Entwurf und in der Sommerschule „Complex City Laboratory“ entwerfen in enger Zusammenarbeit Studierende, Lehrende, wichtige Interessensvertreter und lokale Akteure spezifische räumliche Entwicklungspotentiale für eine resiliente Integration der fragmentierten und marginalisierten Stadtbezirke im Süden der Hauptstadt Buenos Aires. Studierende der Fachbereiche Architektur und Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Raumplanung der FADU-UBA Buenos Aires, der TU Delft, der SLU Malmö, der École nationale supérieure d´architecture et de paysage de Bordeaux und der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart arbeiten gemeinsam vor Ort in den Stadtteilen Comuna 8 und Comuna 9. Mit internationalen und interdisziplinären Entwurfsteams arbeiten an räumlichen Strategien für eine Integration dieser marginalisierten Stadtteile im Süden der Hauptstadt Argentiniens. Dabei beschäftigen wir uns mit einem mehr- oder mindergeordneten Meer von extensiv genutzten Industrieanlagen, Produktions- und Lagerflächen, neben denen die Autisten mehrerer Großwohnsiedlungen scheinbar unbeteiligt stehen, vermittelt vielleicht durch die schwer in ihrer Sozialräumlichkeit und Physiognomie greifbaren Strukturen vernachlässigter Wohn- und Elendsviertel.
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum, Prof. Antje Stokman
Christiane Kolb
Markus Vogl
Studierende:
Blüthgen, Anne-Marie; Boley, Kim; Buchs, Martina; Corredor, Laura; Dickmann, Svenja; Gemmece, Paul; Jehle, Lisa; Krämer, Kristina; Looser, Dominik; Pardo, Susanne; Roth, Marion; Tilke, Dennis; Ulrich, Alexandra; Chana, Chana; Frank, Anna; Kast, Hannah; Nichtern, Charis; Ort, Jan-Timo; Philipp, Anton; Rau, Bente; Schmidt, Mareike; Väth, Monica
Studio Brüssel
Entwürfe
Urbane Transformationen entlang des Kanals
Die Kanalzone im Westen des Zentrums zeigt sich in einem facettenreichen Bilderspektrum – Bilder von Hafenanlagen, Bauindustrie, extensiv genutzten Produktions- und Lagerflächen, aber auch Bilder vernachlässigter Wohnviertel mit einem hohen Anteil einer jungen und internationalen Bevölkerung aus niedrigen Bildungsschichten.
Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung durch die Stadtpolitik wurde der Kanal wieder auf die Bühne städtebaulicher Betrachtungen gehoben. Durch die neue Aufmerksamkeit seitens der Planung, der Medien und der Investoren wird der Entwicklungsdruck am Kanal größer und bisherige urbane Freiräume für die ansässige Bevölkerung und Firmen immer kleiner.
Im Wintersemester 2015/16 waren wir auf der Suche nach den lokalen Dynamiken und den räumlichen Potenzialen entlang der Kanalzone in Brüssel. Es wurde auf unterschiedlichen Maßstabsebenen gearbeitet, von lokalen Situationen bis zu gesamtstädtischen Verflechtungen, in lokalen Potenzialen gedacht und übergeordneten Strategien entwickelt. Neue Gebäude- und Freiraumtypologien wurden entworfen und durch Vernetzung und Verdichtung wurde die Kanalzone so transformiert, dass neue Entwicklungsspielräume für die urbane Gesellschaft Brüssels entstehen können.
Ein Workshop im Abattoir Brüssel: Studenten einer lokalen NGO und Geflüchtete kochten gemeinsam.
November 2015
Weiterführender Link zum Blog des Workshops: http://studiobrx.tumblr.com/
Weiterführender Link einem Video: http://studiobrx.tumblr.com/post/135242141732
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Christiane Kolb
Markus Vogl
Bild: Sabine Kastner, Anna Ludwig
Projekt 01: Sabine Kastner, Ann-Kathrin Ludwig
Projekt 02: Kettering, Mattes, Philipp
Markt bedeutete schon immer reges Treiben. Ein Aufeinandertreffen verschiedenster Menschen und das Zentrum von Stadt. Ein Großmarkt steht wie nichts Vergleichbares für unser täglich Brot. In der Erkenntnis, dass der Großmarkt ein essenzieller Teil der Stadt ist, waren Überlegungen Ihn auszulagern für uns schnell, ausgeschlossen. Doch wie kann man eine Institution in ihrer Grundform erhalten, aber gleichzeitig wieder in das städtischen Leben, der Mischung und dem Konfliktverhältnis des Urbanen, integrieren? Eine naheliegende Lösung war dabei die Bespieglung der Flächen tagsüber, da sie dort, ihrer Hauptaufgabe beraubt, ungenutzt vor sich hin vegetieren. Doch mit dieser Bespielung stellte sich auch gleichzeitig die Frage, wie eine angemessene Sogwirkung von dem Areal ausgehen kann, dass genügend Menschen für das Funktionieren des Raumes gefunden werden. Außerdem muss sich die Frage gestellt werden, inwieweit das nicht eine beliebige Maßnahme ist, was aber das Spezielle und einzigartige Potenzial der Institution Großmarkt völlig außer
Acht lässt. Deswegen wurde relativ schnell klar, dass neue Nutzungen auch immer mit dem Inhalt, der Programmatik des Marktes harmonieren, wenn nicht sogar eine Symbiose eingehen sollten. Schließlich ist eine Mischung der Nutzungen sinnvoll, berührt allerdings Markt als Solches nicht. Denn es ist nicht mit einer bloßen Bekenntnis zum Markt
getan. In der aktiven Entscheidung den Markt genau an seiner jetzigen Stelle innerhalb der Stadt zu lassen, muss dieser auch so gefördert werden, dass einerseits für Händler und Kunden eine qualitätsvolle und sichere Zukunft geschaffen wird und andererseits die Menschen der Stadt wieder mit diesem Ort umgehen können.
Stuttgart Mitte West
Entwürfe
Studio Stuttgart - Kessel Mitte West; Stadt planen zwischen Leitbild und Akupunktur
Als politisches, wirtschaftliches, kulturelles und soziales Zentrum ist Stuttgarts Mitte Imageträger von Stadt, Land und Region. In den letzten Jahren wurden vermehrt neue Setzungen und punktuelle Aufwertungsmaßnahmen verschiedener Randlagen der Innenstadt in den Fokus gedrängt. Diese Bereiche zwischen historischer Mitte und autogerechter Stadt sind stark in die Jahre gekommen. Sie sind geprägt von nüchternen Zweckbauten der Nachkriegszeit, vielfach dominiert von den Bedürfnissen des Verkehrs mit unbefriedigenden öffentlichen Räumen und mindergenutzten Hinterhofsituationen. Mehrere tausend Quadratmeter Verkaufsfläche und ein beginnender Veränderungsdruck werfen die Frage nach der zukünftigen Rolle dieser Stadtquartiere auf! Wie sollen sich die Stadträume und das Stadtbild verändern? Wie sieht die urbane Mischung aus? Das Entwurfsstudio versuchte, durch analytische, phänomenologische und innovative Beiträge neue Impulse für die lokale Debatte über die Zukunft der Stadt zu bieten.
Der Entwurf „Die Rückeroberung der Stadt“ unternimmt den Versuch, Mobilität im Stadtraum neu zu definieren. Unter dem Anspruch „100% Raum“ wird die Rolle der Straße im Stadtorganismus neu interpretiert und eröffnet abseits klassischer Entwicklungsflächen ein enormes stadträumliches Potenzial. Die Qualität der Arbeit liegt in der differenzierten Ausformulierung städtebaulicher Beziehungen und im kreativen Umgang mit den Straßenbauwerken der Nachkriegsmoderne.
Mehrere typologische Adaptierungen ermöglichen neue urbane Aufenthaltsorte und eine identitätsstiftende Raumfolge. Die räumlichen und programmatischen Beziehungen werden in Bezug gesetzt und städtische Räume geschaffen. Dabei bauen die Verfasser auf dem Vorhandenen auf, entwickeln das Bestehende weiter und intervenieren mit neuen Setzungen, die die Geschichten des Ortes an der Hauptstätter Straße weiterschreiben können.
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Studio Kessel Mitte West
Prof. Dr. Martina Baum
Lynn Mayer
Thorsten Stelter
Studierende: Aichele Lea , Bollongino Simon, Lapel Garagatti Jonathan, Lazarova Kristin, Higi Leonard, Hocker Aileen, Karbach Magdalena, Schmidt Mareike, Schlegel Franziska, Strauß Milena-Louisa
Studio Zürich
Entwürfe
Zürich wächst, Zürich plant und Zürich baut!
Die hohe Lebensqualität prägt maßgeblich das Stadtbild. Die Stadtplanung findet internationale Anerkennung und bekennt sich zur Wiederentdeckung der Planung im Städtebau. Sie fokussiert auf einen „Konzeptionellen Städtebau“, der mehr will als die Addition einzelner Baugebiete und verfolgt dabei Strategien, die verschiedenen Akteure frühzeitig zur konstruktiven Zusammenarbeit anzuleiten.
Das Entwurfsstudio sucht nach innovativen Strukturkonzepten und Typologien, die das Hermetschloo-Areal in Zürich-Altstetten zu einem nachhaltig produktiven Ort für die Stadt Zürich umbauen können. Um vorhandene Potenziale als Quellen einer zukünftigen Entwicklung aufzuspüren, versuchen die Studierenden in einer vielschichtigen Analyse, Kenntnis über die übergeordneten räumlichen Zusammenhänge zu erlangen. Nicht nur sozialräumliche, sondern auch funktionale und ökonomische Abhängigkeiten werden kartiert, decodiert und produktiv für die weiteren Entwurfsschritte verwendet.
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Thorsten Stelter
Markus Vogl
Studierende:
Eisele Thekla,
Elskyte Deimante,
Gemmeke Paul,
Kretschmer Johanna,
Liaudanskyte Dovile,
Martinez Nunez Clara,
Menzel Hendric,
Osterstock Christian,
Raczkowska Katarzyna,
Thanou Anastasia,
Thomae Anamarija
Produktive Stadt Wien
Entwürfe
Wien ist anders. So wirbt das Stadtmarketing und verweist stolz auf ihre Position in den internationalen Rankings über die Lebensqualität in den Städten. Für 2030 erwartet die ehemalige Kaiserstadt wieder zwei Millionen Einwohner und gilt damit als die am stärksten wachsende deutschsprachige Stadt. Dienstleistungen, Verwaltung, Tourismus, Kunst und Kultur bieten allerdings nicht die notwendige nachhaltige ökonomische Basis für die Zukunft der Bundeshauptstadt. Gerade kleinere produzierende Betriebe verlagern immer häufiger ihre Unternehmen nach Niederösterreich. Die Magistratsabteilungen sind nun gefordert Gebiete der Produktivität in der Stadt zu sichern.
Das Entwurfsstudio „Urban Hybrid“ entwickelte Szenarien für ein eigenständiges produktives Stadtquartier im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die Ausgangslage am U-Bahnhof Aderklaaer Straße, in einem typisch gewerblich und industriell geprägten Gebiet mit Hallen, Lagerflächen und eingestreuten Produktionsstätten am nördlichen Stadteingang, ist von der Vision einer produktiven urbanen Landschaft noch weit entfernt. Der Neubau eines Shoppingcenters und zweier Wohntürme östlich des Bahnhofes zeugt von einer ökonomischen Aufwertung des Areals und dem somit entstandenen Transformationsdruck entlang der U-Bahntrasse. Wie weit können verschiedene Nutzungen räumlich geschichtet, verwoben werden oder verschmelzen? Welche Formen der Dichte und der Funktionsmischung entsprechen zukünftigen Bedürfnissen der Stadtgesellschaft?
Universität Stuttgart
SI Städtebau-Institut
Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen
Prof. Dr. Martina Baum
Thorsten Stelter
Markus Vogl
Kristin Lazarova und Leonard Higi
Ananda-Michael Berger und Julian Bollinger
Projekt 01: Kristin Lazarova und Leonard Higi
Im Gegensatz zum klassischen Städtebau, wo ein erwünschter Endzustand für einen bestimmten Auftraggeber entworfen wird, steht die Vitalität, Spontanität, Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit der etappenweise formulierten Quartiers- und Stadtentwicklung. die Stadtplaner heute müssen sich mit der prozessualen transformation der Stadt auseinandersetzen und Strategien entwickeln, die „strukturelle Planungen mit prozessorientierten, offenen Entwicklungsansätzen kombinieren“.
Das Gebiet Aderklaaerstrasse wird als eine Art ‚urban lab‘ gesehen, da es sich bei dessen Planung nicht um einen fertigen Entwurf handelt, sondern um einen Vorschlag, wie man Stadtplanung anders denken könnte, indem man mit allen beteiligten Akteuren interaktiv und ergebnisoffen agiert.
Im Prozess ist die Schaffung von Urbanität durch Hybridität von wesentlicher Bedeutung. Ziel ist die Entstehung von Synergien auf verschiedenen Ebenen: in der räumlichen und funktionalen Dimension (durch Nutzungsvielfalt und funktionale Mischung im Stadtraum), sowie in der sozialen Dimension (Überlagerungen verschiedener Lebenswelten). Der städtische Raum wird als Ort der Begegnung, Austausch, Vernetzung, gegenseitiger Unterstützung definiert.
Projekt 02: Ananda-Michael Berger und Julian Bollinger
Das Umfeld des inzwischen fast fertiggestellten Citygates ist geprägt durch heterogene Bebauungsstrukturen. Von großen Wohnsiedlungen, über Zeilen und Einfamilienhäusern bis hin zur Kleingartensiedlung präsentiert sich regelrecht ein Experimentierfeld des Städtebaus. Die Bildung von Insel-ähnlichen Gruppierungen, wird durch das hermetisch wirkende Citygate fortgesetzt. Dieses soll im Zeichen der Entwicklung des Wiener Randbezirks als Zentrum des Viertels fungieren. Problematisch dabei ist nicht der Ansatz einer neuen Mitte, sondern vielmehr die unmittelbare Umgebung. Grenzen und Barrieren in Form von Gewerbe- und Brachflächen erschweren insbesondere Passanten und Radfahrern die direkte Anbindung und Durchwegung in die angrenzenden Quartiere. Hinzu kommt die durch Kraftfahrzeuge stark frequentierte Wagramer Straße, eine der wichtigsten Erschließungsachsen vom Zentrum Wiens in die Randbezirke der Stadt. Dabei stellt die Wagramer Straße über die Donau hinweg einen großen Straßenraum dar und verläuft über 8 Kilometer nahezu geradlinig bis zum Citygate, ehe sie sich von dort aus seitlich einer ehemaligen Mülldeponie im leeren Raum verliert. Ein prägnanter Start- und Endpunkt der Achse ist trotz der stattlichen Erscheinung des Citygates nicht wirklich gegeben. Symptomatisch für die Situation befindet sich das Citygate an der Schnittstelle des 21. und und 22. Wiener Stadtbezirks, dem Übergang der Stadt Wien und dem angrenzenden Bundesland Niederösterreich, sowie im Spannungsfeld von unterschiedlichen, isolierten Wohnsiedlungen und dem Gewerbegebiet Rautenweg. Mit den Erkenntnissen der umfangreichen Analyse bedarf es einer Klärung der bestehenden Verkehrssituation. Dabei soll am Beginn, beziehungsweise am Ende der Wagramer Straße ein städtebaulicher Akzent gesetzt werden. Das Citygate wird dabei als Impulsgeber eingebunden und erhält so ein neues Gesicht. Die Wagramer Straße soll in Zukunft nicht mehr wie bisher undefiniert in das ländliche Umfeld abschweifen, sondern die Umlenkung in den Rautenweg mit dem Anschluss an den Autobahnzubringer erfolgen. Dafür wird die Wagramer Straße im Bereich des Citygates begradigt und ermöglicht so mit der gewonnenen Fläche Raum für die Entwicklung eines städtischen Platzraums am Anfang und Ende der Achse, welche das Areal unmittelbar mit der Innenstadt Wien verbindet. Der Platz soll in Zukunft durch verschiedene Attraktoren mit öffentlichen Nutzungen bespielt werden und der breiten Bevölkerung und den Berufstätigen zur Verfügung stehen. Die Empfehlung von weiteren Hochpunkten ergänzen im angemessenen Rahmen die Hochhaussilhouette des Citygates und bilden zum Einen eine Torsituation in das Areal und stärken zudem den Gedanken der Umlenkung der Hauptverkehrsrichtung am Ende der Wagramer Straße. Spürbar werten die präganten Grünräume die Situation auf. Die bestehende Grünachse entlang der Wagramer Straße wird gestärkt und bis zum Citygate fortgesetzt. Dabei werden unterschiedliche Facetten an Grünraumthemen bedient und bilden einen spannungsvollen und lebendigen Freiraum mit Aufenthaltsqualitäten, trotz der direkt angrenzden Straße stark befahrenen Straße.